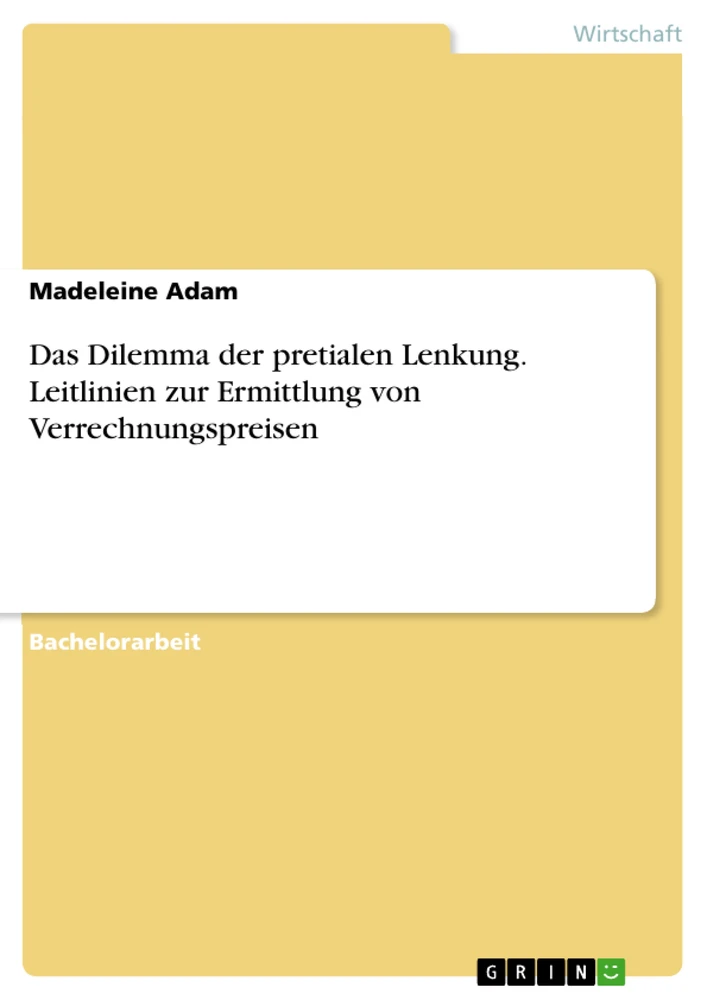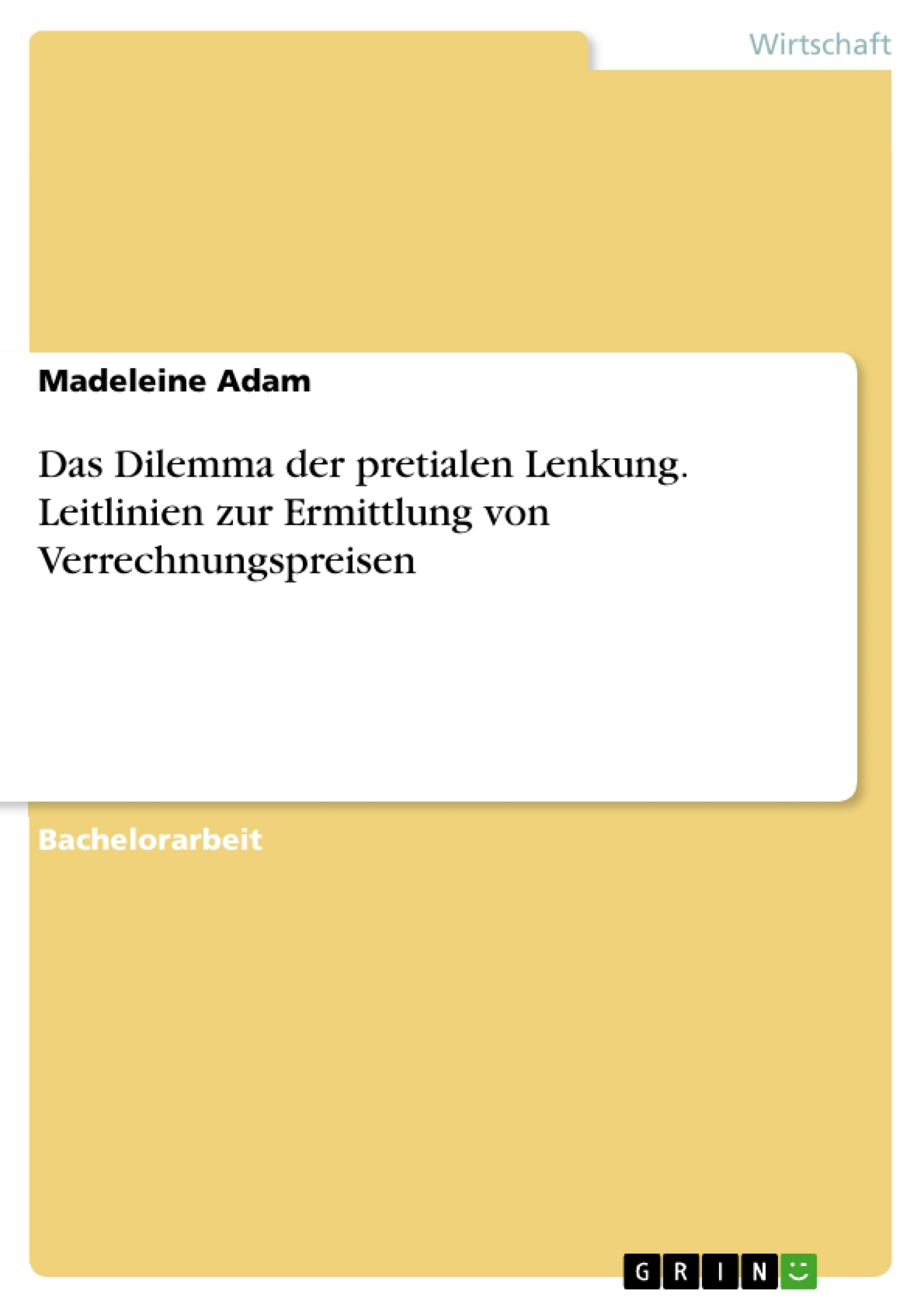Das Konzept der Verrechnungspreise basiert auf der Idee, einen Marktmechanismus innerhalb eines Unternehmens zu etablieren und dezentrale Entscheidungen über ein System von Preisen zu steuern (pretiale Lenkung). Im Rahmen der Verrechnungspreisproblematik muss das dezentrale Management über den Verrechnungspreis zu einem im Sinne der Zentrale optimalen Verhalten angehalten werden. Zwar sind Verrechnungspreise bereits seit langem Gegenstand der betriebswirtschaftlichen Diskussion und nach wie vor relevant für das konzerninterne Rechnungswesen, das Dilemma der pretialen Lenkung konnte bis heute nicht gelöst werden. Dieses Dilemma besteht darin, dass geeignete Verrechnungspreise erst dann vorliegen, wenn sie nicht mehr benötigt werden, weil das Entscheidungsproblem schon zentral gelöst worden ist.
Ziel dieser Arbeit ist es, Leitlinien abzuleiten, die bei der praktischen Anwendung von Verrechnungspreisen als mögliche Orientierungshilfe dienen können. Dazu muss zuerst ein grundlegendes Verständnis für Verrechnungspreise im Unternehmen geschaffen werden. Zudem wird der Frage nach dem Verrechnungspreis als geeignetes Koordina-tionsinstrument im Unternehmen nachgegangen. Deshalb wird zunächst der Begriff Verrechnungspreis definiert, charakterisiert und von den Begriffen Transfer- und Lenkpreis abgegrenzt. Darüber hinaus wird der Begriff Verrechnungspreissystem bestimmt. Weiterhin wird näher auf die Funktionen und Ziele von Verrechnungspreisen eingegangen und auf die Zielkonflikte zwischen den Funktionen hingewiesen.
Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Koordination als interne Funktion und dem Zielkonflikt zwischen Koordinations- und Erfolgsermittlungsfunktion. Mit der Darstellung von dezentralisierten Unternehmen wird die Voraussetzung bzw. Notwendigkeit der Bildung von Verrechnungspreisen verdeutlicht und der Zusammenhang zwischen Organisationsstruktur und Verrechnungspreis dargestellt. Danach werden die betriebswirtschaftlichen Methoden zur Ermittlung von Verrechnungspreisen thematisiert. Die marktorientierten, kostenbasierten und verhandlungsbasierten Verrechnungspreise werden jeweils erklärt, an Praxisbeispielen veranschaulicht und anschließend im Hinblick auf die Koordinationsfunktion kritisch gewürdigt. Schließlich werden Leitlinien anhand von Erkenntnissen der einschlägigen Literatur abgeleitet. Diese werden nach Sicht der Markt- und Unternehmenssituation, der gegebenen Kapazitäten sowie nach geplanten spezifischen Investitionen gegliedert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Grundlagen von Verrechnungspreisen
- Charakterisierung von Verrechnungspreisen
- Funktionen und Ziele von Verrechnungspreisen
- Zusammenhang zwischen Verrechnungspreissystem und Organisationsstruktur
- Ansätze zur Ermittlung von Verrechnungspreisen
- Marktorientierte Verrechnungspreise
- Kostenbasierte Verrechnungspreise
- Verhandlungsbasierte Verrechnungspreise
- Leitlinien zur Bildung von Verrechnungspreisen
- Systematik der Leitlinien
- Leitlinien in Relation zur Marktsituation
- Leitlinien in Bezug zur gegebenen Kapazitätssituation
- Leitlinien aus unternehmensspezifischer Sicht
- Leitlinien bei geplanten spezifischen Investitionen
- Vorgehensweise bei der Anwendung der Leitlinien
- Zusammenfassung und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit zielt darauf ab, Leitlinien für die Ermittlung von Verrechnungspreisen zu entwickeln, die als Orientierungshilfe bei der praktischen Anwendung dienen können. Die Arbeit untersucht dabei den Verrechnungspreis als Koordinationsinstrument in der internen Steuerung von Unternehmen.
- Charakterisierung und Abgrenzung von Verrechnungspreisen, Transferpreisen und Lenkpreisen
- Funktionen und Ziele von Verrechnungspreisen sowie die damit verbundenen Zielkonflikte
- Zusammenhang zwischen Verrechnungspreissystemen und der Organisationsstruktur von Unternehmen
- Ansätze zur Ermittlung von Verrechnungspreisen, einschließlich marktorientierter, kostenbasierter und verhandlungsbasierter Methoden
- Entwicklung von Leitlinien zur Bildung von Verrechnungspreisen, die auf die Marktsituation, Kapazitätssituation und spezifischen unternehmensinternen Gegebenheiten Rücksicht nehmen.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Arbeit führt in das Thema Verrechnungspreise ein und stellt die Relevanz des Themas im Kontext der internen Steuerung von Unternehmen dar. Kapitel 2 befasst sich mit den Grundlagen von Verrechnungspreisen, definiert den Begriff und grenzt ihn von verwandten Begriffen wie Transferpreisen und Lenkpreisen ab. Es werden die verschiedenen Funktionen und Ziele von Verrechnungspreisen beleuchtet, sowie die damit verbundenen Zielkonflikte. Abschließend wird der Zusammenhang zwischen Verrechnungspreissystemen und der Organisationsstruktur von Unternehmen analysiert. Kapitel 3 beschäftigt sich mit verschiedenen Ansätzen zur Ermittlung von Verrechnungspreisen. Es werden marktorientierte, kostenbasierte und verhandlungsbasierte Methoden vorgestellt und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile analysiert. Kapitel 4 entwickelt schließlich Leitlinien zur Bildung von Verrechnungspreisen. Die Leitlinien berücksichtigen dabei die Marktsituation, die Kapazitätssituation sowie spezifische unternehmensinternen Gegebenheiten. Darüber hinaus werden Leitlinien für spezifische Investitionen entwickelt und die Anwendung der Leitlinien in der Praxis erläutert.
Schlüsselwörter
Verrechnungspreise, interne Steuerung, Koordinationsinstrument, Transferpreise, Lenkpreise, Marktmechanismus, Marktorientierung, Kostenbasierung, Verhandlung, Leitlinien, Kapazität, Investitionen.
- Quote paper
- Madeleine Adam (Author), 2012, Das Dilemma der pretialen Lenkung. Leitlinien zur Ermittlung von Verrechnungspreisen, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/279247