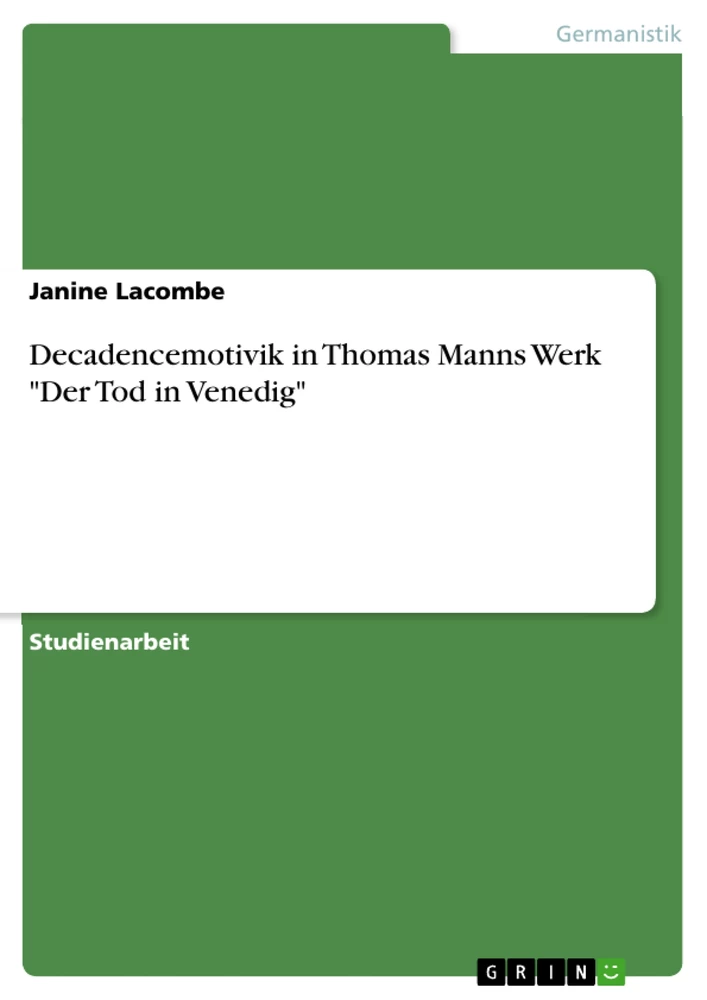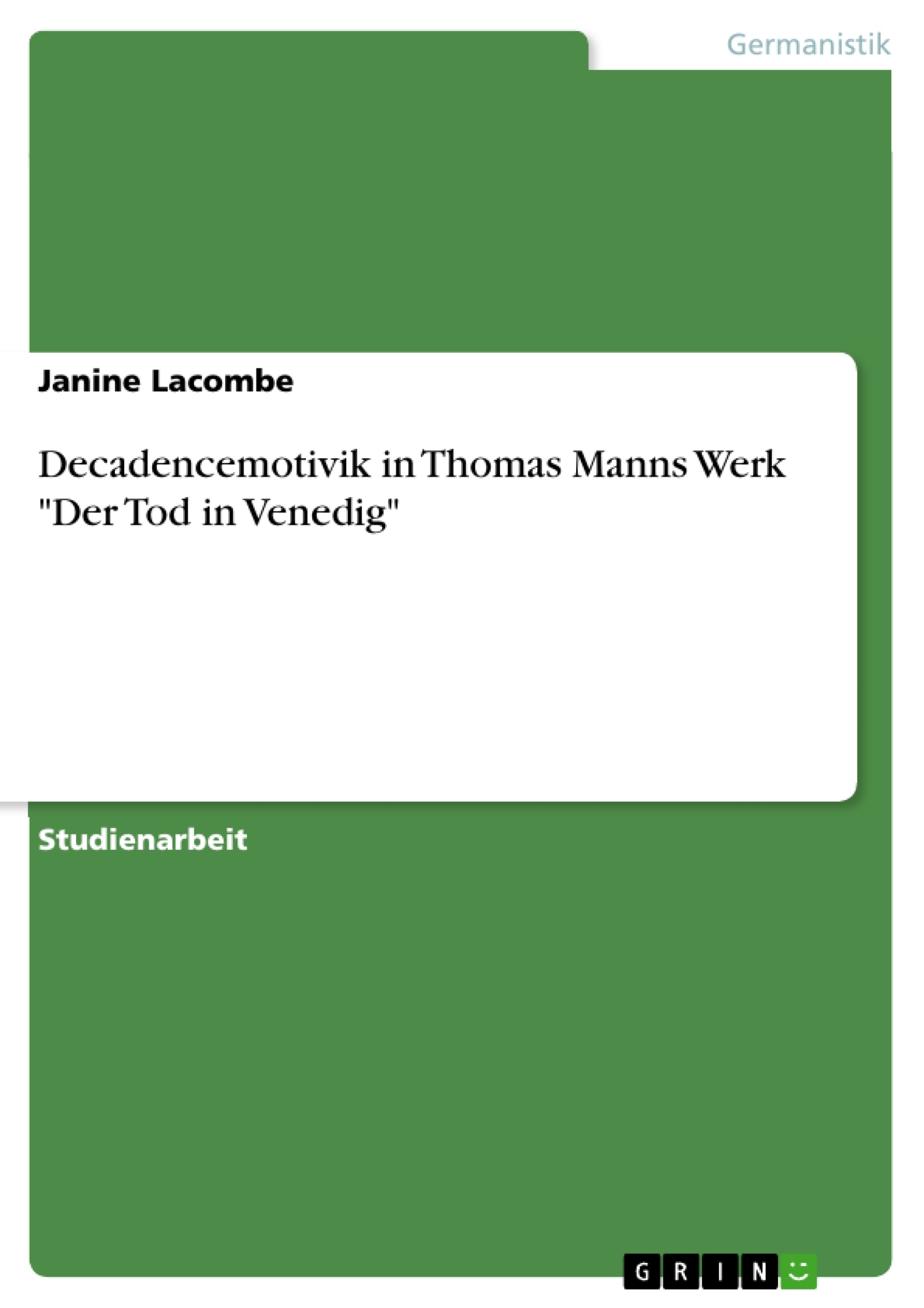In Thomas Manns Werk Der Zauberberg (1924) findet sich im „Schnee“-Kapitel ein einziger hervorgehobener Satz: Der Mensch soll um der Güte und Liebe willen dem Tode keine Herrschaft einräumen über seine Gedanken. Hierüber merkt der Autor selbst 1940 an, diese Aussage hätte in keinem seiner früheren Bücher stehen können. Obgleich Thomas Mann kommentiert, der Roman sei weitgehend noch […] ein Buch der Sympathie mit dem Tode , impliziert dieser Satz eine in seinem Œuvre stattfindende qualitative Veränderung der Todesmotivik, nämlich eine Extension ins Lebensbejahende. Der Zauberberg (1924) sei als humoristisches Gegenstück zu der bereits 1912 erschienen Novelle Der Tod in Venedig geplant gewesen. Bereits der Titel dieser verweist auf das zentrale Motiv der Erzählung: den Tod. Dieser erweist sich als essentieller Bestandteil des Motivkatalogs der Décadence, als unvermeidliches Resultat eines fortschreitenden Verfalls.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zielsetzung der Arbeit
- Allgemeine Vorgehensweise
- Dichotomie von Leben und Tod um 1900
- Endzeiterwartungen und Décadence
- Die Lebensphilosophie
- Décadencemotivik in Der Tod in Venedig
- Ortsschilderungen
- München
- Venedig
- Die Figur Gustav von Aschenbach
- Aschenbach – Der Künstler
- Aschenbachs Verfall
- Todeskonfigurationen
- Todesboten und Todesbilder
- Tadzio, das Meer und der Tod
- Abschließende Bemerkungen
- Quellen- und Literaturverzeichnis
- Primärtext
- Sekundärliteratur
- Internetquellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die Komposition der Décadencemotivik in Thomas Manns Novelle Der Tod in Venedig (1912) und konzentriert sich auf die prominenten Motive der Décadence im Werk. Diese werden anhand exemplarischer Textauszüge veranschaulicht. Der Fokus liegt auf der Widersprüchlichkeit der Gefühle des Protagonisten und deren Korrespondenz mit Orts- und Naturbeschreibungen, die ebenfalls von mannigfaltiger Décadencemotivik geprägt sind.
- Analyse der Décadencemotivik in Thomas Manns Novelle Der Tod in Venedig
- Untersuchung der Widersprüchlichkeit der Gefühle des Protagonisten
- Bedeutung von Orts- und Naturbeschreibungen für die Darstellung der Décadence
- Analyse der Todeskonfigurationen und deren Rolle im Werk
- Interpretation des Meeres als Symbol des ewigen Lebens und des Todes
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Zielsetzung der Arbeit dar und skizziert die allgemeine Vorgehensweise. Sie beleuchtet die Stimmung um 1900 und die philosophische Verbindung von Leben und Tod, die für die Décadence typisch ist.
Kapitel 2 widmet sich der Dichotomie von Leben und Tod um 1900. Es werden die Endzeiterwartungen und die Décadence als literarische und philosophische Strömungen der Zeit beleuchtet.
Kapitel 3 analysiert die Décadencemotivik in Der Tod in Venedig. Es werden die Ortsschilderungen von München und Venedig sowie die Figur Gustav von Aschenbach und seine Entwicklung untersucht.
Kapitel 3.3 befasst sich mit den Todeskonfigurationen in der Novelle. Es werden Todesboten und Todesbilder analysiert, die auf den Verfall und den nahenden Untergang verweisen.
Kapitel 3.3.2 widmet sich der Schlusssequenz des Werkes, in der die Dichotomie von Leben und Tod aufgegriffen wird und das Meer als Symbol des ewigen Lebens auch zum Ort des Todes wird.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Décadencemotivik, Thomas Mann, Der Tod in Venedig, Gustav von Aschenbach, Venedig, Tod, Leben, Verfall, Untergang, Todesboten, Todesbilder, Meer, Symbolismus, Literaturgeschichte, Jahrhundertwende, Endzeiterwartungen, Lebensphilosophie.
- Quote paper
- Janine Lacombe (Author), 2014, Decadencemotivik in Thomas Manns Werk "Der Tod in Venedig", Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/278798