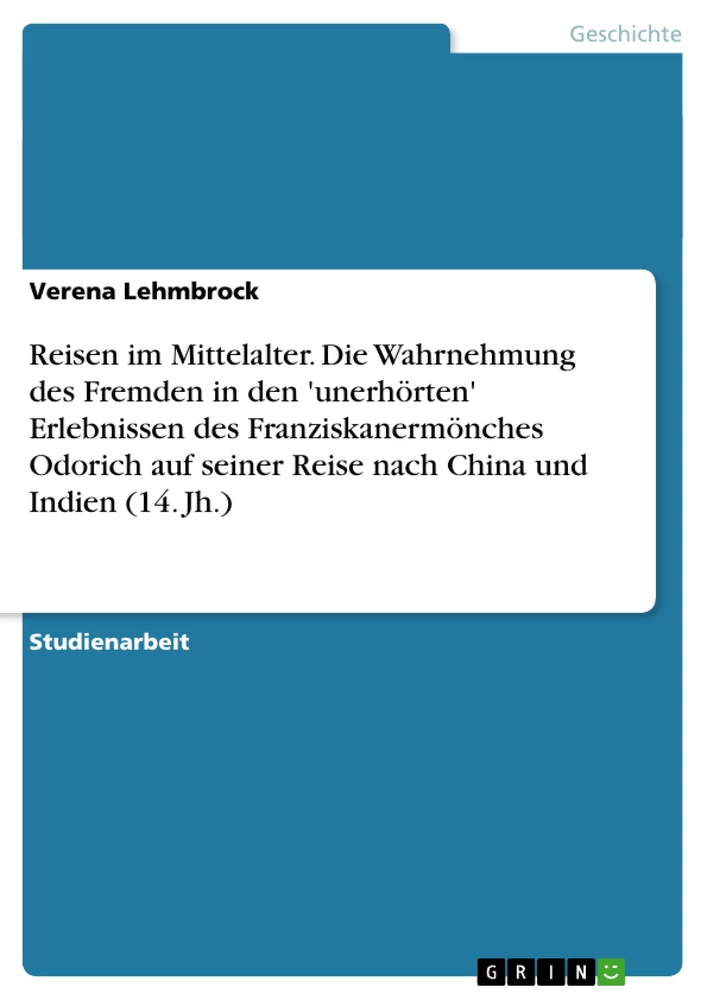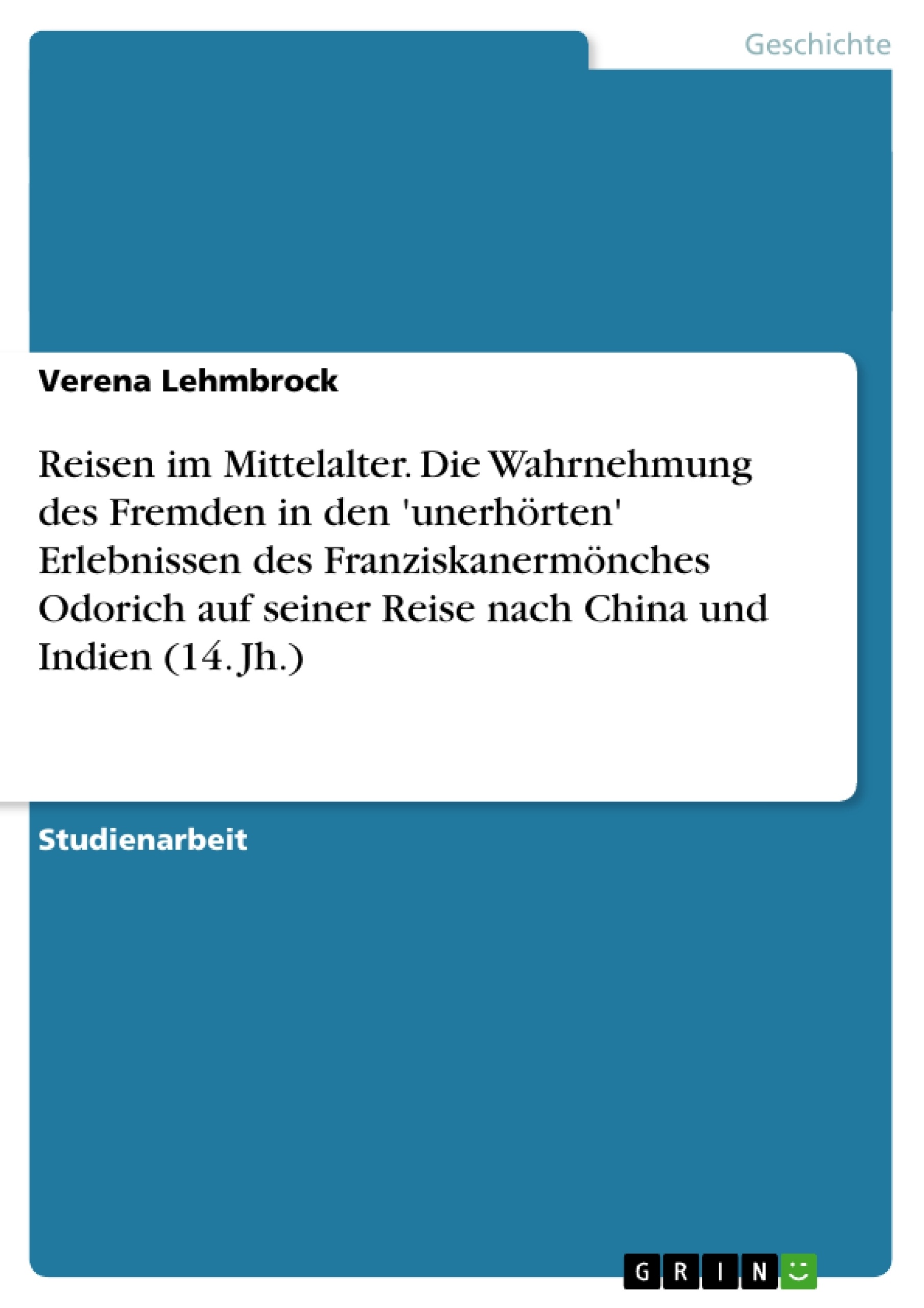Heutzutage siedeln wir phantastische Wesen und unheimliche Kreaturen - sei
es in schriftlicher oder bildlicher Form - auf anderen Planeten in fernen Galaxien an.
Im mittelalterlichen Abendland dagegen gab es noch reichlich unentdecktes Land auf
dem eigenen Planeten, so dass man ‘Unerhörtes’ dort ansiedeln konnte. Im
ethnozentristisch-religiösen Weltbild, in dem die bekannten Erdteile zentral um
Jerusalem angeordnet lagen, befand sich der ferne Osten am geheimnisvollen Rand
dieser Welt. Neben politischer und religiöser Motivation gab ebenso die curiositas1,
die Reiselust, Anlass zum Aufbruch in den Orient, zur Entdeckung der Wunder
Gottes.2 Die Reiseberichte dieser Zeit befinden sich fast durchgängig im
Spannungsfeld zwischen Realität und Mythos.3 Das mag einerseits in der damaligen
Denkweise, einer Mischform aus wissenschaftlichem und mythisch-religiösem
Denken begründet liegen. Für uns und unsere wissenschaftlich orientierte Sichtweise
(als wahr gelten die Aussagen, die verifizierbar sind) ist sie nicht mehr
nachzuvollziehen. Auf der anderen Seite erwarteten die damaligen Zeitgenossen
nicht nur die reine Information über Unbekanntes, sondern gerade der
Unterhaltungswert der Erfahrungsberichte machte ihre Beliebtheit aus.4
Kommerzielle Interessen, das Renommierbedürfnis der Autoren und nicht zuletzt die
Schwierigkeit, für Unbeschreibliches Worte zu finden, formten den Stil des
Reiseberichtes und trugen ihm zudem den Ruf der Lügengeschichte ein.5 [...] 1 Der Begriff ‘curiositas’ war im Mittelalter verbreitet und hatte in verschiedenen Beziehungen vielerlei Bedeutungen; er konnte sowohl Sorgfalt und Mühe als auch Wissbegierde und Neugierde bezeichnen. 2 Karl Zaenker, Wirklichkeit und Fiktion in der spätmittelalterlichen Reiseliteratur, in: Deutsche Jakobspilger und ihre Berichte, hg. von Klaus Herbers, Tübingen 1988, S.125 (weiterhin zitiert: Zaenker-Reiseliteratur) 3 Peter Wunderli (Hg.), Reisen in reale und mythische Ferne. Reiseliteratur in Mittelalter und Renaissance, Düsseldorf 1993, S.1/2 4 Zaenker-Reiseliteratur, S.123/124 5 Peter J. Brenner, Die Erfahrung der Fremde. Zur Entwicklung einer Wahrnehmungsform in der Geschichte des Reiseberichts, in: Der Reisebericht. Die Entwicklung einer Gattung in der deutschen Literatur, hg. von Peter J. Brenner, Frankfurt a.M. 1989, S.14 (weiterhin zitiert: Brenner-Reisebericht)
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung - Der Reisebericht als mentalitätsgeschichtliche Quelle
- Drei Vorbemerkungen
- China und Europa im Mittelalter
- Philosophische Anthropologie
- Das christliche Weltbild im Mittelalter
- Odorichs Beschreibungen des Fremden
- Der distanzierte Blick
- Die Gegenüberstellung
- Das Fremde als Bereicherung
- Unverständnis und Ablehnung
- Anerkennung?
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert den Reisebericht des Franziskanermönchs Odorich aus dem 14. Jahrhundert und untersucht, wie der Autor das Fremde im Kontext seiner Reise nach Indien und China wahrnahm. Ziel ist es, die Mentalität des Reisenden und seine Sichtweise auf die fremden Kulturen zu ergründen, indem die verschiedenen Wahrnehmungsmuster im Reisebericht analysiert werden.
- Der Reisebericht als Quelle für die Mentalitätsgeschichte des Mittelalters
- Die Wahrnehmung des Fremden im Kontext des christlichen Weltbildes
- Die Bedeutung von Kulturvergleich und Distanzierung
- Die Rolle von Mythen und Legenden in Reiseberichten
- Die Grenzen zwischen Realität und Fantasie in der mittelalterlichen Reiseliteratur
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung - Der Reisebericht als mentalitätsgeschichtliche Quelle
Die Einleitung beleuchtet die Bedeutung von Reiseberichten als Quelle für die Mentalitätsgeschichte des Mittelalters. Der Reisebericht als Genre stand im Spannungsfeld zwischen Realität und Mythos und diente nicht nur der Information, sondern auch der Unterhaltung.
Drei Vorbemerkungen
Dieser Abschnitt setzt den historischen und kulturellen Rahmen für Odorichs Reise. Er betrachtet die Situation Chinas und Europas im Mittelalter, die anthropologische Perspektive auf die Wahrnehmung des Fremden und das christliche Weltbild der Zeit.
Odorichs Beschreibungen des Fremden
Dieses Kapitel analysiert Odorichs Beschreibungen von Indien und China, indem es die verschiedenen Facetten seiner Wahrnehmung beleuchtet: den distanzierten Blick, die Gegenüberstellung von Eigenem und Fremdem, die potentielle Bereicherung durch das Fremde sowie Unverständnis und Ablehnung.
Schluss
(Die Zusammenfassung des Schlusskapitels wird aus Gründen der Spoilervermeidung nicht einbezogen.)
Schlüsselwörter
Reisebericht, Mittelalter, Odorich, Indien, China, Fremde, Wahrnehmung, Mentalität, Kulturvergleich, Christentum, Mythos, Realität, Curiositas, Ethnozentrismus, Reisebeschreibung, anthropologische Konstante, Begriffe, Vergleich, Konventionen, Marco Polo, Mongolenreich, Kublai Khan, Cambaluc, Buddhismus, Taoismus, Lamaismus, Fu-lang, Islamische Herrschaft, Sultanat von Delhi, Mirabilien, Bestiarien, Giovanni da Pian del Carpini, Wilhelm von Rubruk, Dschingis Khan, Papst Innozenz IV, Großkhan Möngke.
- Quote paper
- Verena Lehmbrock (Author), 2001, Reisen im Mittelalter. Die Wahrnehmung des Fremden in den 'unerhörten' Erlebnissen des Franziskanermönches Odorich auf seiner Reise nach China und Indien (14. Jh.), Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/27793