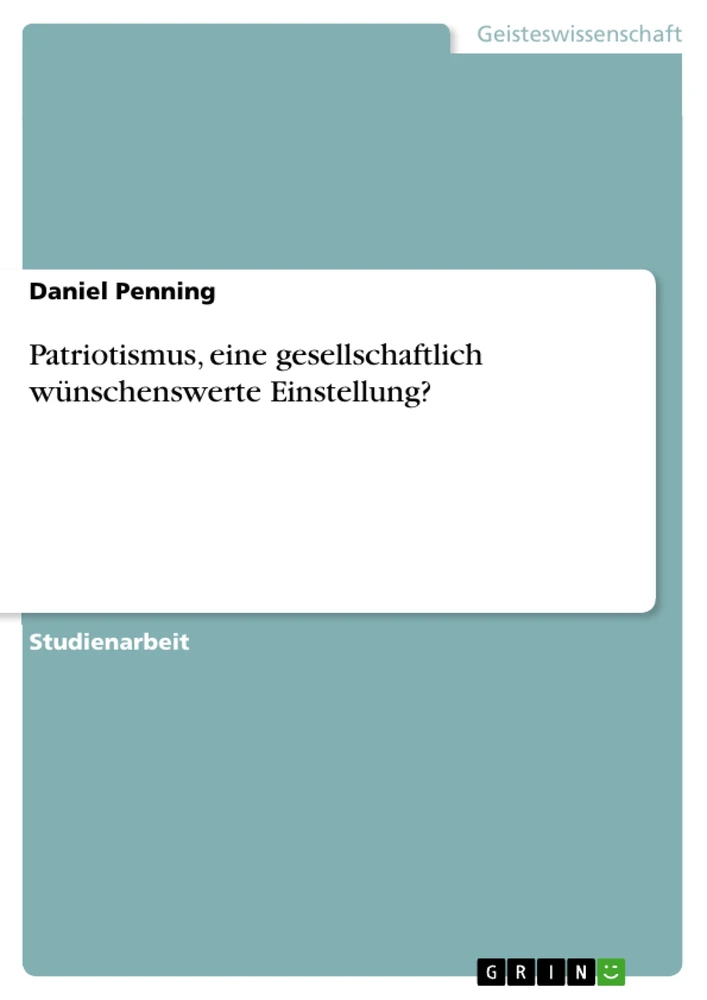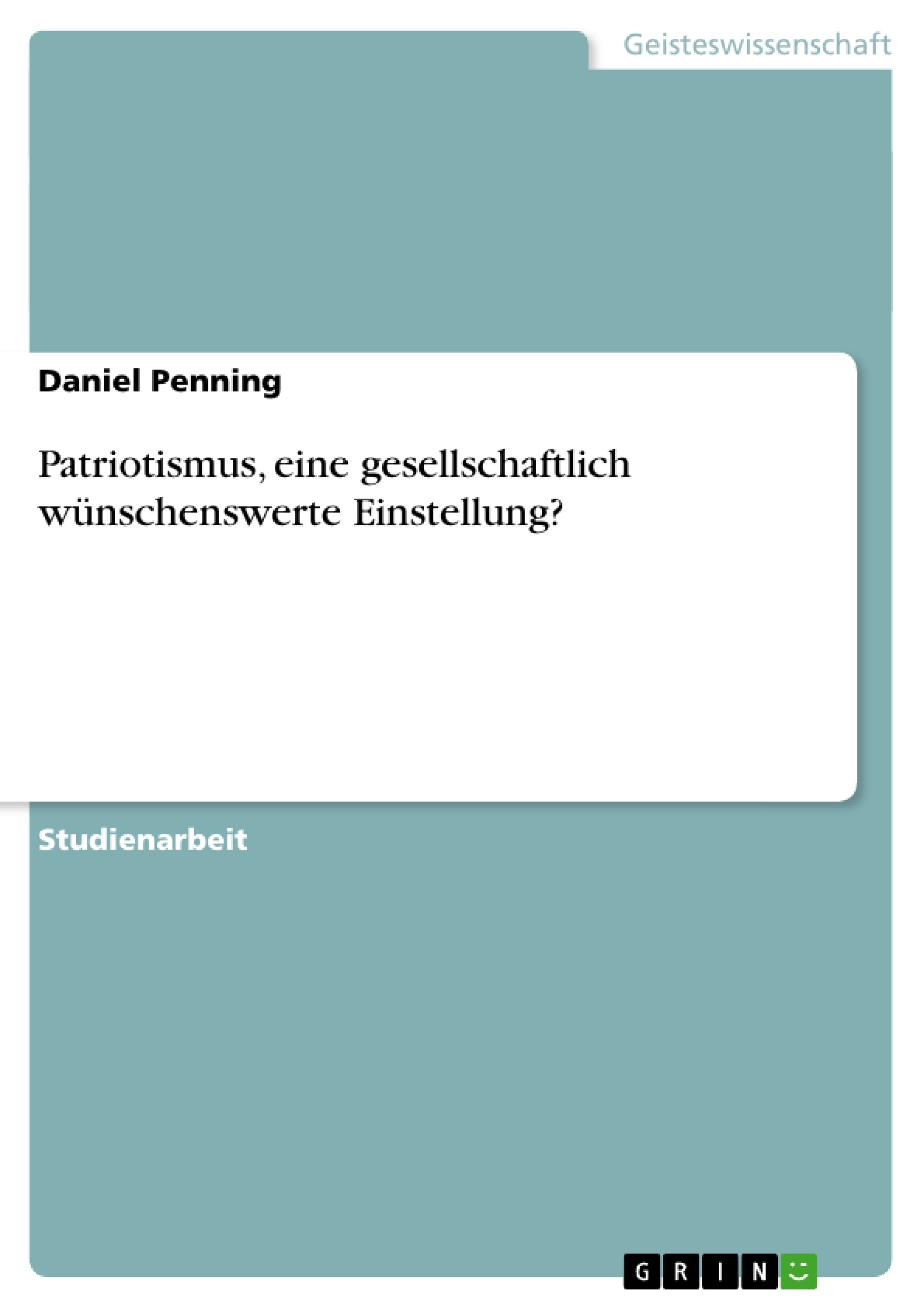„Vielleicht wächst ja ein Stolz auf dieses Land, der nicht überheblich ist, nicht abgrenzend und fremdenfeindlich – ein positiver Patriotismus.“ (Charlotte Knobloch 2006)
Diesen Wunsch äußerte die damalige Vorsitzende des deutschen Zentralrats der Juden 2006 in einem Interview vor dem Hintergrund der Fußballweltmeisterschaft in Deutschland. Jenes Ereignis stellte zu gegenwärtigem Zeitpunkt den Gipfel eines öffentlichen Diskurses um das Bekenntnis der Deutschen zu ihrer Nation dar, der sich bereits 2005 mit der medienwirksamen Kampagne Du bist Deutschland einleitete und mit einer ganzen Reihe von Zeitungsartikeln, Büchern und Diskussionen flankiert wurde, deren Grundtenor in der überwiegenden Mehrzahl eindeutig war: „Was wir in Deutschland erleben, ist ein Stück Normalisierung. Wir gehen entkrampfter und weniger neurotisch mit nationalen Symbolen und Patriotismus um.“ (Krönig 2006). Der Begriff des Patriotismus erfuhr im Zuge der Debatte einen inflationären Gebrauch, ohne gleichzeitig einer genaueren Reflexion unterzogen zu werden; als sei dessen Bedeutung ohnehin klar. Dies gestaltet sich aus der Warte einer sozialwissenschaftlichen Betrachtung jedoch gänzlich anders, wie sich im Verlauf der Ausführungen noch zeigen wird.
Im Zentrum steht dabei die Frage, ob die optimistische Vorstellung Knoblochs eines positiven Patriotismus, der nicht gleichsam mit Abgrenzungs- und Abwertungsprozessen gegenüber Minderheiten in Deutschland einhergeht, tatsächlich möglich erscheint. Vor dem Hintergrund der deutschen Erfahrungen des Holocaust wurde Patriotismus hierzulande gleichsam von vielen Personen immer auch kritisch betrachtet mit der Sorge, derartige Bekenntnisse könnten schnell wieder in nationalistische Einstellungen münden. So soll auch das Verhältnis von Patriotismus zu Nationalismus Gegenstand dieser Arbeit sein.
Hierzu wird der Begriff des Patriotismus zunächst einmal hinsichtlich seiner Semantik näher beleuchtet werden: In welchen Formen drückt er sich aus und inwieweit unterscheidet er sich von nationalistischen Haltungen? Anschließend folgt eine Betrachtung der historischen Genese jenes Begriffs in ihren wesentlichen Zügen; im zweiten Teil davon bezogen auf die Entwicklungen in Deutschland. Damit soll Aufschluss über seine Wurzeln sowie über den Bedeutungswandel zu verschiedenen Zeiten gegeben werden. In Teil vier erfolgt dann die Hinwendung zur sozial-empirischen Sichtweise auf Patriotismus.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die semantische Verortung von Patriotismus
- Die historische Dimension von Patriotismus
- Die geschichtlichen Wurzeln des Patriotismus
- Patriotismus in Deutschland
- Empirische Untersuchungen zu Patriotismus
- Übersicht verschiedener Studien und Konzepte
- Deutsche Zustände: Patriotismus und Nationalismus
- Probleme der validen empirischen Messung
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit der Frage, ob Patriotismus eine gesellschaftlich wünschenswerte Einstellung ist. Der Fokus liegt dabei auf der Analyse der Semantik des Begriffs, seiner historischen Entwicklung, empirischen Studien und seinem Verhältnis zu Nationalismus.
- Die semantische Ambivalenz von Patriotismus und seine Abgrenzung zum Nationalismus
- Die historische Genese von Patriotismus und seine Bedeutungswandel
- Die Relevanz empirischer Untersuchungen zur Messung und Interpretation von Patriotismus
- Die Herausforderung, einen positiven Patriotismus zu definieren, der nicht mit nationalistischen Einstellungen einhergeht
- Die Bedeutung des Verhältnisses zwischen Patriotismus und Nationalismus im Kontext der deutschen Geschichte
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
Die Einleitung führt in die Thematik des Patriotismus ein und stellt die zentrale Frage der Arbeit: Ist Patriotismus eine wünschenswerte gesellschaftliche Einstellung? Sie zeigt die Aktualität des Themas auf, indem sie auf die öffentliche Debatte um Patriotismus in Deutschland in den Jahren 2005 und 2006 verweist.
2. Die semantische Verortung von Patriotismus
Dieses Kapitel analysiert den Begriff des Patriotismus und seine verschiedenen Bedeutungen. Es werden unterschiedliche Ansichten über Patriotismus vorgestellt, von Kritikern, die ihn als chauvinistisch und nationalistisch bewerten, bis hin zu Befürwortern, die seine positiven Eigenschaften hervorheben. Der Beitrag von Dolf Sternberger und Jürgen Habermas zum „Verfassungspatriotismus“ wird erläutert. Die Abgrenzung zu nationalistischen Einstellungen wird durch die Frage nach der Beziehung zwischen Patriotismus, Nationalismus und Nation beleuchtet.
3. Die historische Dimension von Patriotismus
Dieses Kapitel befasst sich mit der historischen Entwicklung des Patriotismus. Es untersucht die geschichtlichen Wurzeln des Begriffs und seinen Wandel im Laufe der Zeit. Der Fokus liegt dabei insbesondere auf der Entwicklung in Deutschland und der Rolle des Patriotismus im Kontext der deutschen Geschichte.
- Quote paper
- Daniel Penning (Author), 2013, Patriotismus, eine gesellschaftlich wünschenswerte Einstellung?, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/276669