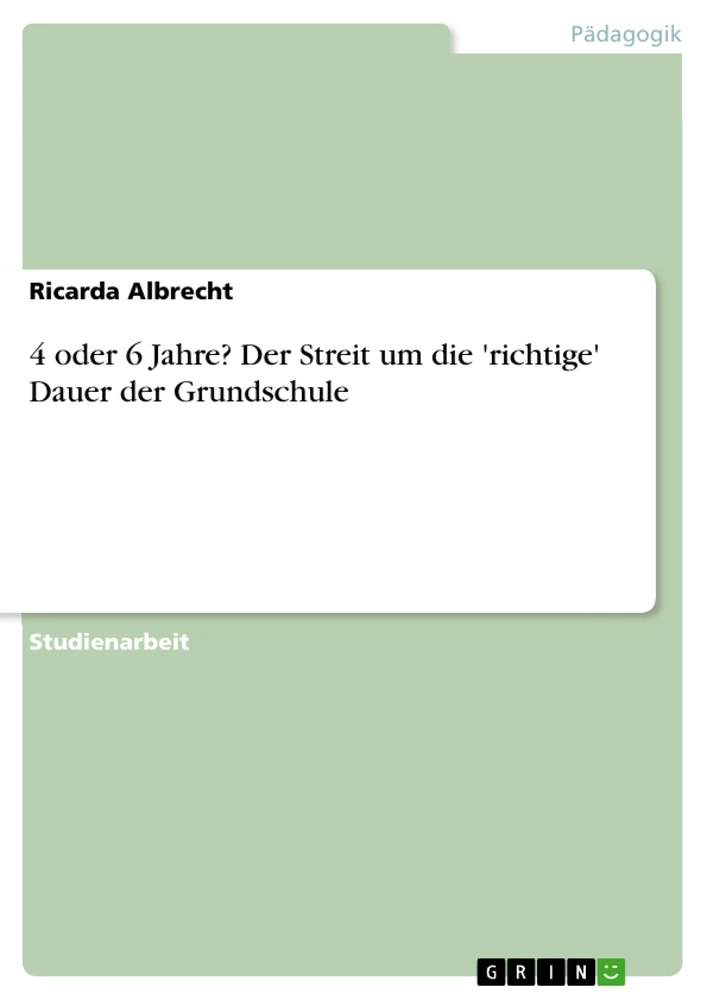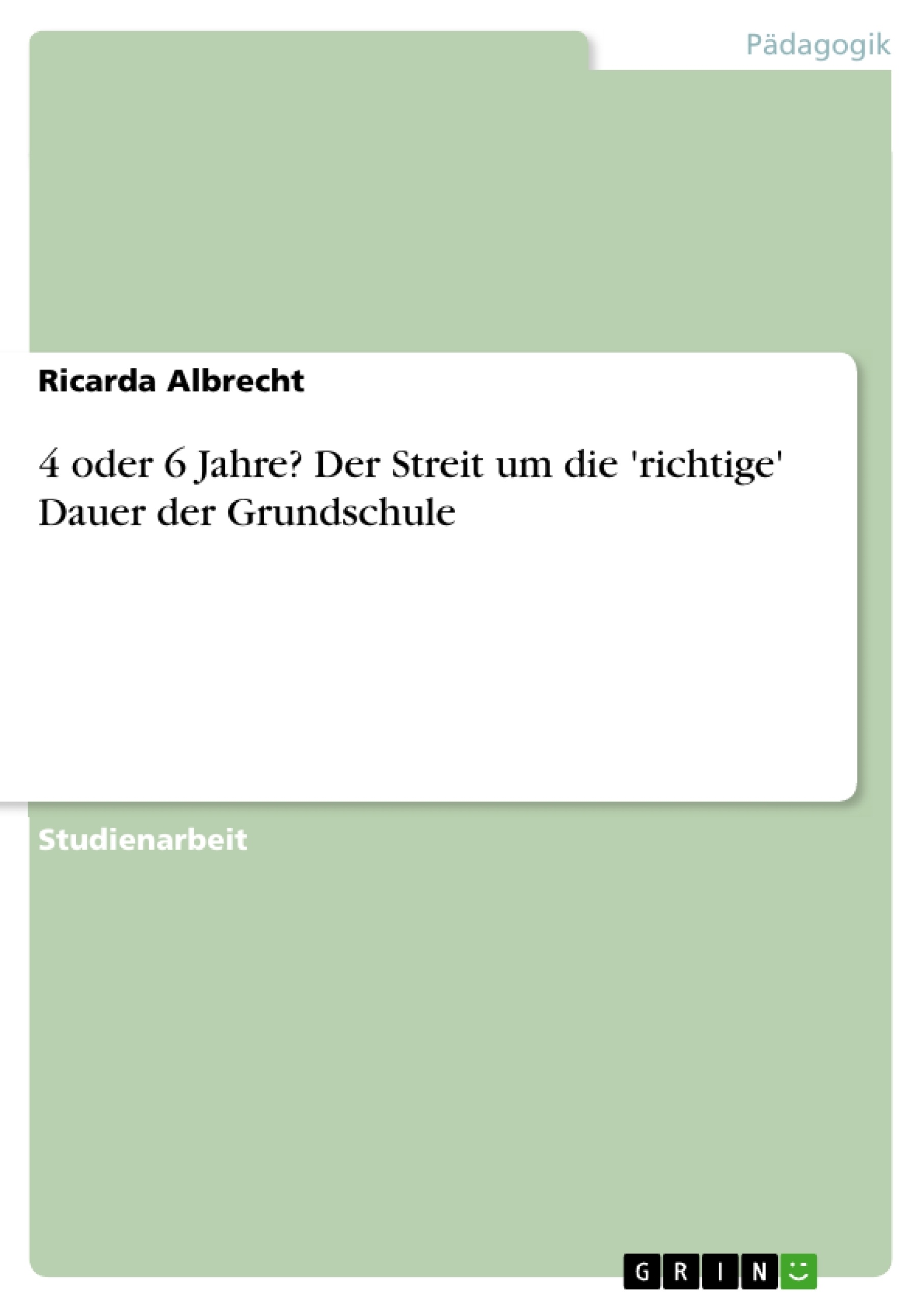Die nur vierjährige Dauer der Grundschule und die sich daran anschließende frühe Verteilung der Schüler auf die verschiedenen Sekundarschulformen wird, als eines der umstrittensten Strukturmerkmale des deutschen Schulwesens, seit Jahren vielfach diskutiert (vgl. Baumert u.a. 2009, S.190). Deutschland liest seine Schüler dabei im internationalen Vergleich sehr früh aus und weist sie stark selektierenden Schulformen zu. Der Übergangszeitpunkt am Ende der vierten Klasse, also mit 10 Jahren, ist in den meisten Bundesländern der Regelfall. Nur in Berlin und Brandenburg vollzieht sich dieser Wechsel zur Sekundarschule nach der sechsten Klasse, also im Alter von 12 Jahren (vgl. Kramer u.a. 2009, S.17ff.). Auch Hamburg versuchte im vergangenen Jahr eine sechsjährige Grundschule und ein daran anschließendes zweigliedriges Schulsystem einzuführen. Allerdings mobilisierte sich eine Initiative unter der Parole „Diese Reform darf keine Schule machen!“ gegen die Einführung der sechsjährigen Primarschule in Hamburg. Am 18.07.2010 wurde per Volksentscheid gegen die neue Grundschuldauer entschieden (vgl. www.sueddeutsche.de, Stand 14.04.2011).
Die Verfechter der vierjährigen Grundschule sind der Ansicht, durch längeres gemeinsames Lernen erhöhe sich der soziale Unterschied zwischen den Kindern eher, als dass er sich ausgleiche und leistungsstarke Schüler würden gebremst, wenn sie nicht frühzeitig auf das Gymnasium wechseln würden. Anhänger der sechsjährigen Grundschule argumentieren, längeres gemeinsames Lernen fördere alle und eine Selektion bereits nach der vierten Klasse wäre zu früh, um Prognosen über die Schullaufbahn und die Entwicklung eines Kindes abzugeben. In der aktuellen Debatte um die „richtige“ Dauer der Grundschule stehen sich somit zwei Seiten mit konträren Ansichten gegenüber. Im Rahmen dieser Arbeit soll anhand verschiedener Ergebnisse aus der Forschung der Frage nachgegangen werden, ob die Schüler in der vierjährigen oder sechsjährigen Grundschule eher gebremst werden, oder sich Fördereffekte zeigen, also ob sich für die Argumente der beiden Seiten empirisch abgesicherte Nachweise finden lassen.
Hierfür soll zunächst auf die hohe soziale Selektivität des deutschen Bildungssystems eingegangen werden, durch welche massive Bildungs- und Chancenungleichheiten unter den Schülern entstehen und die einen zentralen Punkt in der Diskussion um den Übergangszeitpunkt darstellt. Anschließend wird das deutsche Schulsystem hinsichtlich seines Aufbaus und der Leist
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die soziale Selektivität des deutschen Bildungssystems
- 3. Internationaler Vergleich
- 4. Subjektive Einschätzungen zur Dauer der Grundschule
- 5. Die Element-Studie
- 5.1 Voraussetzungen in Berlin
- 5.2 Ergebnisse der ELEMENT-Studie
- 5.3 Ergebnisse der Reanalyse der Daten
- 5.4 Vergleich der Schüler grundständiger Gymnasien
- 6. Zusammenfassung und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Debatte um die optimale Dauer der Grundschule in Deutschland – vier oder sechs Jahre. Ziel ist es, anhand von Forschungsergebnissen zu belegen, ob eine vier- oder sechsjährige Grundschulzeit für die Schüler förderlicher ist und ob sich die Argumente beider Seiten empirisch stützen lassen. Die soziale Selektivität des deutschen Bildungssystems und internationale Vergleiche spielen dabei eine zentrale Rolle.
- Soziale Selektivität im deutschen Bildungssystem
- Internationaler Vergleich von Grundschulsystemen
- Subjektive Einschätzungen zur Grundschulzeit (Schüler, Eltern, Lehrer)
- Empirische Befunde der ELEMENT-Studie
- Vor- und Nachteile einer vierjährigen im Vergleich zu einer sechsjährigen Grundschulzeit
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die kontroverse Diskussion um die Dauer der Grundschule in Deutschland ein. Sie hebt die unterschiedlichen Positionen der Befürworter einer vierjährigen und einer sechsjährigen Grundschule hervor und benennt die zentrale Forschungsfrage der Arbeit: Werden Schüler in einer vierjährigen oder sechsjährigen Grundschule eher gebremst oder zeigen sich Fördereffekte? Die Arbeit kündigt den methodischen Ansatz an, der die soziale Selektivität des deutschen Bildungssystems, internationale Vergleiche und die Ergebnisse empirischer Studien umfasst.
2. Die soziale Selektivität des deutschen Bildungssystems: Dieses Kapitel beleuchtet die institutionelle Ausdifferenzierung des deutschen Bildungssystems und die daraus resultierenden individuellen Bildungsprofile, Abschlüsse und Karrierepfade. Es betont den hohen Stellenwert des Übergangs von der Grundschule zur Sekundarschule und die damit verbundene frühe Statusvorentscheidung. Die Kritik an der frühen Selektion nach der vierten Klasse als Ursache für soziale Ungleichheiten wird dargelegt. Das Kapitel beschreibt drei Stufen der sozialen Auslese: soziale Auslese nach Sozialgruppen, Lehrerurteil und Elternentscheidung, die zu massiven Bildungsungleichheiten führen. Die Benachteiligung von Kindern aus bildungsfernen Familien wird detailliert beschrieben, wobei der Einfluss mangelnder Förderung und ungleicher Anforderungen bei der Gymnasialempfehlung hervorgehoben wird. Die frühe Auslese wird als zentrales bildungspolitisches Streitthema präsentiert.
Häufig gestellte Fragen zur Arbeit: "Dauer der Grundschule in Deutschland"
Was ist das zentrale Thema der Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Debatte um die optimale Dauer der Grundschule in Deutschland – vier oder sechs Jahre. Das Hauptziel ist es, anhand von Forschungsergebnissen zu belegen, ob eine vier- oder sechsjährige Grundschulzeit für Schüler förderlicher ist und ob sich die Argumente beider Seiten empirisch stützen lassen.
Welche Aspekte werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die soziale Selektivität des deutschen Bildungssystems, internationale Vergleiche von Grundschulsystemen, subjektive Einschätzungen zur Grundschulzeit (von Schülern, Eltern und Lehrern) und die empirischen Befunde der ELEMENT-Studie. Sie analysiert Vor- und Nachteile einer vierjährigen im Vergleich zu einer sechsjährigen Grundschulzeit.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in sechs Kapitel gegliedert: Einleitung, Soziale Selektivität des deutschen Bildungssystems, Internationaler Vergleich, Subjektive Einschätzungen zur Dauer der Grundschule, Die Element-Studie (mit Unterkapiteln zu Voraussetzungen in Berlin, Ergebnissen der Studie, Reanalyse der Daten und Vergleich von Schülern grundständiger Gymnasien) und Zusammenfassung und Fazit.
Welche Rolle spielt die soziale Selektivität im deutschen Bildungssystem?
Die soziale Selektivität des deutschen Bildungssystems spielt eine zentrale Rolle. Die Arbeit beleuchtet die institutionelle Ausdifferenzierung des Systems und die daraus resultierenden individuellen Bildungsprofile, Abschlüsse und Karrierepfade. Sie kritisiert die frühe Selektion nach der vierten Klasse als Ursache für soziale Ungleichheiten und beschreibt die Benachteiligung von Kindern aus bildungsfernen Familien.
Welche Bedeutung haben internationale Vergleiche?
Internationale Vergleiche von Grundschulsystemen liefern wichtige Vergleichsdaten und helfen, die Vor- und Nachteile verschiedener Systeme zu beurteilen. Diese Vergleiche tragen dazu bei, die Ergebnisse der deutschen Studie einzuordnen und ein umfassenderes Bild der Situation zu zeichnen.
Welche Rolle spielt die ELEMENT-Studie?
Die ELEMENT-Studie ist ein zentraler Bestandteil der Arbeit. Die Arbeit analysiert die Ergebnisse der Studie, führt eine Reanalyse der Daten durch und vergleicht die Ergebnisse von Schülern grundständiger Gymnasien. Diese Analyse liefert wichtige empirische Befunde zur Fragestellung der optimalen Grundschulzeit.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Zusammenfassung und das Fazit der Arbeit fassen die zentralen Ergebnisse zusammen und geben eine abschließende Bewertung der Befunde. Es wird eine Antwort auf die Forschungsfrage nach der förderlicheren Grundschulzeit (vier oder sechs Jahre) gegeben, basierend auf den empirischen Daten und den analysierten Aspekten.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Schlüsselbegriffe sind unter anderem: Soziale Selektivität, Bildungssystem, Grundschulzeit, vierjährige Grundschule, sechsjährige Grundschule, ELEMENT-Studie, internationaler Vergleich, soziale Ungleichheit, Bildungsungleichheit, frühe Selektion.
- Arbeit zitieren
- Bachelor of Arts Erziehungswissenschaft/Soziologie Ricarda Albrecht (Autor:in), 2010, 4 oder 6 Jahre? Der Streit um die 'richtige' Dauer der Grundschule, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/275787