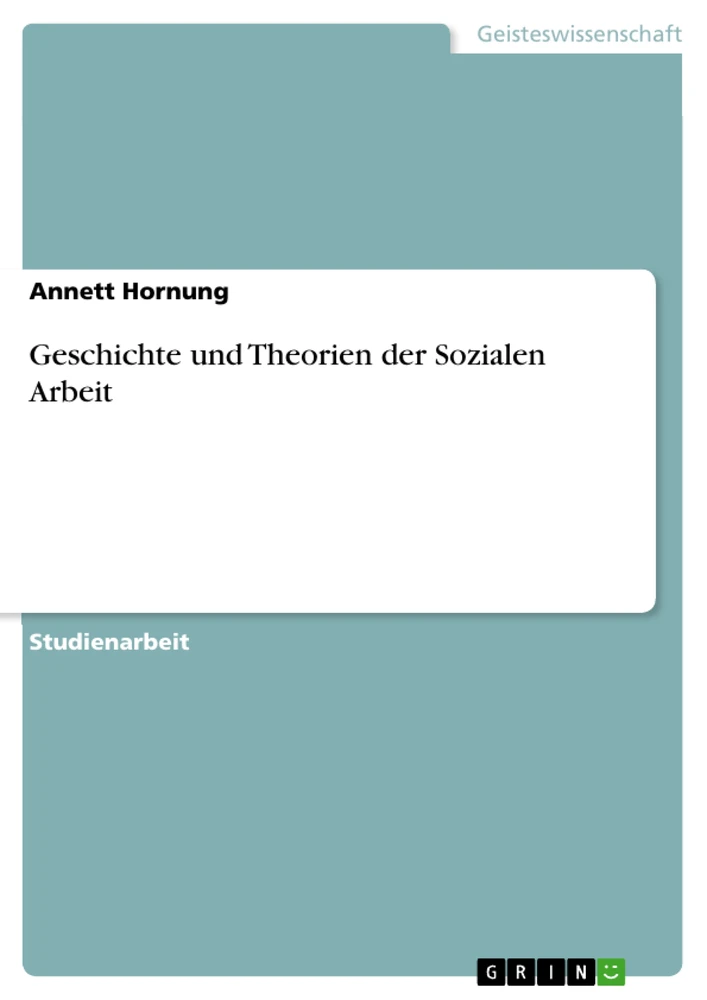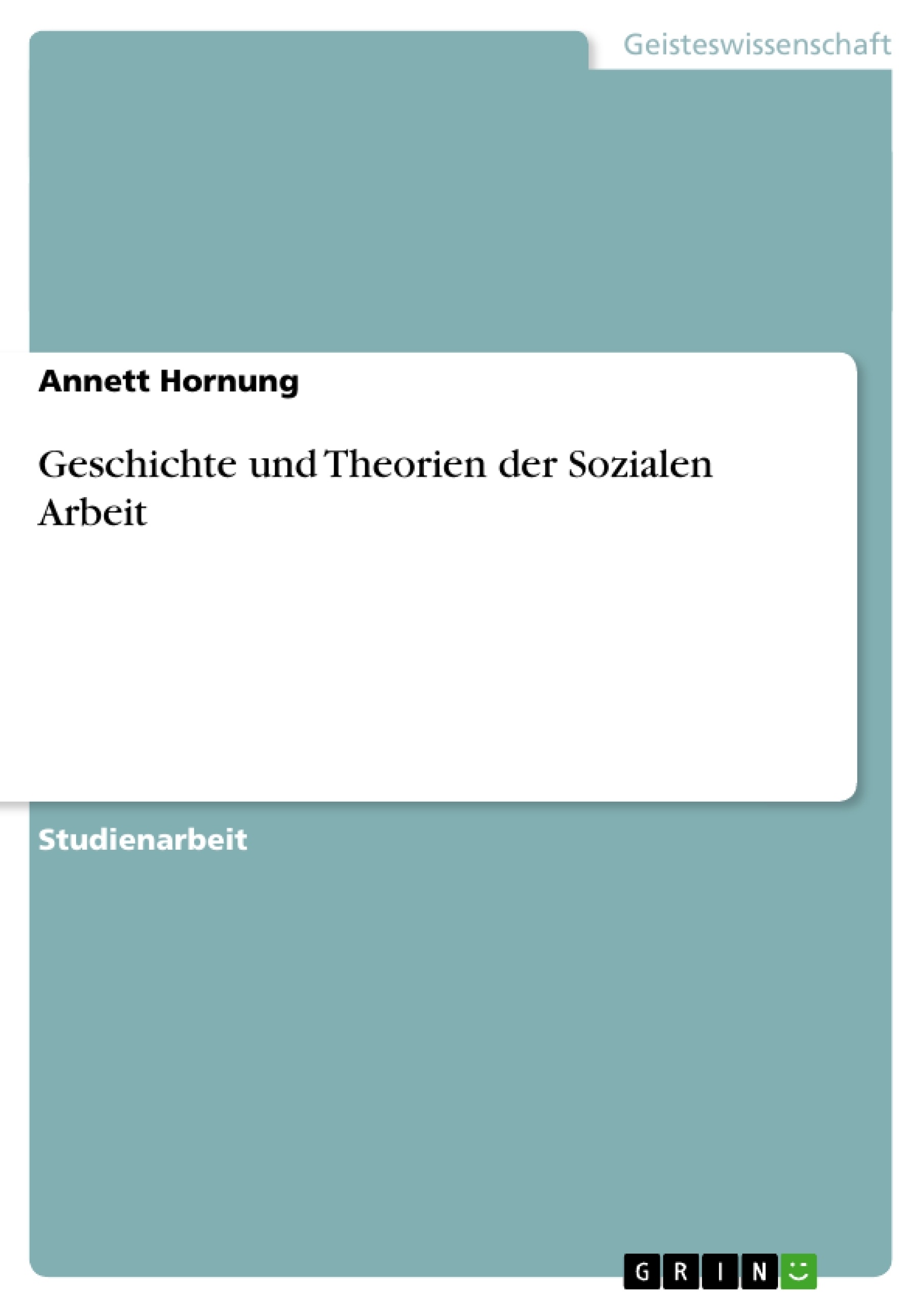„Napoleon ist an allem schuld.“ Dieser Titel eines Stücks von Curt Goetz scheint übertragbar auf die Ursachen der Not im ehemaligen ‚Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation‘, das am 6. August 1806 mit dem Rücktritt Kaiser Josephs II. erlosch. Nach der Französischen Revolution 1789 führte die Expansion Frankreichs durch Napoleon zu zahlreichen Kriegen in Europa. Verwüstung, Tod junger arbeitsfähiger Männer, Vernichtung von Ernten, Plünderungen und auch der Verlust gewachsener Infrastrukturen und Nachrichtenwege folgten. Fortbewegungsmittel wurden beschlagnahmt, die ländliche Bevölkerung auf der Suche nach Arbeit und Nahrung immobilisiert. Aufhebung von Heiratsbeschränkungen vielerorts führte zu einer Bevölkerungszunahme. Dazu kamen Landabgaben im Gegenzug zu Befreiung von Frondienst und Obereigentum. Landflucht ab ca. 1820 und Auswanderung exportierten die Not, es bildeten sich Ballungszentren wie im Ruhrgebiet, Berlin und Südwestdeutschland. Ganze Familien mussten unter schlechtesten Bedingungen in den neuen Industrien arbeiten – was ihnen im Laufe des ‚Vormärz‘ ab 1830 und durch die revolutionären Theorien von Karl Marx bewusst gemacht wurde. Der größte Teil der Bevölkerung besaß keinerlei Absicherung gegen Alter, Krankheit oder Tod des Familienernährers. Die ländliche Armut war 1871 für zwei Drittel der Reichseinwohner noch Normalität, aber auch in der Stadt zogen Hunger, Kälte, Raumnot und schlechte Hygienebedingungen Krankheit, Tod und hohe Kindersterblichkeit nach sich.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Grundlagen und Ansätze Sozialer Arbeit 1789-1890
- 1.1. Ursachen für Verarmung und soziale Probleme
- 1.2. Welches Ziel verfolgte Soziale Arbeit in dieser Zeit?
- 1.3. Religiöse und politische Ideen bzgl. Sozialer Arbeit im 19. Jh.
- 1.4. Methodeneinsatz im Bereich der Sozialen Arbeit
- 1.5. Vom Verwalter zum Helfer, Erzieher und Beobachter
- 1.6. Fazit
- 2. Lebensweltorientierte Soziale Arbeit
- 2.1. Leitdiskussion, Grundannahmen und Ideen
- 2.2. Basissätze und Prinzipien
- 2.3. Berufsbezogenheit des Konzeptes und der Theorieansätze
- 3. Der Fall Puvogel und die Methodenwechsel der Sozialen Arbeit
- 3.1. Weitere Wandlungen des Falles Puvogel bis zum Jahr 2015
- 3.2. Gründe für Umetikettierung und Methodenwechsel Sozialer Arbeit
- 3.3. Weiterentwicklung Sozialer Arbeit im historischen Kontext
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Text befasst sich mit der Geschichte und den Theorien der Sozialen Arbeit. Er untersucht die Entstehung und Entwicklung der Sozialen Arbeit im Kontext gesellschaftlicher Veränderungen und politischer Entwicklungen. Dabei werden die Herausforderungen, die sich aus der Verarmung und den sozialen Problemen im 19. Jahrhundert ergaben, beleuchtet und die Entstehung der „sozialen Frage“ analysiert. Der Text beschäftigt sich zudem mit der Lebensweltorientierung als einem modernen Ansatz der Sozialen Arbeit und dessen Entwicklung im Diskurs mit der „Tübinger Schule“.
- Die Entstehung und Entwicklung der Sozialen Arbeit
- Die „soziale Frage“ und ihre Ursachen im 19. Jahrhundert
- Religiöse und politische Einflüsse auf die Soziale Arbeit
- Methoden und Konzepte der Sozialen Arbeit in verschiedenen historischen Epochen
- Die Lebensweltorientierung als ein moderner Ansatz der Sozialen Arbeit
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 beleuchtet die Ursachen für Verarmung und soziale Probleme im 19. Jahrhundert, die durch die Französische Revolution und die napoleonischen Kriege entstanden. Es wird die Entwicklung der Sozialen Arbeit in dieser Zeit beschrieben, die sich von der traditionellen Armenpflege hin zu einem gesellschaftsbezogenen Handeln wandelte.
Kapitel 2 widmet sich der Lebensweltorientierung als einem modernen Ansatz der Sozialen Arbeit. Es werden die Leitdiskussionen, Grundannahmen und Ideen des Konzeptes erläutert, sowie die Bedeutung der „Tübinger Schule“ für die Entwicklung der Lebensweltorientierung.
Kapitel 3 beschreibt den Fall Puvogel und die Methodenwechsel der Sozialen Arbeit im historischen Kontext. Es wird die Entwicklung des Falles bis zum Jahr 2015 und die Gründe für die Umetikettierung und Methodenwechsel untersucht.
Schlüsselwörter
Soziale Arbeit, Geschichte, Theorie, Verarmung, soziale Probleme, „soziale Frage“, Lebensweltorientierung, „Tübinger Schule“, Methodenwechsel, Umetikettierung, Fall Puvogel.
- Quote paper
- Annett Hornung (Author), 2011, Geschichte und Theorien der Sozialen Arbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/275499