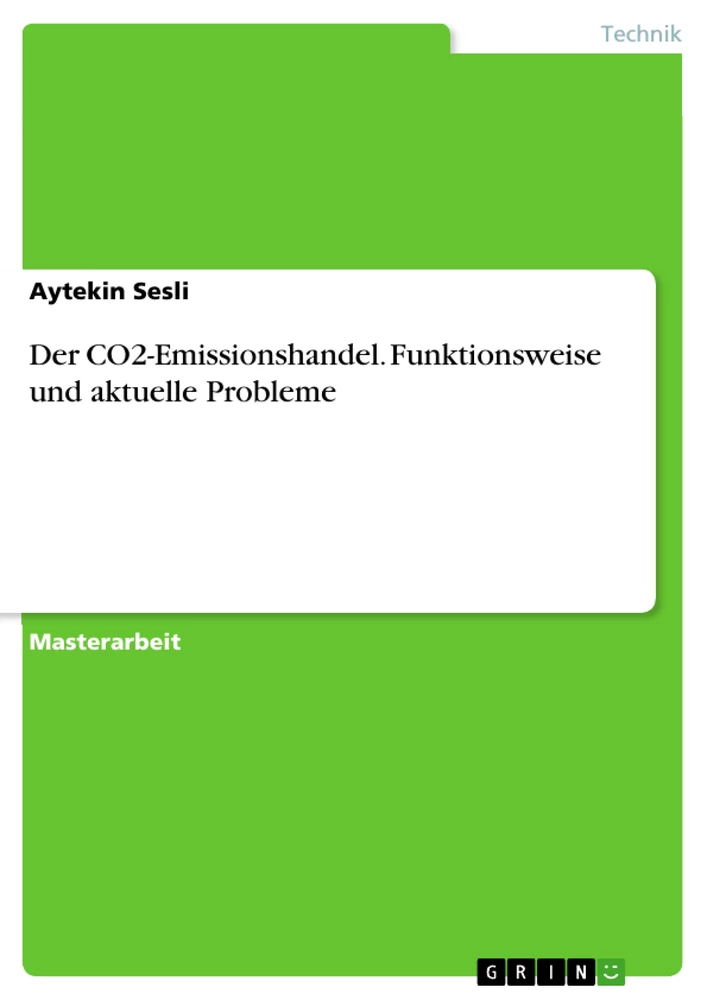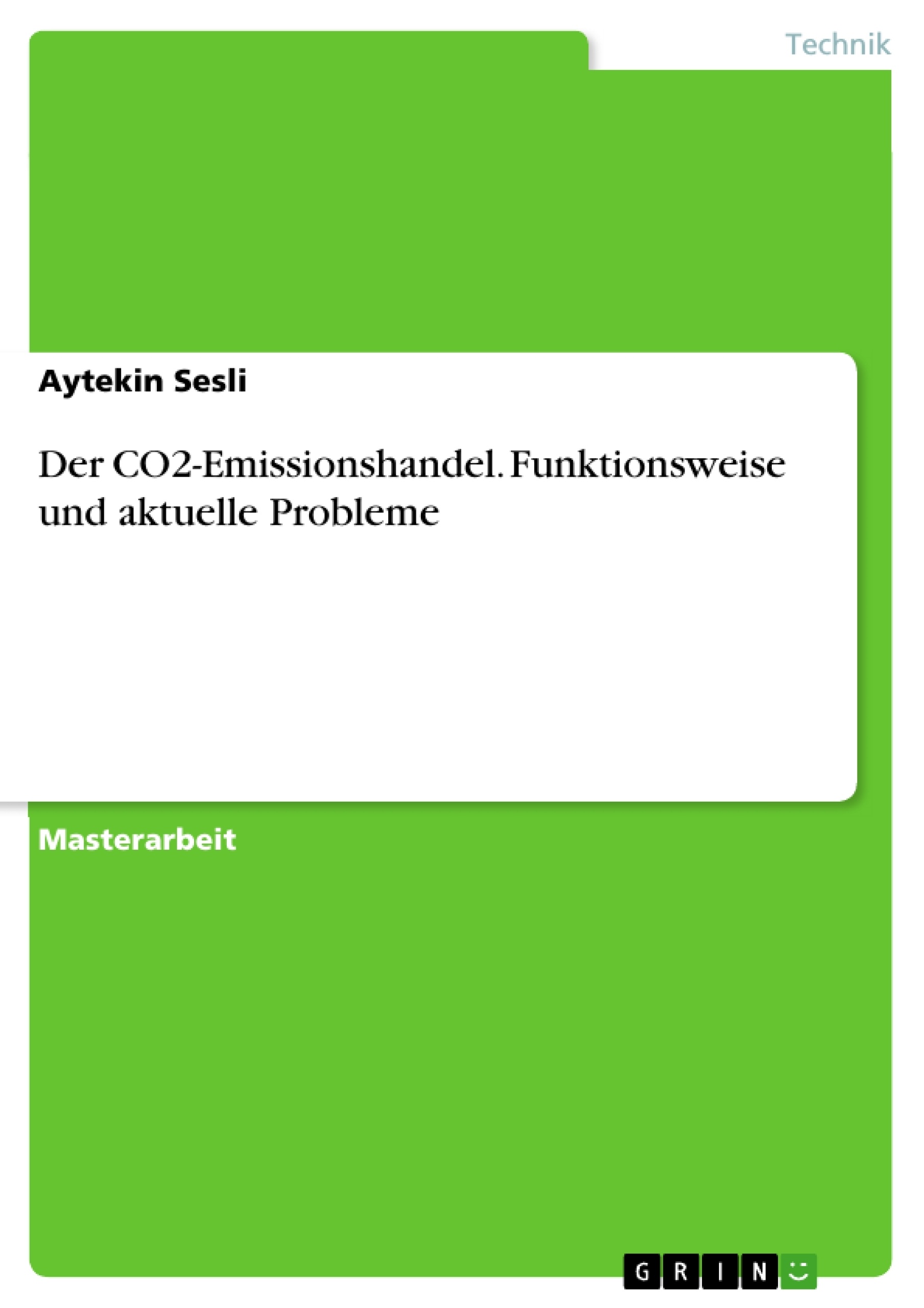Der Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) publizierte im diesjährigen Sachbestandsbericht über den Klimawandel und die dazugehörigen Einflussfaktoren die Ergebnisse seiner fünften Analyse. Sie verweisen auf unterschiedliche Veränderungen der Atmosphäre, die mit hoher Gewissheit durch anthropogene Bestimmungsfaktoren verursacht werden. Seit dem 20. Jahrhundert verschlechtert sich bis zum heutigen Zeitpunkt die Klimasituation. Diese fortschreitende Wandlung führt in der Folge zu einer Erhöhung der Meeresspiegel, Erwärmung der Weltmeere und weiteren divergenten Klimaereignissen. Ausschlaggebend für die Klimaänderung ist der Ausstoß von Treibhausgasen (THG). Vor allem das THG Kohlendioxid (CO2) sorgt in der Atmosphäre für ausgeprägte Schäden. Die CO2-Konzentration erreichte in der Umgebungsluft im Jahre 2013 Höchstwerte und befindet sich in einer Langzeitbetrachtung der letzten 800.000 Jahre auf einem Höhepunkt. Eine unveränderte Schadstoffemission von CO2 würde bis zum Jahr 2050 zu einer Konzentration führen, die eine Überschreitung der weltweiten Temperatur im arithmetischen Mittel von 2 Grad nach sich zieht.
Die weltweite Temperaturerhöhung als Implikation hoher Emissionen wird als Klimaintensität bezeichnet und beschreibt eine nachhaltige Erwärmung bei einer Verdopplung der CO2-Emissionen in der Atmosphäre. Seit Mitte des 18. Jahrhunderts führte der anthropogene Einsatz fossiler Energieträger zu einer Kohlenstoff-Emission von 545 Gigatonnen. 45 % dieser Schadstoffmenge wirken sich negativ auf die Atmosphäre aus. Der restlichen Anteile wurden in der Natur von Meeren und Wäldern absorbiert. Gegenwärtig existiert für das THG CO2 keine weitreichende Absorptionstechnik auf Basis wettbewerbsfähiger Investitionskosten. Kostenwirksame Rückhaltetechniken befinden sich derzeit im Entwicklungsprozess und werden vor dem Jahre 2020 für die Nutzung durch schadstoffintensive Branchen keine Marktreife erlangen.
Für die Zielsetzung einer Stabilisierung der weltweiten Klimaerwärmung ist eine weitgehende THG-Reduktion unumgänglich. Wissenschaftliche Untersuchungen haben ermittelt, welche Klimaintensität auf der Grundlage ehrgeiziger Reduktionsverpflichtungen die Marke von 2 Grad nicht überschreitet. Der Vergleichsmaßstab der Klimaintensität ist der Emissionsausstoß vor Beginn der Industrialisierung. Der fünfte Sachstandsbericht der Vereinten Nationen bezifferte zum ersten Mal einen Schwellenwert der Schädigungsmenge von CO2 für die Umgebung [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Grundlagen zum Emissionshandel
- 2.1 Das Umweltproblem aus ökonomischer Betrachtung
- 2.1.1 Die Umwelt als gesellschaftliche Ressource
- 2.1.2 Definition und Klassifizierung externer Effekte
- 2.2 Darstellung umweltpolitischer Instrumente
- 2.2.1 Charakterisierung von Auflagen, Abgaben und moralischen Appellen
- 2.2.2 Kurze Einführung in den Emissionszertifikatehandel
- 2.3 Kriteriengeleitete Bewertung umweltpolitischer Instrumente
- 2.4 Vergleich der Instrumente
- 2.1 Das Umweltproblem aus ökonomischer Betrachtung
- 3 Funktionsweise des CO2-Emissionshandels
- 3.1 Das Kyoto-Protokoll
- 3.1.1 Kernpunkte und Zielsetzung
- 3.1.2 Kyoto-Instrumente im Überblick
- 3.2 Die Lastenverteilungskonvention in Europa
- 3.3 Das EU-Emissionshandelssystem
- 3.3.1 Allgemeine und rechtliche Grundlagen
- 3.3.2 Zeitlicher Übertrag von Zertifikaten
- 3.4 Beteiligte Akteure im Emissionshandelssystem
- 3.5 Erste Handelsperiode 2005-2007
- 3.6 Zweite Handelsperiode 2008-2012
- 3.1 Das Kyoto-Protokoll
- 4 Aktuelle Probleme des Emissionshandels
- 4.1 Dritte Handelsperiode 2013-2020
- 4.2 Elektronische Informationsübermittlung der DEHSt
- 4.2.1 Funktionsweise des Kommunikationsprozesses
- 4.2.2 Implementierung des Luftverkehrs in den Emissionshandel und die Problematik ausländischer Teilnehmer
- 4.3 Das Trittbrettfahrer-Problem im Emissionshandel
- 4.4 Wirtschaftsökonomische Effekte der CO2-Vollversteigerung
- 4.5 Preisverfall der CO2-Zertifikate
- 4.6 Backloading als Instrument der Preisstabilisierung in der dritten Handelsperiode
- 4.7 Wirtschaftliche Auswirkungen des Emissionshandelssystems
- 5 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht den CO2-Emissionshandel, seine Funktionsweise und aktuelle Herausforderungen. Ziel ist es, ein umfassendes Verständnis des Systems zu vermitteln und bestehende Probleme zu analysieren.
- Ökonomische Betrachtung des Umweltproblems und externer Effekte
- Funktionsweise des EU-Emissionshandelssystems (EU-EHS)
- Analyse der verschiedenen Handelsperioden
- Bewertung aktueller Probleme wie Preisverfall und Trittbrettfahrerverhalten
- Wirtschaftsökonomische Auswirkungen des Emissionshandelssystems
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des CO2-Emissionshandels ein und skizziert den Aufbau der Arbeit. Sie erläutert die Bedeutung des Themas im Kontext des Klimawandels und der Notwendigkeit effektiver umweltpolitischer Instrumente.
2 Grundlagen zum Emissionshandel: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen für das Verständnis des Emissionshandels. Es beleuchtet das Umweltproblem aus ökonomischer Perspektive, definiert externe Effekte und charakterisiert verschiedene umweltpolitische Instrumente, um schließlich den Emissionszertifikatehandel als ein solches Instrument detailliert einzuführen und mit anderen zu vergleichen.
3 Funktionsweise des CO2-Emissionshandels: Dieses Kapitel beschreibt detailliert die Funktionsweise des CO2-Emissionshandels, beginnend mit dem Kyoto-Protokoll und der Lastenverteilung in Europa. Der Schwerpunkt liegt auf dem EU-Emissionshandelssystem, seinen rechtlichen Grundlagen, den beteiligten Akteuren und der Analyse der ersten beiden Handelsperioden. Die Kapitelteile beleuchten die verschiedenen Aspekte des Systems von seiner rechtlichen Grundlage bis zu den Akteuren, die daran beteiligt sind.
4 Aktuelle Probleme des Emissionshandels: Dieses Kapitel analysiert die aktuellen Herausforderungen des Emissionshandels, fokussiert auf die dritte Handelsperiode, die elektronische Informationsübermittlung, das Trittbrettfahrerproblem, die wirtschaftlichen Auswirkungen der CO2-Vollversteigerung, den Preisverfall der Zertifikate und die Maßnahmen zur Preisstabilisierung wie Backloading. Die Kapitelteile untersuchen Probleme wie den Preisverfall der Zertifikate und die damit verbundenen wirtschaftlichen Folgen. Sie erörtern auch die Problematik des Trittbrettfahrerverhaltens und die Bedeutung von effizienten Informations- und Kommunikationsprozessen.
Schlüsselwörter
CO2-Emissionshandel, EU-Emissionshandelssystem, Kyoto-Protokoll, Preisverfall, Trittbrettfahrerproblem, externe Effekte, Umweltpolitik, ökonomische Instrumente, Zertifikatehandel, Klimaschutz.
Häufig gestellte Fragen zur Masterarbeit: CO2-Emissionshandel
Was ist der Gegenstand dieser Masterarbeit?
Die Masterarbeit befasst sich umfassend mit dem CO2-Emissionshandel, analysiert dessen Funktionsweise und beleuchtet aktuelle Herausforderungen und Probleme des Systems.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die ökonomische Betrachtung des Umweltproblems und externer Effekte, die Funktionsweise des EU-Emissionshandelssystems (EU-EHS), die Analyse verschiedener Handelsperioden (2005-2007, 2008-2012, 2013-2020), aktuelle Probleme wie Preisverfall und Trittbrettfahrerverhalten, sowie die wirtschaftlichen Auswirkungen des Emissionshandelssystems.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in fünf Kapitel gegliedert: Kapitel 1 (Einleitung), Kapitel 2 (Grundlagen zum Emissionshandel), Kapitel 3 (Funktionsweise des CO2-Emissionshandels), Kapitel 4 (Aktuelle Probleme des Emissionshandels) und Kapitel 5 (Fazit). Jedes Kapitel ist in Unterkapitel unterteilt, die die einzelnen Themenbereiche detailliert behandeln. Das Inhaltsverzeichnis bietet einen vollständigen Überblick über die Struktur.
Welche theoretischen Grundlagen werden behandelt?
Kapitel 2 legt die theoretischen Grundlagen. Es erläutert das Umweltproblem aus ökonomischer Perspektive, definiert externe Effekte und charakterisiert verschiedene umweltpolitische Instrumente, um den Emissionszertifikatehandel im Detail einzuführen und mit anderen Instrumenten zu vergleichen.
Wie wird die Funktionsweise des CO2-Emissionshandels beschrieben?
Kapitel 3 beschreibt detailliert die Funktionsweise, beginnend mit dem Kyoto-Protokoll und der Lastenverteilung in Europa. Der Schwerpunkt liegt auf dem EU-EHS, seinen rechtlichen Grundlagen, den beteiligten Akteuren und der Analyse der ersten beiden Handelsperioden.
Welche aktuellen Probleme des Emissionshandels werden analysiert?
Kapitel 4 analysiert aktuelle Herausforderungen, fokussiert auf die dritte Handelsperiode (2013-2020), die elektronische Informationsübermittlung, das Trittbrettfahrerproblem, die wirtschaftlichen Auswirkungen der CO2-Vollversteigerung, den Preisverfall der Zertifikate und Maßnahmen zur Preisstabilisierung wie Backloading.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: CO2-Emissionshandel, EU-Emissionshandelssystem, Kyoto-Protokoll, Preisverfall, Trittbrettfahrerproblem, externe Effekte, Umweltpolitik, ökonomische Instrumente, Zertifikatehandel, Klimaschutz.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, ein umfassendes Verständnis des CO2-Emissionshandels zu vermitteln und bestehende Probleme zu analysieren.
- Quote paper
- Aytekin Sesli (Author), 2013, Der CO2-Emissionshandel. Funktionsweise und aktuelle Probleme, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/275197