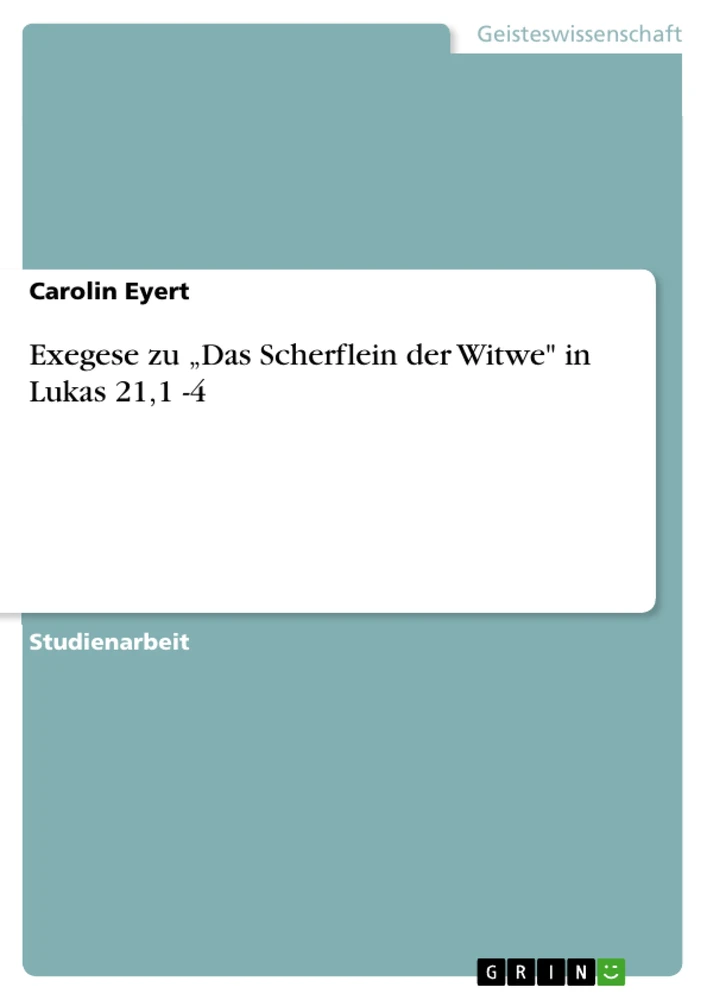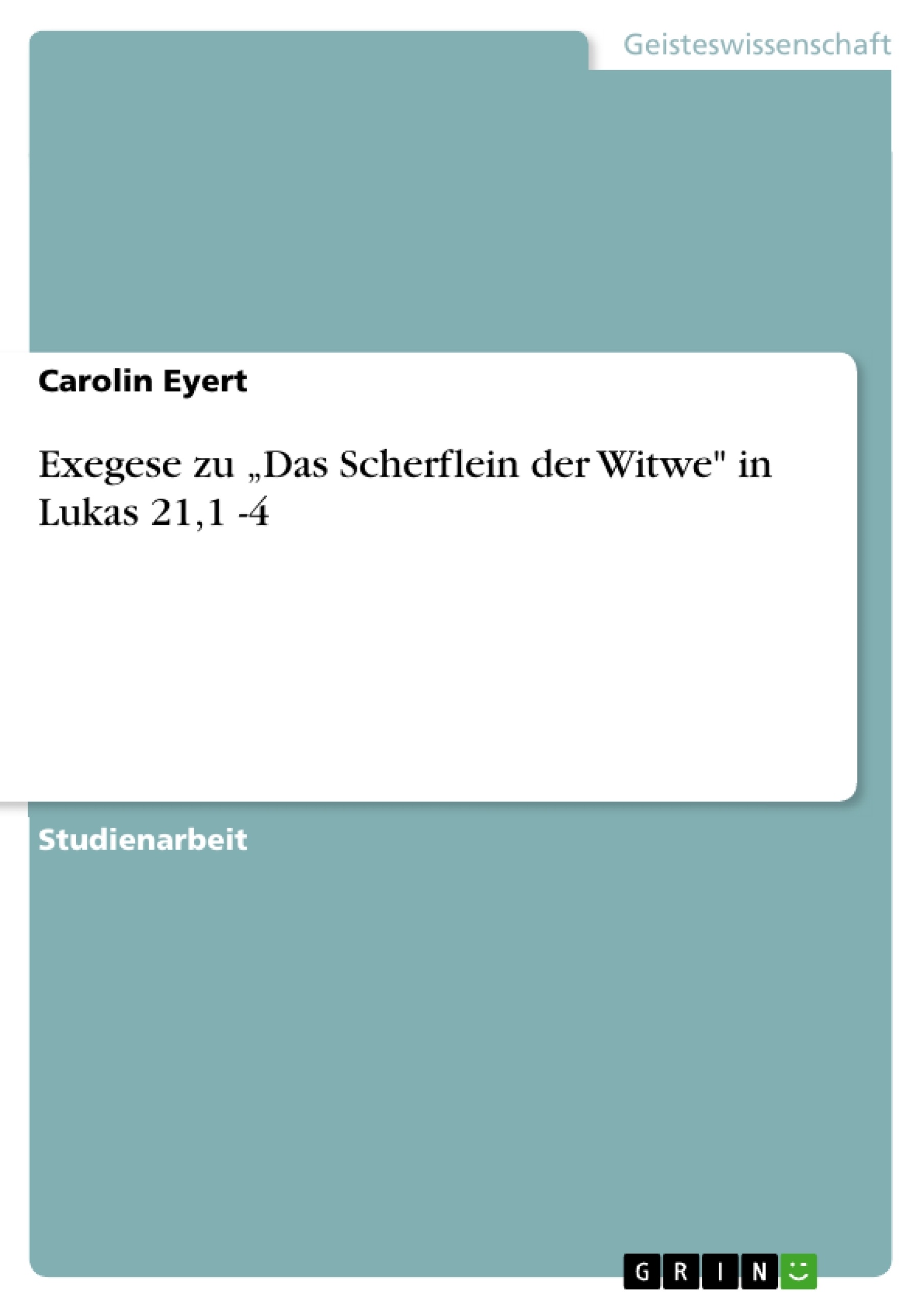Die von mir gewählte Perikope, „Die Gabe der Witwe“, steht in Lukas 21,1-4. Es wird eine kurze Szene im Jerusalemer Tempel berichtet, in der Jesus die Opfergabe von einigen Reichen sowie einer Witwe beobachtet und anschließend bekannt gibt, die Witwe habe mehr gegeben als die anderen, da sie nicht nur einen Teil ihres Überflusses, sondern ihren gesamten Lebensunterhalt gab. Der Text reizt mich besonders, da er schon beim ersten Lesen einige Auffälligkeiten zeigt. So stellt sich mir beispielsweise die Frage, warum Jesus Christus die Witwe verteidigt, zumindest scheint es so, obwohl sie ja von niemandem angegriffen wurde. Scheinbar unaufgefordert und ohne Grund nimmt er diese Begebenheit der Opfergabe der Witwe als Anlass, um ein Lob der Witwe gegenüber, jedoch nicht an sie direkt gerichtet, auszusprechen. Beim ersten Lesen merkte ich, dass ich recht schnell davon ausging, es handele sich um einen Tadel des Verhaltens der Reichen. Erst beim zweiten Lesen des Textes fiel mir auf, dass tatsächlich nicht dieses Verhalten gerügt, sondern das der Witwe als besonders lobenswert hervorgehoben wird. Diejenige, die am wenigsten gibt und am Rande der Gesellschaft steht, wird in ihrer Handlung betont. Diese Antithetik reizt mich, mir diese Perikope genauer anzuschauen und mich intensiv mit ihr auseinanderzusetzen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Hauptteil
- 2.1 Textanalyse
- 2.1.1 Abgrenzung des Textes und Einbindung in den Kontext
- 2.1.2 Übersetzungsvergleich
- 2.1.3 Narrative Analyse
- 2.1.3.1 Inhalt der Erzählung
- 2.1.3.2 Erzählweise
- 2.1.4 Analyse der Textsemantik
- 2.2 Historisch-kritische Textrekonstruktion
- 2.2.1 Literarkritik und Überlieferungsgeschichte
- 2.2.2 Formkritik
- 2.2.3 Traditionsgeschichte
- 2.2.4 Redaktionsgeschichte
- 2.2.5 Historischer Ort und ursprüngliche Intention des Textes
- 2.3 Gegenwartsbedeutung des Textes
- 2.1 Textanalyse
- 3. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Perikope „Das Scherflein der Witwe“ (Lukas 21,1-4) unter Anwendung historisch-kritischer Methoden. Ziel ist es, den Text in seinen Kontext einzuordnen, seine narrative Struktur zu untersuchen und seine Bedeutung für die Gegenwart zu ergründen. Die Analyse berücksichtigt verschiedene Aspekte der Textinterpretation, um ein umfassendes Verständnis zu ermöglichen.
- Textuelle Analyse und Kontextualisierung der Perikope in Lukas 21,1-4
- Untersuchung der narrativen Struktur und der Erzählperspektive
- Historisch-kritische Rekonstruktion des Textes und seiner Entstehung
- Interpretation der Textsemantik und der darin enthaltenen Botschaften
- Reflexion der Gegenwartsbedeutung des Textes und seiner Relevanz
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Perikope „Das Scherflein der Witwe“ (Lukas 21,1-4) ein und erläutert die Motivation der Autorin, sich mit diesem Text auseinanderzusetzen. Besonders die scheinbare Verteidigung der Witwe durch Jesus, obwohl sie von niemandem angegriffen wurde, sowie die Frage nach Jesu Wissen um die Höhe der Spende, regen zu einer detaillierten Analyse an. Die Autorin hebt die Antithetik zwischen dem Verhalten der Reichen und der Witwe hervor und kündigt eine eingehende Auseinandersetzung mit dem Text an.
2.1 Textanalyse: Dieser Abschnitt analysiert den Text selbst, beginnend mit seiner Abgrenzung von den umliegenden Perikopen in Lukas. Es wird die inhaltliche und strukturelle Verbindung zu den vorhergehenden und nachfolgenden Textpassagen untersucht, wobei Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Stil und Vokabular hervorgehoben werden. Die Analyse beleuchtet die thematische Kontinuität (Reichtum vs. Armut) und den Wechsel der Perspektive zwischen den verschiedenen Abschnitten. Die Einordnung in den Gesamtkontext des Lukasevangeliums, insbesondere im Bezug auf Jesu Wirken in Jerusalem, wird ebenfalls diskutiert. Parallelen zu anderen Passagen im Lukas-Evangelium, die sich mit dem Thema Besitzverzicht befassen, werden gezogen.
Schlüsselwörter
Lukas 21,1-4, Witwe, Scherflein, Opfergabe, Reichtum, Armut, Textanalyse, Narrative Analyse, Historisch-kritische Methode, Textsemantik, Gegenwartsbedeutung, Kontextualisierung, Parallelen im Lukasevangelium.
Häufig gestellte Fragen zur Analyse der Perikope „Das Scherflein der Witwe“ (Lukas 21,1-4)
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese akademische Arbeit analysiert die Perikope „Das Scherflein der Witwe“ (Lukas 21,1-4) unter Anwendung historisch-kritischer Methoden. Der Fokus liegt auf der Einordnung des Textes in seinen Kontext, der Untersuchung seiner narrativen Struktur und der Ergründung seiner Bedeutung für die Gegenwart.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Analyse verwendet eine Kombination aus textanalytischen, narratologischen und historisch-kritischen Methoden. Dies beinhaltet die Abgrenzung des Textes, einen Übersetzungsvergleich, eine narrative Analyse (Inhalt und Erzählweise), eine semantische Analyse, literarkritische und überlieferungsgeschichtliche Betrachtungen, Formkritik, Traditionsgeschichte, Redaktionsgeschichte und die Untersuchung des historischen Ortes und der ursprünglichen Intention des Textes.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit untersucht die thematische Kontinuität (Reichtum vs. Armut), den Wechsel der Perspektive in verschiedenen Textabschnitten und die Einordnung in den Gesamtkontext des Lukasevangeliums. Sie beleuchtet Parallelen zu anderen Passagen im Lukasevangelium, die sich mit dem Thema Besitzverzicht befassen. Besondere Aufmerksamkeit wird der scheinbaren Verteidigung der Witwe durch Jesus, obwohl sie von niemandem angegriffen wurde, und der Frage nach Jesu Wissen um die Höhe der Spende gewidmet.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in Einleitung, Hauptteil und Schluss. Der Hauptteil umfasst eine Textanalyse (inklusive Abgrenzung, Übersetzungsvergleich, narrativer Analyse und semantischer Analyse) und eine historisch-kritische Textrekonstruktion (einschließlich Literarkritik, Überlieferungsgeschichte, Formkritik, Traditionsgeschichte, Redaktionsgeschichte und der Untersuchung des historischen Ortes und der ursprünglichen Intention). Zusätzlich wird die Gegenwartsbedeutung des Textes behandelt.
Welche Kapitelzusammenfassungen werden geboten?
Die Zusammenfassung der Kapitel beinhaltet eine Einleitung, die die Thematik und Motivation der Autorin erläutert. Die Textanalyse beschreibt die Abgrenzung des Textes und die Untersuchung der inhaltlichen und strukturellen Verbindungen zu anderen Passagen. Die Arbeit schließt mit einer Zusammenfassung der Ergebnisse und Schlussfolgerungen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Lukas 21,1-4, Witwe, Scherflein, Opfergabe, Reichtum, Armut, Textanalyse, Narrative Analyse, Historisch-kritische Methode, Textsemantik, Gegenwartsbedeutung, Kontextualisierung, Parallelen im Lukasevangelium.
Welches ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist es, ein umfassendes Verständnis der Perikope „Das Scherflein der Witwe“ zu ermöglichen, indem der Text in seinen Kontext eingeordnet, seine narrative Struktur untersucht und seine Bedeutung für die Gegenwart ergründet wird.
- Arbeit zitieren
- Carolin Eyert (Autor:in), 2013, Exegese zu „Das Scherflein der Witwe" in Lukas 21,1 -4, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/275131