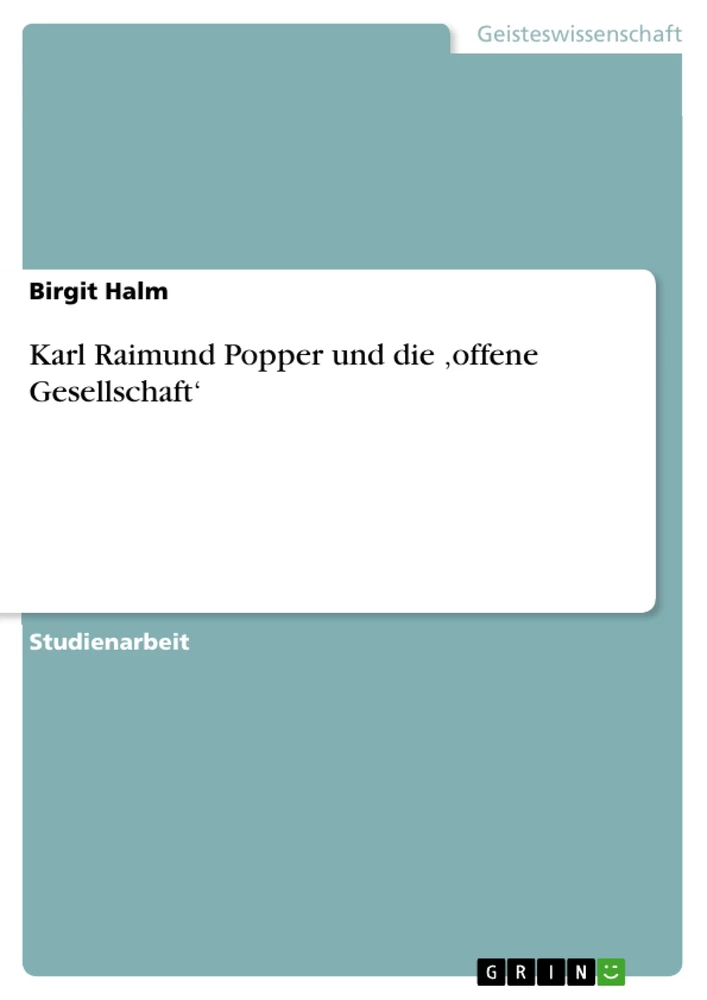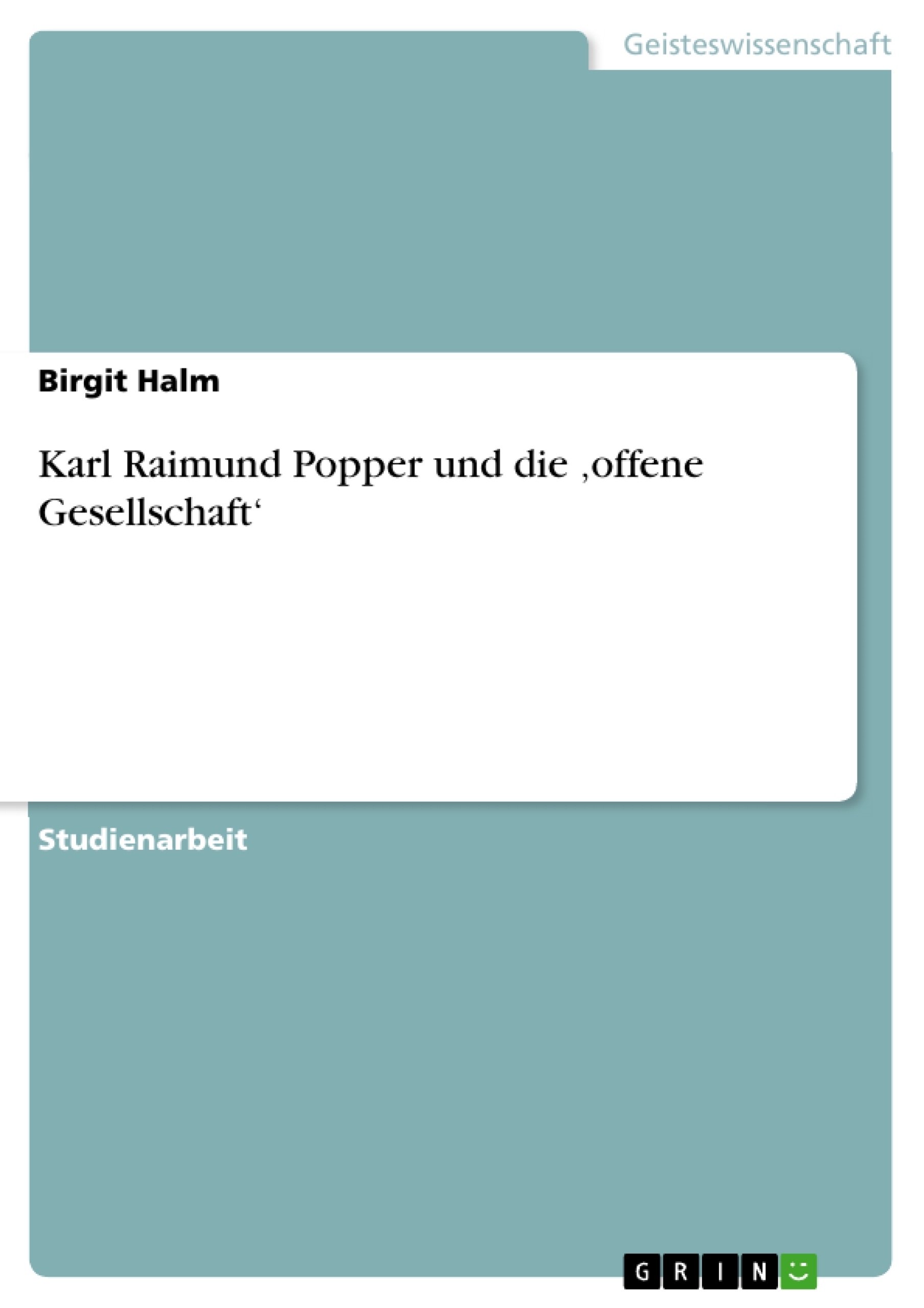Karl Raymund Popper, geboren am 28.07.1902 in Wien, war ein sehr bedeutender Philosoph des 20.Jahrhunderts. Seine Denkansätze haben bis heute einen nachhaltigen Einfluss auf die Philosophie.
Popper favorisiert die „offene Gesellschaft“ als zielführende für die Zukunft. Für ihn ist die Entwicklung des Menschen nur dann gesichert, wenn demokratische Verhältnisse in der Gesellschaft herrschen und jeder gleiche Chancen zur Selbstverwirklichung eingeräumt bekommt. Andererseits ist der Mensch im Gegensatz zur „geschlossenen Gesellschaft“ für seine Lebensgestaltung selbstverantwortlich. Diese neue Verantwortung für sich und andere bringt jedoch auch Probleme mit sich. Nicht jeder ist diesen Ansprüchen gewachsen, sodass soziale und rechtliche Instrumente greifen müssen.
Für die Verwirklichung der ethischen Ziele der Gegenwart ist die „offene Gesellschaft“ unbestritten notwendig. Es darf auch keine Trennung von Moral und Politik geben, utilitaristische Theorien oder die Ideen von Machiavelli in Bezug auf die Machtausübung schließen sich von vornherein aus. Jede Veränderung der Gesellschaft ist möglich, es dürfen jedoch keine Gesetze zur Anwendung kommen, die die Demokratie in Frage stellen.
Mit der Überwindung der Teilung Deutschlands sahen sich die Menschen im Gebiet der ehemaligen DDR der „offenen Gesellschaft“ ausgesetzt. Aus einem vom Staat organisierten Leben wurden sie mit einer grundsätzlich neuen Lebensweise konfrontiert. Sie waren für ihre Entwicklung, für ihr Handeln selbst verantwortlich. Aus der geschlossenen wurde von einem Tag auf den anderen eine offene Gesellschaft, wie sie Karl Raimund Popper in seinen Arbeiten beschrieb. Am freien Fall von der geschlossenen zur offenen Gesellschaftsform sollen damit verbundene Probleme verdeutlicht werden, die bis heute die gesellschaftliche Wirklichkeit nicht unerheblich prägen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Poppers Lehre von Vermutung und Irrtum
- Subjektive Erkenntnis versus objektiver Wahrheit
- Zuerst ist die Verwunderung
- Kritikverbot in der geschlossenen Gesellschaft
- Orakelphilosophie: Holismus und andere Ideologien
- Georg Wilhelm Friedrich Hegel und Karl Marx — überzeugte Historizisten
- Tyrannei oder Demokratie
- Institutionen für Rechtssicherheit
- Minimallösungen unzureichend?
- Der Weg zur Wahrheit
- Zyklus der Fehlersuche und Fehlereliminierung
- Auf Ideensuche
- Selbstverwirklichung durch Erkenntnisgewinnung
- Selbstkritik empfohlen
- Selbstverwirklichung in demokratischen Verhältnissen
- Demokratie darf Gericht halten
- Voraussetzungen für die Freiheit des Individuums
- Grundideen der geschlossenen Gesellschaft
- Platons Ideen
- Die Lehren des Historizismus
- Wichtiges Machtinstrument des Sozialismus
- Über die Verwirklichung der „sozialistischen Ideen" in der Deutschen Demokratischen Republik
- Die Möglichkeiten der offenen Gesellschaft
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Werk des Philosophen Karl Raimund Popper und seinen Überlegungen zur „offenen Gesellschaft". Die Arbeit analysiert Poppers Kritik an geschlossenen Gesellschaften, die durch Determinismus, Ideologien und Unterdrückung des freien Denkens geprägt sind. Im Zentrum steht die Frage, wie die offene Gesellschaft als Voraussetzung für individuelle Freiheit und Selbstverwirklichung betrachtet werden kann.
- Kritik an geschlossenen Gesellschaften
- Poppers Theorie der Vermutung und des Irrtums
- Die Bedeutung der kritischen Diskussion
- Selbstverwirklichung in der offenen Gesellschaft
- Die Herausforderungen der Demokratie
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung präsentiert Karl Raimund Popper als einen bedeutenden Philosophen des 20. Jahrhunderts, der die „offene Gesellschaft" als zukunftsweisendes Modell hervorhebt. Poppers Überzeugung, dass die Entwicklung des Menschen nur in demokratischen Verhältnissen gesichert ist, steht im Kontrast zur „geschlossenen Gesellschaft", die durch Determinismus und Unterdrückung des freien Denkens geprägt ist.
Kapitel 2 erläutert Poppers Lehre von Vermutung und Irrtum, die eine neue Herangehensweise an wissenschaftliche Erkenntnisgewinnung darstellt. Popper betont die Wichtigkeit der kritischen Überprüfung von Hypothesen, um der Wahrheit näher zu kommen. Er argumentiert, dass absolute Wahrheit nicht erreichbar ist, sondern nur eine ständige Annäherung möglich ist.
Kapitel 3 beleuchtet das Kritikverbot in der geschlossenen Gesellschaft. Popper kritisiert verschiedene Formen geschlossener Gesellschaften, darunter die „orakelnden Philosophen", die von einem unabänderlichen Schicksalsgesetz ausgehen, sowie den „methodologischen Essentialismus" Platons, der eine ideale Gesellschaft als Ausgangspunkt und jede Veränderung als Verfall sieht. Auch die historizistischen Theorien von Hegel und Marx werden von Popper als hinderlich für die Entwicklung einer offenen Gesellschaft betrachtet.
Kapitel 4 setzt sich mit der Tyrannei und der offenen Gesellschaft auseinander. Popper favorisiert die Demokratie als einzige vernunftgemäße Staatsform, in der jedes Mitglied der Gemeinschaft selbstverantwortlich für seine Zukunft ist. Er betont die Wichtigkeit von Institutionen, die Rechtssicherheit gewährleisten, und warnt vor den Gefahren von Minimallösungen, die zu einem Stillstand führen können.
Kapitel 5 beschreibt den Weg zur Wahrheit durch Falsifikation. Popper verdeutlicht die Bedeutung der Fehlersuche und Fehlereliminierung für den wissenschaftlichen Erkenntnisprozess. Er argumentiert, dass die kritische Diskussion und die Suche nach falschen Aussagen die Grundlage für den Fortschritt des Wissens bilden.
Kapitel 6 behandelt die Selbstverwirklichung durch Erkenntnisgewinnung. Popper räumt der Selbstkritik eine große Bedeutung ein und betont, dass der freie Gedankenaustausch und die konstruktive Auseinandersetzung mit anderen die Grundlage für die Entwicklung neuer Erkenntnisse und die Annäherung an die Wahrheit bilden.
Kapitel 7 beleuchtet die Grundideen der geschlossenen Gesellschaft. Popper kritisiert die pessimistische Ideenlehre Platons, die den Stillstand im gesellschaftlichen Leben favorisiert, sowie die historizistischen Theorien von Hegel und Marx, die von einer vorbestimmten Entwicklung ausgehen. Diese deterministischen Lehren sieht Popper als Hindernis für die Entwicklung einer offenen Gesellschaft.
Kapitel 8 widmet sich der Verwirklichung der „sozialistischen Ideen" in der Deutschen Demokratischen Republik. Die Autorin beschreibt ihre eigenen Erfahrungen als ehemalige DDR-Bürgerin und zeigt auf, wie die Unterdrückung des freien Denkens und die Abnahme individueller Entscheidungen zu einer allgemeinen Lethargie und einem Mangel an Kreativität geführt haben.
Kapitel 9 beleuchtet die Möglichkeiten der offenen Gesellschaft. Die Autorin betont, dass der Schritt aus einer geschlossenen in eine offene Gesellschaft viele Chancen bietet, die es zu nutzen gilt. Sie beschreibt die Herausforderungen und die Mühen, die mit der Anpassung an eine neue Welt verbunden sind, und plädiert für Offenheit, Lernbereitschaft und die Fähigkeit, aus Fehlern zu lernen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die offene Gesellschaft, die geschlossene Gesellschaft, Karl Raimund Popper, Freiheit, Selbstverwirklichung, Demokratie, Kritik, Falsifikation, Historizismus, Ideologie, Tyrannei, Individuum, Erkenntnisgewinnung, Selbstkritik, und die Deutsche Demokratische Republik.
- Quote paper
- Birgit Halm (Author), 2013, Karl Raimund Popper und die ‚offene Gesellschaft‘, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/275064