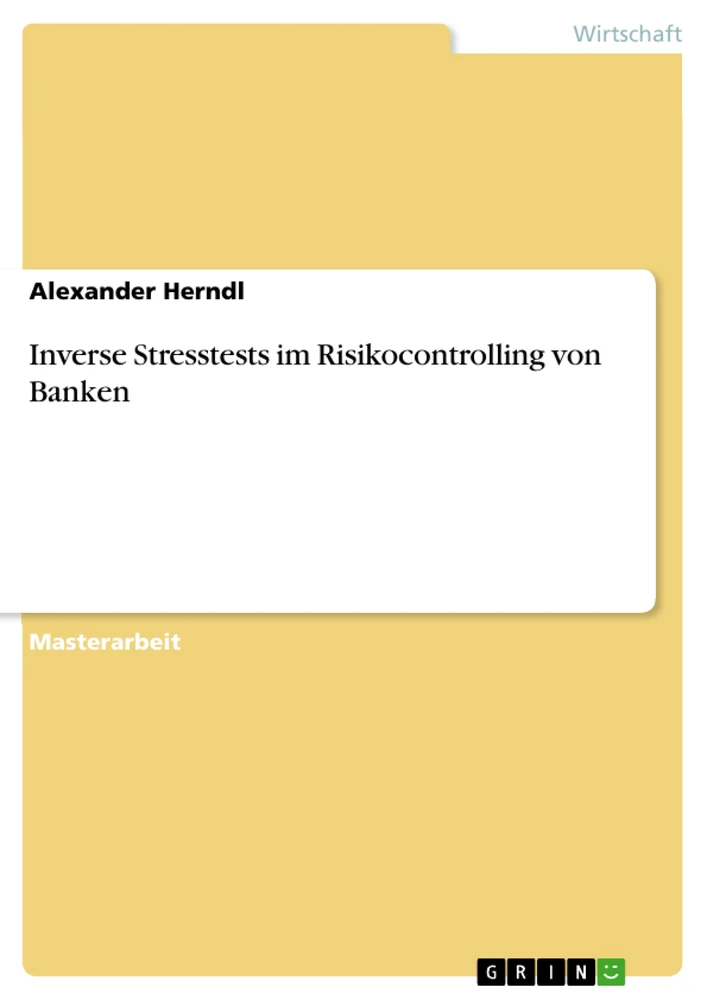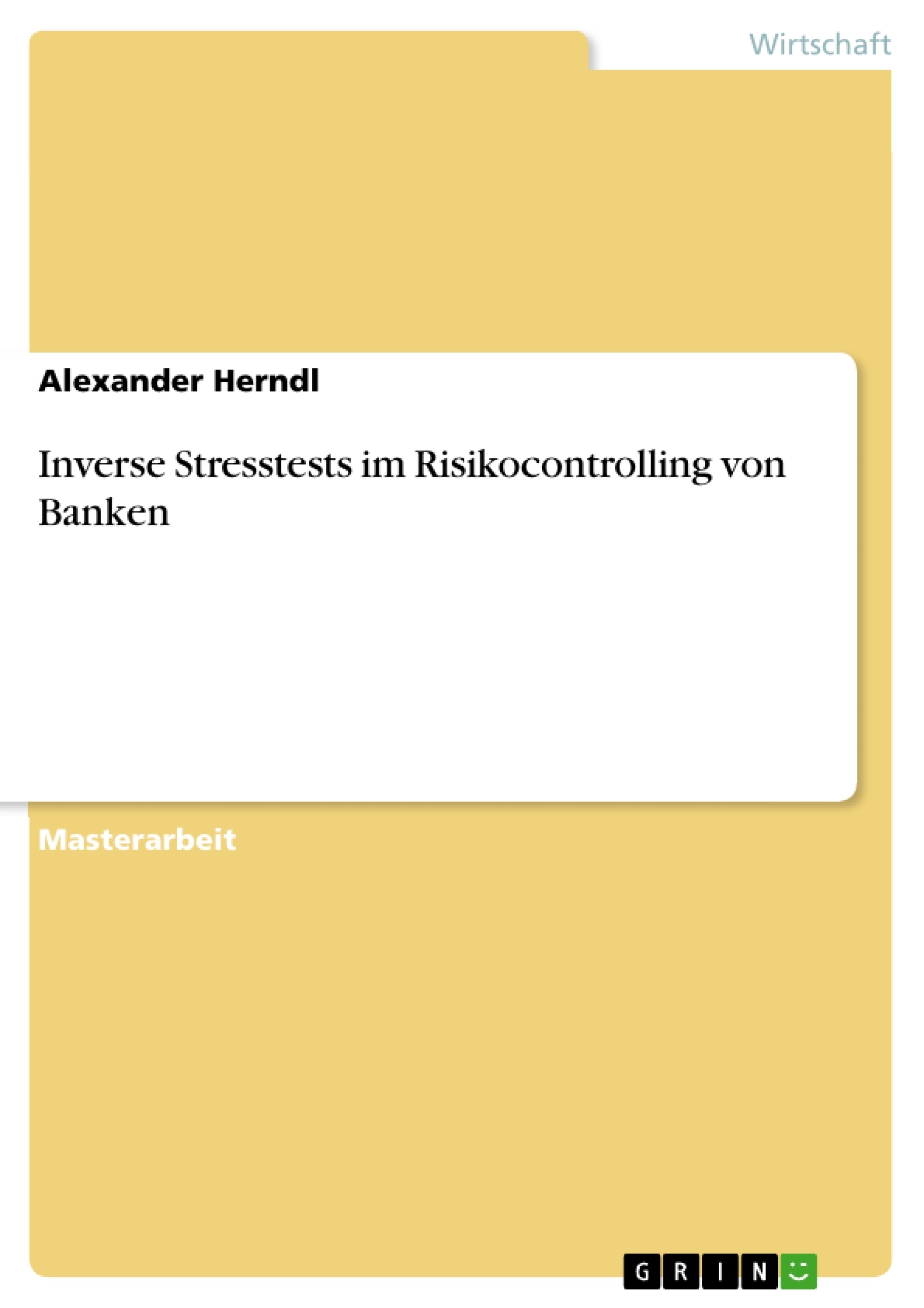Mit Ablauf der Einführungsfristen des Regulierungspakets Basel III wird jedes europäische Kreditinstitut dazu verpflichtet, regelmäßig inverse Stresstests durchzuführen. Die nationalen und europäischen Regulierungsbehörden schreiben den Instituten hierbei kein festes Stresstestingverfahren vor, es wurden lediglich Richtlinien darüber erlassen, in welchen Rahmenbedingungen Stresstests durchzuführen sind und was sie bezwecken sollen. Daher herrscht in den Banken derzeit noch Unsicherheit darüber, wie das neue Instrument des Risikocontrollings umzusetzen ist.
Diese Arbeit stellt ein Verfahren für quantitative inverse Stresstests ausführlich und beispielhaft vor. Dabei wird gezeigt, dass dieses Verfahren nicht nur auf Portfolios von Kreditnehmern gleicher Ratingklassen angewendet werden kann, sondern auch auf beliebig zusammengesetzte Portfolios. Des Weiteren wird mit dem IRB-Ansatz eine realistischere Annahme über das zur Risikodeckung zu hinterlegende Eigenkapital implementiert. Diese Erweiterungen zeigen exemplarisch, dass das Grundkonzept flexibel an neue Anforderungen und Gegebenheiten angepasst werden kann.
Im zweiten Teil der Arbeit wird ein Vergleich zu einem alternativen Ansatz für quantitative inverse Stresstests gezogen. Dabei wird auf die Vor- und Nachteile der beiden Verfahren eingegangen, die Kreditinstitute bei der Entscheidungsfindung für ein geeignetes Stresstestingrahmenwerk einkalkulieren müssen.
Im abschließenden Teil der Arbeit wird eine Idee für einen qualitativen inversen Stresstest vorgestellt, die im Rahmen der derzeit stattfindenden Diskussion veröffentlicht wurde.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Gesetzliche Grundlagen
- Aktuelle Diskussion
- Methodische Grundlagen
- Vorgehen
- Risikofaktoren
- Quantitative inverse Stresstests
- Die Idee des inversen Stresstestings
- Eigenkapitalanforderungen
- Das erweiterte CreditMetrics-Modell nach GRUNDKE
- Bewertung des Portfolios im Risikohorizont
- Recovery Rate bei Ausfall einer Position
- Stresstestprozedur
- Vorgehen
- Risikokennziffern
- Ergebnisse
- Interpretation der Ergebnisse
- Zweiter inverser Stresstest zur Verbesserung der Ergebnisse in der Modellumgebung
- Dritter Stresstest zur Problembehebung
- Alternativer Ansatz
- Vergleich der Ansätze nach GRUNDKE und DRÜEN/FLORIN
- Vorgehen beim Ansatz von DRÜEN/FLORIN
- Risikomessmodelle
- Fazit des Vergleichs
- Qualitative inverse Stresstests
- Vorgehen beim qualitativen inversen Stresstest mit Fehlerbäumen
- Fazit zu qualitativen inversen Stresstests
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Masterarbeit untersucht die Anwendung von inversen Stresstests im Risikocontrolling von Banken. Dabei werden die methodischen Grundlagen, die verschiedenen Ansätze und die praktische Anwendung von inversen Stresstests beleuchtet. Besonderes Augenmerk liegt auf der Analyse der Stärken und Schwächen der unterschiedlichen Ansätze, um die Eignung für die praktische Anwendung im Risikocontrolling zu beurteilen.
- Inverse Stresstests als Instrument zur Beurteilung der Widerstandsfähigkeit von Banken
- Anwendung von inversen Stresstests im Kreditrisikocontrolling
- Vergleich verschiedener Modelle und Ansätze für inverse Stresstests
- Analyse der Stärken und Schwächen der unterschiedlichen Ansätze
- Praktische Implementierung von inversen Stresstests in der Bankenpraxis
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der inversen Stresstests ein und erläutert die gesetzlichen Grundlagen sowie die aktuelle Diskussion um die Anwendung dieser Methode im Risikocontrolling. Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit den methodischen Grundlagen und stellt die wichtigsten Risikofaktoren vor. Die Kapitel 3 und 4 analysieren verschiedene Ansätze für quantitative und qualitative inverse Stresstests. Kapitel 3 behandelt die Idee des inversen Stresstestings, die Eigenkapitalanforderungen sowie das erweiterte CreditMetrics-Modell nach GRUNDKE. Es beschreibt die Stresstestprozedur, die Risikokennziffern, die Interpretation der Ergebnisse und präsentiert einen zweiten inverser Stresstest sowie einen dritten Stresstest zur Problembehebung. Des Weiteren wird ein alternativer Ansatz vorgestellt und die beiden Ansätze nach GRUNDKE und DRÜEN/FLORIN verglichen. Kapitel 4 befasst sich mit dem Vorgehen beim qualitativen inversen Stresstest mit Fehlerbäumen. Abschließend werden die Ergebnisse der Untersuchung zusammengefasst.
Schlüsselwörter
Inverse Stresstests, Risikocontrolling, Banken, Kreditrisiko, CreditMetrics-Modell, Eigenkapitalanforderungen, Stresstestprozedur, Risikokennziffern, Qualitative Stresstests, Fehlerbäume.
- Quote paper
- Alexander Herndl (Author), 2014, Inverse Stresstests im Risikocontrolling von Banken, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/274573