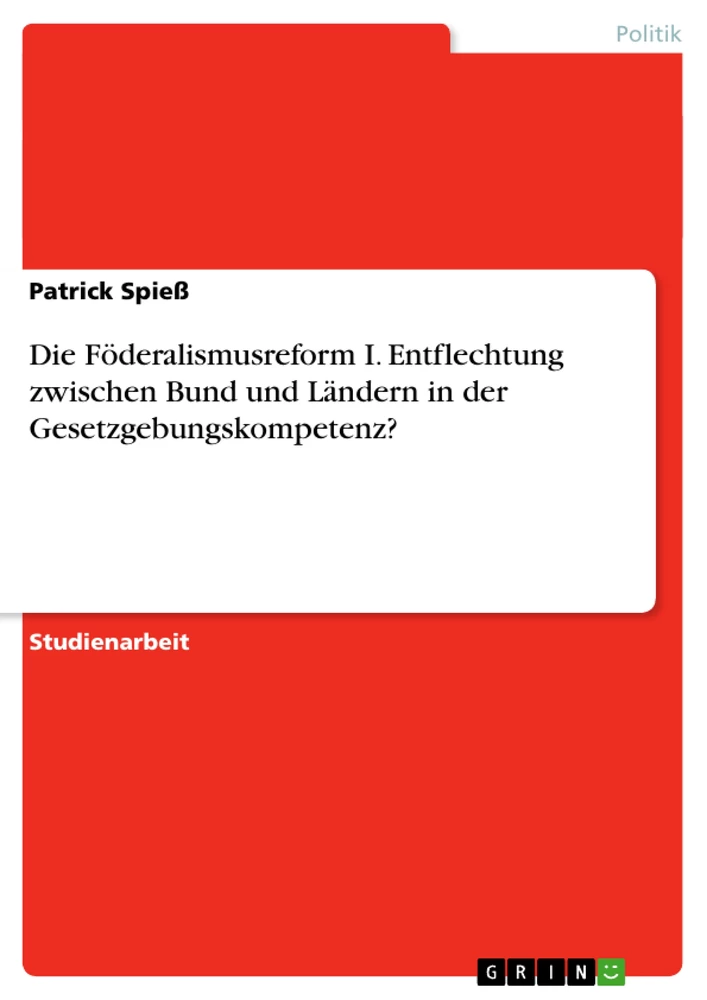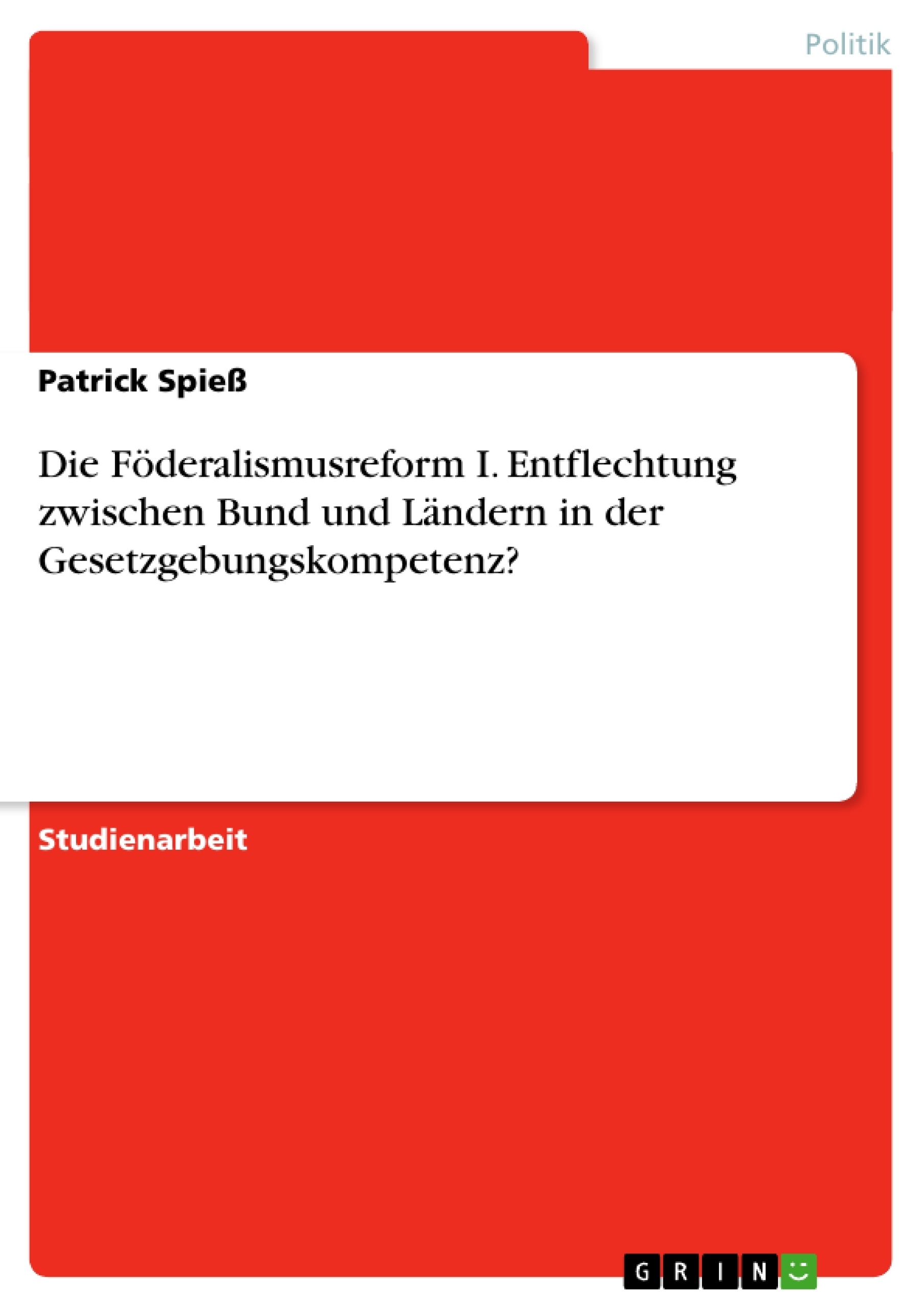Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der ersten Föderalismusreform 2006 und legt dabei den Schwerpunkt besonders auf Kompetenzverteilung zwischen dem Bund und den Ländern in der Gesetzgebung. Andere Kernpunkte, wie zum Beispiel Umwelt oder Europafähigkeit, werden aufgrund des begrenzten Umfangs dieser Arbeit dabei außen vor gelassen. Die Föderalismusreform war das Resultat einer immer stärkeren Kritik am deutschen Föderalismus, dem Ineffizienz und Handlungsunfähigkeit vorgeworfen wurde. Mit der 52. Änderung des Grundgesetzes wurde daher die „Modernisierung der bundesstaatlichen Ordnung“ bezweckt. Hintergrund dabei ist nicht nur, den Bürgern mehr Transparenz in der Entscheidungsfindung zu ermöglichen, sondern auch im Hinblick auf den europäischen Einigungsprozess die Verfassung zu optimieren. Ziel dieser Arbeit ist es zu erörtern, inwieweit die „Mutter aller Reformen“, wie sie Edmund Stoiber anpreiste, ihrem Reformanspruch gerecht geworden ist. Zunächst einmal werden die im Grundgesetz verankerten Ursachen der Politikverflechtung im deutschen Föderalismus und die Verfassungsänderungen, die im Laufe der Zeit zur stärkeren Verflechtung beigetragen haben, beleuchtet. Anschließend wird die Politikverflechtungsfalle von Fritz Scharpf in groben Zügen vorgestellt, aufgrund derer der deutsche Föderalismus immer stärker ins Kreuzfeuer der Kritik geriet und schließlich im Reformversuch mündete. Im weiteren Verlauf werden konkrete Zielsetzungen, die zur Entflechtung in der Gesetzgebungskompetenz beitragen sollen beschrieben und im Anschluss daran detailliert bilanziert. Zum Schluss hin findet eine Bewertung der Maßnahmen im Hinblick auf die Zielsetzung und die Politikverflechtung in der Gesetzgebung statt und wird mit einem Ausblick abgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Föderalismus in Deutschland
- 2.1 Ursachen der Politikverflechtung
- 2.2 Politikverflechtungsfalle nach Scharpf
- 3. Föderalismusreform
- 3.1 Ziel der Entflechtung zwischen Bund und Ländern
- 3.2 Bilanz der Föderalismusreform
- 4. Politikverflechtung nach der Föderalismusreform
- 5. Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die erste Föderalismusreform von 2006 und analysiert, inwieweit sie das Ziel der Entflechtung zwischen Bund und Ländern in der Gesetzgebungskompetenz erreicht hat. Sie beleuchtet die historischen Ursachen der Politikverflechtung im deutschen Föderalismus und bewertet die Reformmaßnahmen im Hinblick auf ihre Effektivität.
- Ursachen der Politikverflechtung im deutschen Föderalismus
- Das Konzept der Politikverflechtungsfalle nach Scharpf
- Zielsetzung der Föderalismusreform (Entflechtung)
- Bilanz der Föderalismusreform
- Politikverflechtung nach der Reform
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der ersten Föderalismusreform (2006) ein und fokussiert auf die Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern in der Gesetzgebung. Sie erwähnt die Kritik am deutschen Föderalismus und die Zielsetzung der Reform, die Bundesstaatlichkeit zu modernisieren und die Transparenz zu erhöhen. Die Arbeit untersucht, ob die Reform ihrem Anspruch gerecht geworden ist. Sie kündigt die Struktur der Arbeit an, welche die Ursachen der Politikverflechtung, Scharpfs Politikverflechtungsfalle, die Reformziele, deren Bilanz und eine abschließende Bewertung umfasst.
2. Föderalismus in Deutschland: Dieses Kapitel beschreibt die historische Entwicklung des deutschen Föderalismus und die Ursachen der Politikverflechtung. Es werden machtpolitische Gründe, administrative Verflechtungen, Parteiennetzwerke und die Problematik der Rahmengesetzgebung erläutert. Die Ausweitung der Bundeskompetenzen durch die Finanzreform von 1969 und die damit verbundene gemeinsame Planung, Entscheidung und Finanzierung von Aufgaben werden detailliert dargestellt. Der zunehmende Einfluss des Bundes auf die Länderkompetenzen und die daraus resultierende Kritik am Föderalismus bilden den Schlusspunkt des Kapitels.
3. Föderalismusreform: Das Kapitel widmet sich den Zielen der Föderalismusreform, insbesondere der Entflechtung in der Gesetzgebungskompetenz. Es analysiert die Maßnahmen der Reform und deren Auswirkungen auf die Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern. Die Bilanz der Reform wird kritisch beleuchtet. Der Fokus liegt auf der Bewertung der Reformmaßnahmen im Hinblick auf die Erreichung des Entflechtungsziels.
4. Politikverflechtung nach der Föderalismusreform: Dieses Kapitel untersucht, ob die Föderalismusreform zu einer spürbaren Entflechtung geführt hat. Es analysiert die verbleibende Politikverflechtung und bewertet deren Auswirkungen auf die Effizienz und Handlungsfähigkeit des deutschen Föderalismus nach der Reform. Es werden die Erfolge und Misserfolge der Reform im Hinblick auf das Entflechtungsziel gewürdigt.
Schlüsselwörter
Föderalismusreform, Politikverflechtung, Kompetenzverteilung, Bund, Länder, Gesetzgebung, Entflechtung, Grundgesetz, Fritz Scharpf, Bundesstaatlichkeit, Rahmengesetzgebung, Gemeinschaftsaufgaben.
FAQ: Analyse der Föderalismusreform 2006
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die erste Föderalismusreform von 2006 in Deutschland. Der Schwerpunkt liegt auf der Untersuchung, inwieweit die Reform das Ziel der Entflechtung zwischen Bund und Ländern in der Gesetzgebungskompetenz erreicht hat. Die Arbeit beleuchtet die historischen Ursachen der Politikverflechtung und bewertet die Effektivität der Reformmaßnahmen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Ursachen der Politikverflechtung im deutschen Föderalismus, das Konzept der Politikverflechtungsfalle nach Scharpf, die Zielsetzung der Föderalismusreform (Entflechtung), die Bilanz der Föderalismusreform und die Politikverflechtung nach der Reform.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Föderalismus in Deutschland, Föderalismusreform, Politikverflechtung nach der Föderalismusreform und Fazit/Ausblick. Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt die Struktur der Arbeit. Kapitel 2 beschreibt die historische Entwicklung des deutschen Föderalismus und die Ursachen der Politikverflechtung. Kapitel 3 analysiert die Ziele und Maßnahmen der Föderalismusreform. Kapitel 4 untersucht die Politikverflechtung nach der Reform. Das Fazit fasst die Ergebnisse zusammen und gibt einen Ausblick.
Was sind die zentralen Ergebnisse der Analyse der Föderalismusreform?
Die Arbeit bewertet die Effektivität der Reformmaßnahmen im Hinblick auf das Erreichen des Entflechtungsziels. Sie analysiert die verbleibende Politikverflechtung nach der Reform und deren Auswirkungen auf die Effizienz und Handlungsfähigkeit des deutschen Föderalismus. Die konkreten Ergebnisse bezüglich des Erfolgs oder Misserfolgs der Entflechtung werden im Hauptteil der Arbeit detailliert dargestellt.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Schlüsselbegriffe sind: Föderalismusreform, Politikverflechtung, Kompetenzverteilung, Bund, Länder, Gesetzgebung, Entflechtung, Grundgesetz, Fritz Scharpf, Bundesstaatlichkeit, Rahmengesetzgebung, Gemeinschaftsaufgaben.
Wie ist die Struktur der Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die das Thema einführt und die Forschungsfrage formuliert. Es folgen Kapitel, die die historischen Hintergründe, die Reform selbst und die Folgen der Reform untersuchen. Die Arbeit schließt mit einem Fazit und Ausblick.
Welche Rolle spielt Fritz Scharpf in dieser Arbeit?
Die Arbeit bezieht sich auf das Konzept der Politikverflechtungsfalle nach Fritz Scharpf, um die Ursachen der Politikverflechtung im deutschen Föderalismus zu erklären und die Reform im Kontext dieses Konzepts zu analysieren.
Welche historischen Ursachen der Politikverflechtung werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet machtpolitische Gründe, administrative Verflechtungen, Parteiennetzwerke und die Problematik der Rahmengesetzgebung als Ursachen der Politikverflechtung im deutschen Föderalismus. Die Ausweitung der Bundeskompetenzen durch die Finanzreform von 1969 wird ebenfalls detailliert dargestellt.
- Quote paper
- Patrick Spieß (Author), 2012, Die Föderalismusreform I. Entflechtung zwischen Bund und Ländern in der Gesetzgebungskompetenz?, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/274481