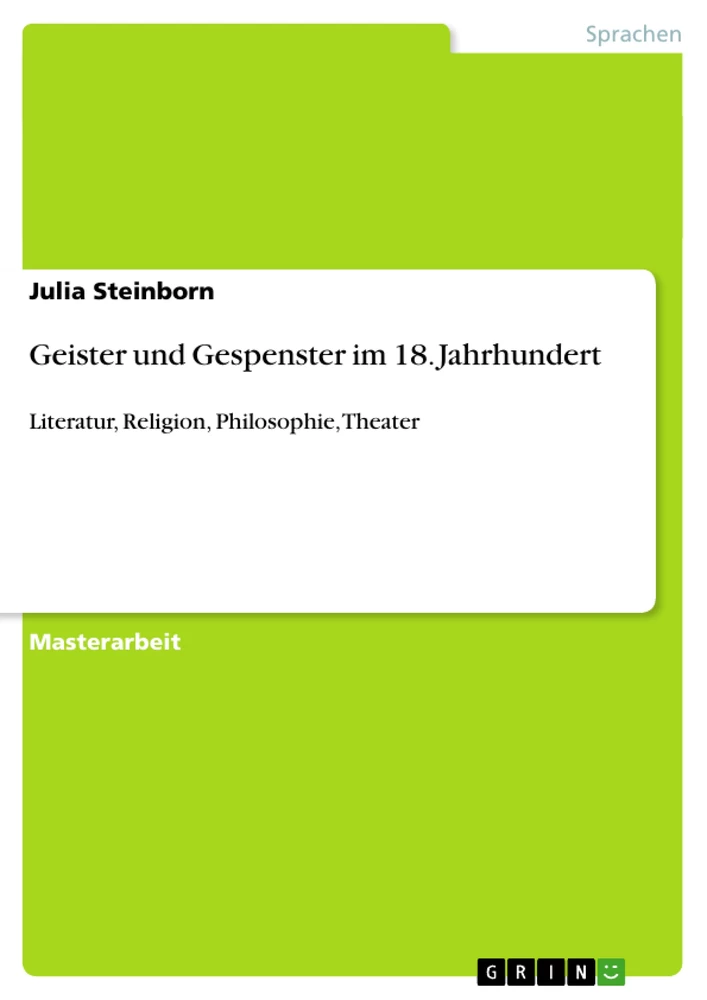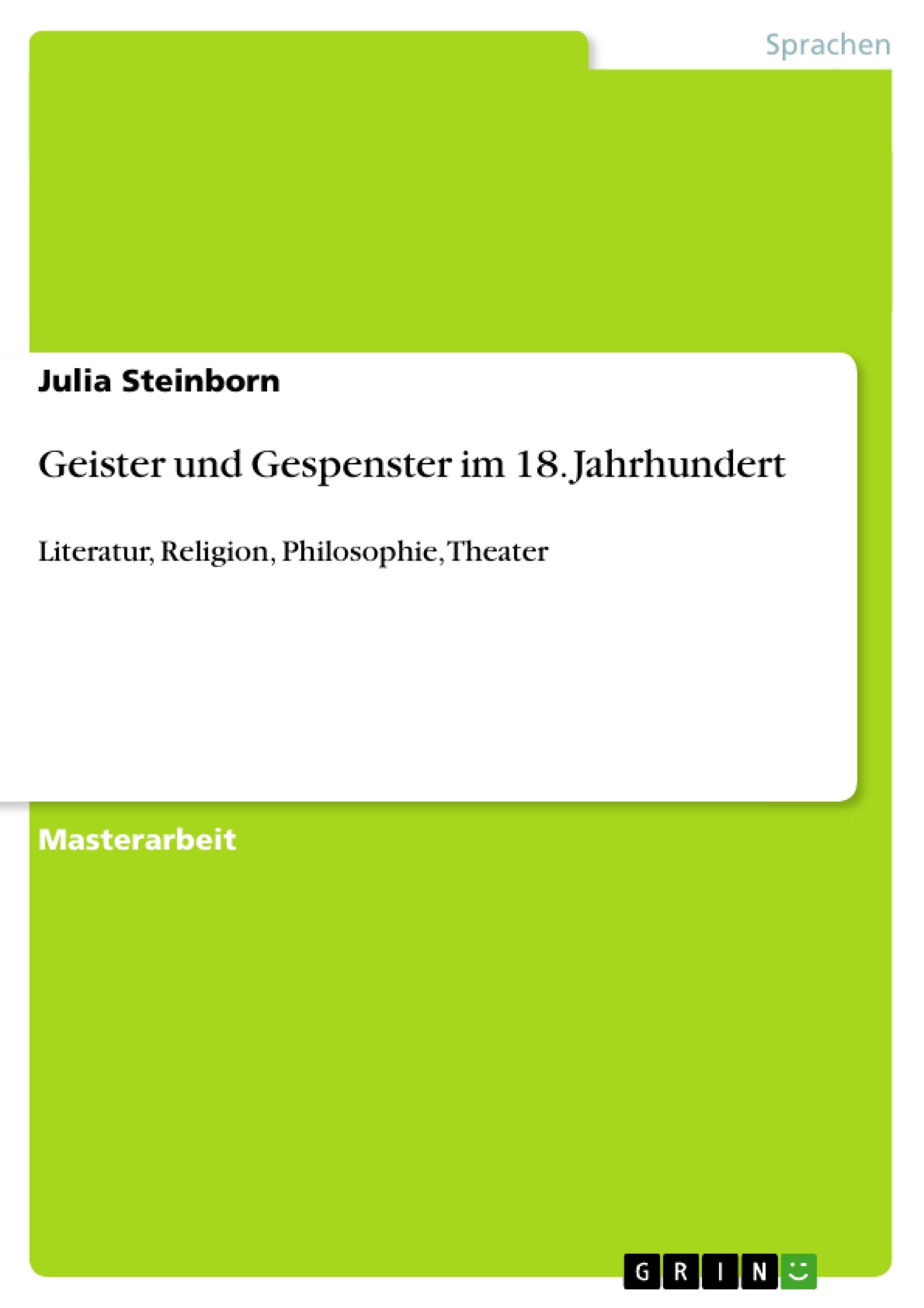Dieser Gespensterdiskurs der Aufklärung erstreckt sich über annähernd 100 Jahre und umfasst nicht allein die Literatur und das Theater, sondern ebenfalls Philosophie, Naturwissenschaft und Religion. In der Forschungsliteratur werden die einzelnen Disziplinen häufig gesondert betrachtet und auf relativ eng gezogene Bereiche beschränkt. Dabei erscheint es mir als unbedingt notwendig, die jeweiligen Einflüsse verschiedenster Disziplinen aufeinander zu beziehen. Philosophische Abhandlungen des 18. Jahrhunderts können nicht objektiv bearbeitet werden, wenn naturwissenschaftliche Erkenntnisse ignoriert werden. Genauso ist der Gegensatz zwischen neuen und alten Religionsvorstellungen nicht bewertbar, wenn der Aberglaube der bäuerlichen Bevölkerung ausgrenzt wird. Aus diesem Grund werde ich in dieser Arbeit Werke und Aufsätze aus den Bereichen Religion, Philosophie, Literatur und Literatur- bzw. Theatertheorie vorstellen und mit in meine Untersuchungen einbeziehen. Mit ihrer Hilfe wird ein umfassender Überblick über die einzelnen Positionen im Geisterdiskurs des 18. Jahrhunderts ermöglicht. Hierbei sollen nicht nur die Veränderungen der Gespenstervorstellung skizziert, sondern aufgezeigt werden, dass in der Aufklärung eine gänzlich neue Funktion und Wirkungsweise von Geistermotiven und Geisterdarstellungen entsteht. Es wird zu untersuchen sein, inwieweit sich all diese Überschneidungen und Veränderungen in Werken der Spätaufklärung bemerkbar machen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Geist, Gespenst und Aberglaube
- 3 Geister und Geistererscheinungen im Barock
- 4 Der Geisterdiskurs der Aufklärung
- 4.1 Religion
- 4.1.1 Balthasar Bekker
- 4.1.2 Peter Goldschmid
- 4.2 Fallerzählungen und Philosophie
- 4.3 Theater und Literatur
- 4.3.1 Gottsched
- 4.3.2 Bodmer
- 4.3.3 Wieland
- 4.3.4 Lessing
- 4.1 Religion
- 5 Exemplarische Betrachtung
- 5.1 Musäus „Die Entführung“
- 5.2 Schiller „Der Geisterseher“
- 6 Der Schauerroman
- 7 Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Geisterdiskurs der Aufklärung im 18. Jahrhundert, indem sie die wechselseitigen Einflüsse von Religion, Philosophie, Literatur und Theater aufeinander beleuchtet. Sie strebt danach, ein umfassendes Bild der verschiedenen Positionen und Veränderungen in der Vorstellung von Geistern und Gespenstern während dieser Epoche zu zeichnen und die Entstehung einer neuen Funktion und Wirkungsweise von Geistermotiven aufzuzeigen. Der Fokus liegt auf dem Vergleich der Frühaufklärung, Hochaufklärung und Spätaufklärung.
- Entwicklung der Geister- und Gespenstervorstellungen im 18. Jahrhundert
- Der Einfluss von Religion (insbesondere protestantische Perspektiven) auf den Geisterdiskurs
- Die Rolle der Philosophie und populärwissenschaftlicher Literatur in der Auseinandersetzung mit Geistererscheinungen
- Die Darstellung von Geistern und Gespenstern in Literatur und Theater
- Vergleichende Analyse der Geisterauffassungen in verschiedenen Strömungen der Aufklärung
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und erläutert die Bedeutung der Geister und Gespenster in der Geschichte, besonders im Kontext der Aufklärung. Sie betont die Notwendigkeit, die verschiedenen Disziplinen (Religion, Philosophie, Literatur, Theater) in ihrer Wechselwirkung zu betrachten, um ein umfassendes Verständnis des Geisterdiskurses zu erlangen. Die Arbeit setzt sich zum Ziel, die Veränderungen in der Vorstellung von Geistern und ihre neue Funktion in der Aufklärung aufzuzeigen und verwendet eine diachrone Betrachtungsweise, die die Frühaufklärung, Hochaufklärung und Spätaufklärung einbezieht.
2 Geist, Gespenst und Aberglaube: Dieses Kapitel bietet eine definitorische Eingrenzung der Begriffe „Geist“, „Gespenst“ und „Aberglaube“. Es legt die Grundlage für die folgenden Kapitel, indem es die verschiedenen Bedeutungen und Konnotationen dieser Begriffe klärt und den Rahmen für die weitere Analyse absteckt. Die Unterscheidung dieser Konzepte ist essentiell für das Verständnis der darauffolgenden Diskussionen über Geistererscheinungen und deren Interpretation im Kontext des 18. Jahrhunderts.
3 Geister und Geistererscheinungen im Barock: Dieses Kapitel skizziert die Darstellung von Geistern und Spukerscheinungen im 17. Jahrhundert, hauptsächlich basierend auf Forschungsliteratur und eigenen Studien. Es zeigt die wesentlichen Eigenschaften, Funktionsweisen und Wirkungsansprüche der Geisterfiguren im Barock auf, bereitet den Leser auf die Veränderungen des 18. Jahrhunderts vor und stellt einen wichtigen Bezugspunkt für den Vergleich dar.
4 Der Geisterdiskurs der Aufklärung: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die wesentlichen Neuerungen in Literatur, Sprache und Produktion sowie dem geistigen Umdenken im 18. Jahrhundert. Es analysiert die Positionen der protestantischen Kirche (mit Fokus auf Bekker und Goldschmid) bezüglich Geister und Gespenster und untersucht populärwissenschaftliche Literatur wie Grimms „Für solche Leser, die noch Gespenster glauben“ und Nicolais „Beispiele einer Erscheinung mehrerer Phantasmen“, um die aufgeklärte Auseinandersetzung mit Geistergeschichten darzustellen. Die Kapitel 4.1, 4.2, und 4.3 untersuchen die verschiedenen Aspekte dieses Diskurses, die alle in die umfassende Darstellung des Kapitels integriert sind.
5 Exemplarische Betrachtung: Dieses Kapitel präsentiert exemplarische Betrachtungen von Werken der Spätaufklärung, konkret Musäus' „Die Entführung“ und Schillers „Der Geisterseher“. Die Analyse dieser Werke dient dazu, die Veränderungen in der Darstellung und Funktion von Geistermotiven und -darstellungen in der Spätaufklärung zu illustrieren und die Ergebnisse der vorherigen Kapitel zu veranschaulichen. Die Auswahl dieser Texte ermöglicht den Vergleich verschiedener Herangehensweisen an das Thema.
6 Der Schauerroman: Dieses Kapitel konzentriert sich auf den Schauerroman als literarische Ausprägung der Auseinandersetzung mit dem Übersinnlichen im 18. Jahrhundert. Es analysiert die Entstehung und Entwicklung dieses Genres und dessen Rolle im Kontext des Geisterdiskurses. Die Analyse deckt die spezifischen Merkmale des Schauerromans auf und setzt diese in Beziehung zu den vorherigen Kapiteln.
Schlüsselwörter
Aufklärung, Geisterdiskurs, Gespenster, Aberglaube, Religion, Philosophie, Literatur, Theater, Barock, protestantische Theologie, populärwissenschaftliche Literatur, Fallerzählungen, Schauerroman, Bekker, Goldschmid, Grimms Märchen, Nicolai, Musäus, Schiller.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Geisterdiskurs der Aufklärung
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Geisterdiskurs der Aufklärung im 18. Jahrhundert. Sie beleuchtet die wechselseitigen Einflüsse von Religion, Philosophie, Literatur und Theater auf die Vorstellung von Geistern und Gespenstern während dieser Epoche. Der Fokus liegt auf dem Vergleich der Frühaufklärung, Hochaufklärung und Spätaufklärung, um die Entstehung einer neuen Funktion und Wirkungsweise von Geistermotiven aufzuzeigen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung der Geister- und Gespenstervorstellungen im 18. Jahrhundert, den Einfluss der Religion (insbesondere protestantische Perspektiven), die Rolle der Philosophie und populärwissenschaftlicher Literatur, die Darstellung von Geistern in Literatur und Theater, sowie einen Vergleich der Geisterauffassungen in verschiedenen Strömungen der Aufklärung.
Welche Autoren und Werke werden analysiert?
Die Arbeit analysiert unter anderem die Werke von Balthasar Bekker, Peter Goldschmid, Gottsched, Bodmer, Wieland, Lessing, Musäus („Die Entführung“) und Schiller („Der Geisterseher“). Sie betrachtet auch populärwissenschaftliche Literatur wie Grimms „Für solche Leser, die noch Gespenster glauben“ und Nicolais „Beispiele einer Erscheinung mehrerer Phantasmen“, sowie den Schauerroman als Genre.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung, Geist, Gespenst und Aberglaube, Geister und Geistererscheinungen im Barock, Der Geisterdiskurs der Aufklärung (unterteilt in Religion, Fallerzählungen und Philosophie, sowie Theater und Literatur), Exemplarische Betrachtung (Musäus und Schiller), Der Schauerroman und Schlusswort. Jedes Kapitel bietet eine detaillierte Analyse der jeweiligen Aspekte des Geisterdiskurses.
Welche Methodik wird angewendet?
Die Arbeit verwendet eine diachrone Betrachtungsweise, die die Frühaufklärung, Hochaufklärung und Spätaufklärung einbezieht. Sie analysiert die verschiedenen Disziplinen (Religion, Philosophie, Literatur, Theater) in ihrer Wechselwirkung, um ein umfassendes Verständnis des Geisterdiskurses zu erlangen. Es werden sowohl vergleichende als auch exemplarische Analysen durchgeführt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Aufklärung, Geisterdiskurs, Gespenster, Aberglaube, Religion, Philosophie, Literatur, Theater, Barock, protestantische Theologie, populärwissenschaftliche Literatur, Fallerzählungen, Schauerroman, Bekker, Goldschmid, Grimms Märchen, Nicolai, Musäus, Schiller.
Welches Ziel verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit strebt danach, ein umfassendes Bild der verschiedenen Positionen und Veränderungen in der Vorstellung von Geistern und Gespenstern während der Aufklärung zu zeichnen und die Entstehung einer neuen Funktion und Wirkungsweise von Geistermotiven aufzuzeigen.
Welche Kapitelzusammenfassungen werden angeboten?
Die bereitgestellten Kapitelzusammenfassungen geben einen Überblick über den Inhalt jedes Kapitels, von der Einleitung, über die Definition der Kernbegriffe, die Analyse des Barock und der Aufklärung (inklusive religiöser, philosophischer und literarischer Aspekte), exemplarischer Analysen von Werken der Spätaufklärung, der Betrachtung des Schauerromans bis zum Schlusswort.
- Quote paper
- M.A. Julia Steinborn (Author), 2013, Geister und Gespenster im 18. Jahrhundert, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/274147