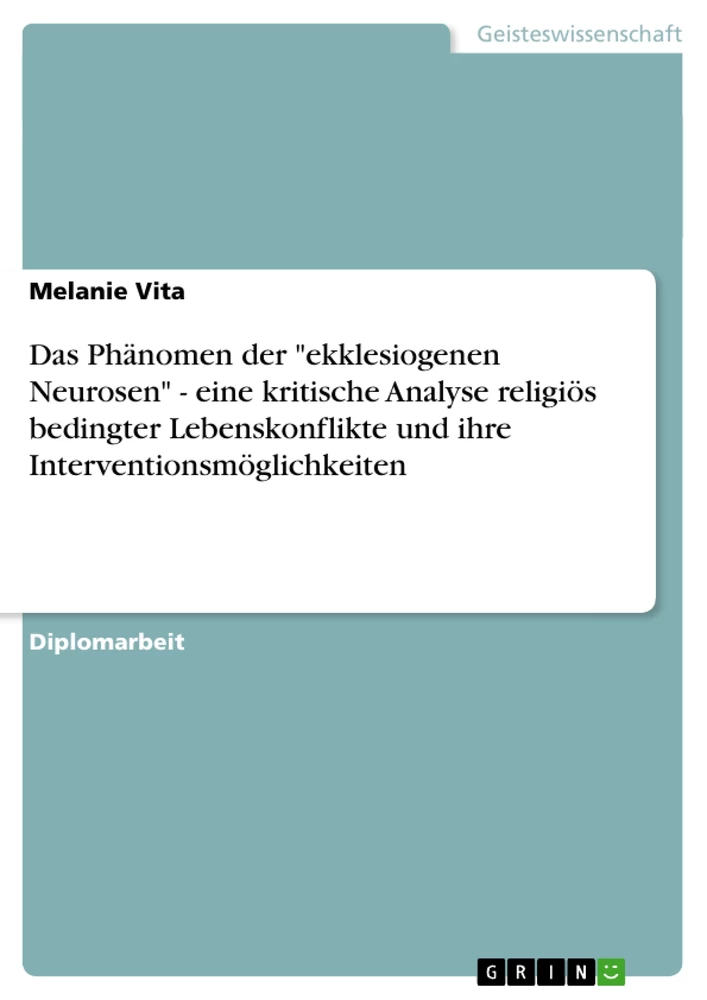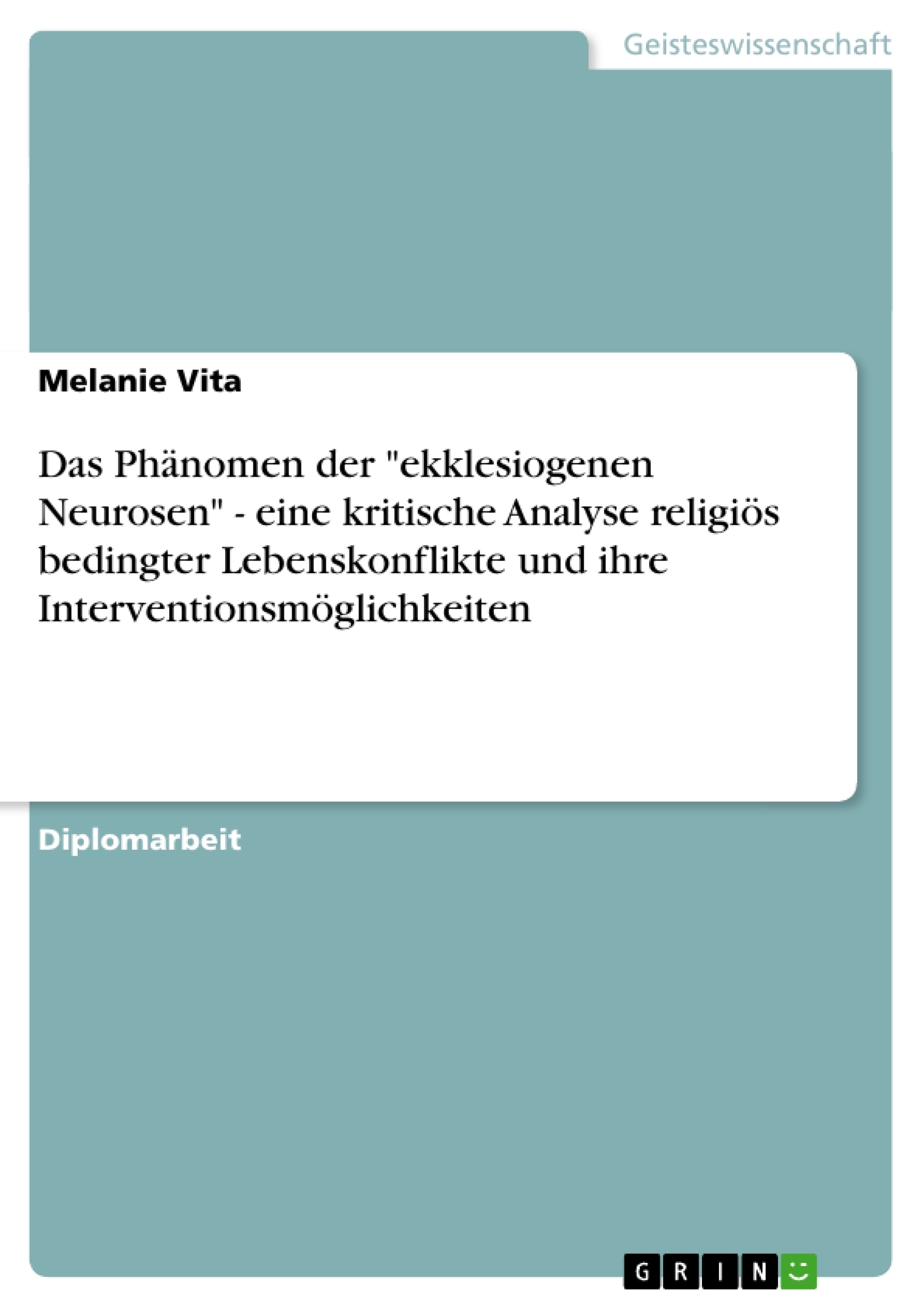Gibt es so etwas wie eine krankmachende Religiosität? Inwiefern beeinflusst Religiosität
die psychische Gesundheit? Welche Funktionen und Konsequenzen hat der Glaube in
Bezug auf die Entwicklung eines Individuums? Kann es sein, dass Christen einem
erhöhten Risiko ausgesetzt sind, psychisch krank zu werden? Dies alles sind Fragen, die es
Wert sind, näher untersucht zu werden. Im ersten Teil dieser Arbeit werde ich eingehen auf die Hintergründe und Zusammenhänge
der „ekklesiogenen Neurose“, also der durch die Kirche bzw. kirchlichen Gemeinschaften
verursachten psychischen Störungen. Es werden die Begrifflichkeiten „Religiosität“ und
„psychische Gesundheit“ geklärt, empirische Untersuchungen zum Verhältnis von Glauben
und psychischem Wohlbefinden erörtert und die Entstehung des Terminus „ekklesiogene
Neurose“ samt ihrer Bedeutung für unsere heutige Gesellschaft und ihrer Kritikpunkte
dargelegt. Im darauffolgenden Abschnitt soll es um die Frage gehen wodurch religiös bedingte
Lebenskonflikte ausgelöst bzw. verursacht werden können. Es werden einzelne
Konfliktbereiche und einflussnehmende Faktoren erörtert sowie ihre defizitäre Wirkung
für die Entstehung neurotischer Störungen dargelegt. Eine gezielte Analyse möglicher
Ursachen, die für ein mangelndes psychisches Wohlbefinden unter Christen verantwortlich
sein könnten, ermöglichen es, daraufhin adäquate Interventionen und Wege zur Prävention
entwickeln zu können. Dieser Themenkomplex wird schließlich im dritten Teil behandelt. Es wird ausgeführt, auf
welche Weise Menschen mit Konflikten im religiösen Bereich geholfen werden kann.
Geklärt werden soll auch, welche Rolle der Religiosität in der Beratungstätigkeit zukommt
und inwieweit ein christlich geprägtes Konzept für eine effektive Intervention hilfreich
sein kann. Im Vorfeld halte ich es für wichtig zu betonen, dass es mir nicht darum geht, die Kirche
bzw. den Glauben zu entwerten oder generell als pathologisierend zu etikettieren, „sondern
darum, transparent und offen über ein Thema zu sprechen, das bisher (...) nicht
angemessen beachtet worden ist“4. Ebenso möchte ich erwähnen, dass ich in meiner Arbeit stärker die „ungesunden“ Aspekte
des christlichen Glaubens betrachten werde (was nicht zu der Schlussfolgerung führen
sollte, es seien keine positiven Seiten vorhanden). [...] 4 DIETERICH (1991), S. 9
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- HINFÜHRUNG ZUM THEMA
- FRAGESTELLUNG UND AUFBAU DIESER ARBEIT
- HINTERGRÜNDE UND ZUSAMMENHÄNGE DES BEGRIFFES DER „EKKLESIOGENEN NEUROSE“
- PROLOG
- ZUR KORRELATION VON RELIGIOSITÄT UND PSYCHISCHER GESUNDHEIT
- ETYMOLOGISCHE BESTIMMUNG DER RELIGIOSITÄT
- Bipolare Erfassung der Religiosität
- Extrinsische und intrinsische religiöse Orientierung
- CHARAKTERISTISCHE MERKMALE PSYCHISCHER GESUNDHEIT
- ERGEBNISSE EMPIRISCHER UNTERSUCHUNGEN ZUR KORRELATION VON RELIGIOSITÄT UND PSYCHISCHER GESUNDHEIT
- ZUR NEUROSENLEHRE IM ALLGEMEINEN
- CHARAKTERISTISCHE MERKMALE EINER NEUROSE
- SYMPTOME
- SYNDROME
- URSACHEN DER NEUROSENENTSTEHUNG
- ZUM BEGRIFF DER „EKKLESIOGENEN NEUROSE“
- DIE ENTSTEHUNG DES BEGRIFFES
- FALLBEISPIELE
- EXKURS: SEXUAL- UND LEIBFEINDLICHE EINSTELLUNG DER KIRCHE
- Geschichtliche Hintergründe
- Ihre Bedeutung für die heutige Zeit
- ZUSAMMENFASSUNG
- KRITIK AM BEGRIFF DER „EKKLESIOGENEN NEUROSE“
- FAZIT
- ENTSTEHUNGSURSACHEN RELIGIÖS BEDINGTER LEBENSKONFLIKTE
- WESENTLICHE MERKMALE EINES NEUROTISCHEN KONFLIKTES
- KONFLIKTBEREICHE IM SPANNUNGSFELD VON NEUROSE UND RELIGIOSITÄT
- FAMILIÄRE PRÄGUNG VERSUS SELBSTVERANTWORTUNG UND FREIE PERSÖNLICHKEITSENTFALTUNG
- Zur Bedeutung der Familie
- Defizitäre Erziehungsstrategien
- Ein strafender Gott als Erziehungsmittel
- Überakzentuierung einer vorbildlichen Moralentwicklung
- Mangelnde Authentizität und Transparenz
- Erlernte Hilflosigkeit
- Ablösungsproblematik bei Jugendlichen aus christlichen Familien
- Konsequenzen
- KIRCHLICHE MORALLEHRE VERSUS PERSÖNLICHER CHRISTLICHER FREIHEIT
- Zur Bedeutung der kirchlichen Lehre
- Gesetzlichkeit und Leistungsorientierung
- Das Leugnen des freien Willens
- Vergeistlichung ideologischer Denkansätze
- Exkurs,,geistlicher Missbrauch“
- Erläuterung des Begriffes
- Die Folgen geistlichen Missbrauchs
- Die Gefahr einer vorschnellen Stigmatisierung
- Zusammenfassung
- GENERELLE NEUROTISCHE KONFLIKTHAFTIGKEIT
- Zur Bedeutung der individuellen Persönlichkeitsstruktur
- Defizitäre Persönlichkeitsstrukturen
- Die zwanghafte Persönlichkeitsstruktur
- Die schizoide Persönlichkeitsstruktur
- Die depressive Persönlichkeitsstruktur
- Die hysterische Persönlichkeitsstruktur
- Zusammenfassung
- FAZIT
- INTERVENTIONSMÖGLICHKEITEN
- ZUR SITUATION DER BETROFFENEN
- ELEMENTARE ZIELE FÜR EINE WIEDERHERSTELLUNG DER PSYCHISCHEN GESUNDHEIT
- BEZIEHUNGSFÄHIGKEIT
- VERÄNDERUNGSFÄHIGKEIT
- KONFLIKTFÄHIGKEIT
- PERSÖNLICHKEITSENTFALTUNG
- MÖGLICHKEITEN DER ZIELERREICHUNG
- ZUR FRAGE DES UMGANGS MIT DEM RELIGIÖSEN THEMENKOMPLEX IN BERATUNG UND THERAPIE
- Ausgangssituation
- Die Rolle der religiösen Passung von Therapeut und Klient
- INTEGRATION VON RELIGIOSITÄT IN BERATUNG UND THERAPIE
- Allgemeines
- Formen spiritueller Interventionen
- Das Gebet
- Meditation
- Vergebung
- Das Lesen der Bibel
- Zur Anwendung spiritueller Interventionen
- DAS KONZEPT DER DE'IGNIS – FACHKLINIK FÜR CHRISTLICHE PSYCHIATRIE UND PSYCHOSOMATIK ALS MODELL FÜR DIE INTEGRATION VON RELIGIOSITÄT IN DIE THERAPEUTISCHE BEHANDLUNG
- Allgemeines
- Indikationen
- Klientel
- Die Behandlung
- Behandlungsverfahren
- Qualitätssicherung
- Schlussfolgerung
- FAZIT
- RESSOURCENERSCHLIEBUNG
- DIE KIRCHENGEMEINDE ALS RESSOURCE
- Voraussetzungen
- Multipolarität statt Unipolarität
- Konstruktiver Umgang mit leidvollen Erfahrungen
- Abkehr vom Perfektionismus
- Präventionsmöglichkeiten
- Primäre Prävention
- Sekundäre Prävention
- Tertiäre Prävention
- EXKURS: DIE SEELSORGE
- GRENZEN KIRCHLICHER HILFE
- INTERDISZIPLINÄRE ZUSAMMENARBEIT VON KIRCHENGEMEINDE UND PSYCHOSOZIALEN EINRICHTUNGEN ZUM WOHL PSYCHISCH KRANKER
- AUSGANGSSITUATION
- PRAKTISCHE UMSETZUNG EINER ZUSAMMENARBEIT
- FAZIT
- ZUSAMMENFASSUNG
- AUSWERTUNG
- ABSCHLIEBENDES RESÜMEE
- Korrelation von Religiosität und psychischer Gesundheit
- Neurosenlehre und ihre Charakteristika
- Entstehung des Begriffs der „ekklesiogenen Neurose“ und Kritik daran
- Ursachen religiös bedingter Lebenskonflikte
- Interventionsmöglichkeiten und Integration von Religiosität in Beratung und Therapie
- Einleitung: Die Arbeit führt in das Thema „ekklesiogene Neurosen“ ein und definiert die Fragestellung sowie den Aufbau der Arbeit.
- Hintergründe und Zusammenhänge des Begriffs der „ekklesiogenen Neurose“: Dieses Kapitel beleuchtet die Korrelation von Religiosität und psychischer Gesundheit, erklärt die Etymologie des Begriffs „Religiosität“ und skizziert die Merkmale einer Neurose.
- Entstehungsursachen religiös bedingter Lebenskonflikte: Dieses Kapitel analysiert die wesentlichen Merkmale eines neurotischen Konfliktes und untersucht verschiedene Konfliktsbereiche im Spannungsfeld von Neurose und Religiosität, wie familiäre Prägung versus Selbstverantwortung, kirchliche Morallehre versus persönlicher christlicher Freiheit und generelle neurotische Konflikthaftigkeit.
- Interventionsmöglichkeiten: Das Kapitel beleuchtet die Situation der Betroffenen, definiert elementare Ziele für die Wiederherstellung der psychischen Gesundheit und erläutert Möglichkeiten der Zielerreichung. Es werden dabei die Rolle der religiösen Passung von Therapeut und Klient und die Integration von Religiosität in Beratung und Therapie betrachtet. Außerdem wird das Konzept der De'ignis – Fachklinik für christliche Psychiatrie und Psychosomatik als Modell für die Integration von Religiosität in die therapeutische Behandlung vorgestellt.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit dem Phänomen der „ekklesiogenen Neurosen“, also religiös bedingten Lebenskonflikten. Ziel der Arbeit ist es, dieses Phänomen kritisch zu analysieren und Interventionsmöglichkeiten für betroffene Personen aufzuzeigen.
Zusammenfassung der Kapitel
Schlüsselwörter
Religiosität, psychische Gesundheit, Neurose, Ekklesiogene Neurose, Lebenskonflikte, Interventionen, Beratung, Therapie, Spiritualität, De'ignis, Kirche, Gemeinde, Seelsorge, Interdisziplinäre Zusammenarbeit.
- Quote paper
- Melanie Vita (Author), 2002, Das Phänomen der "ekklesiogenen Neurosen" - eine kritische Analyse religiös bedingter Lebenskonflikte und ihre Interventionsmöglichkeiten, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/27406