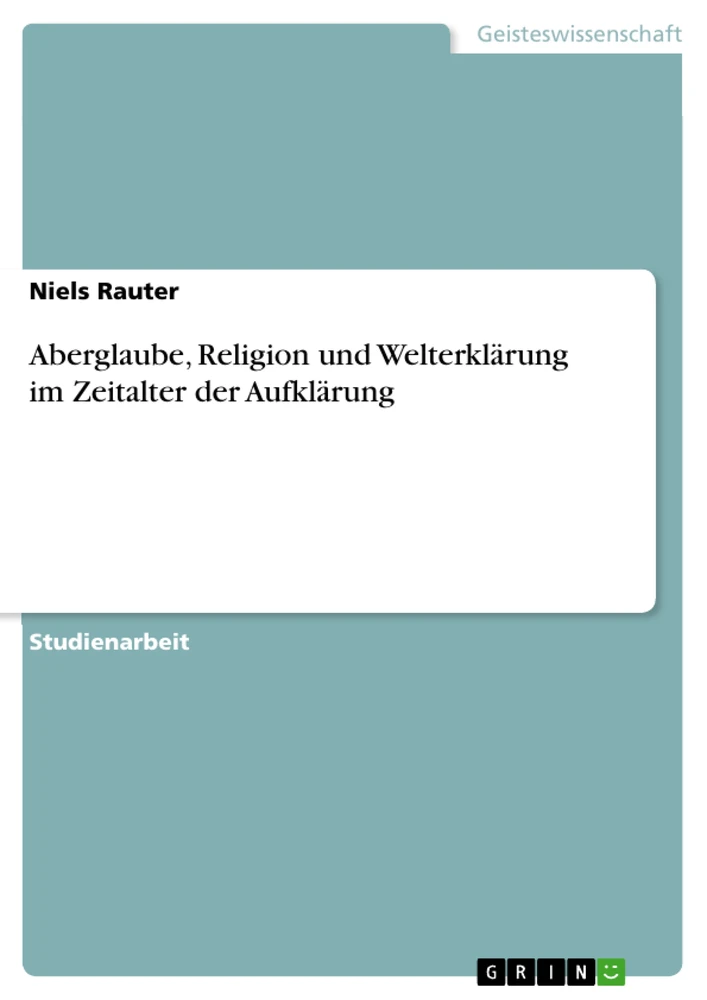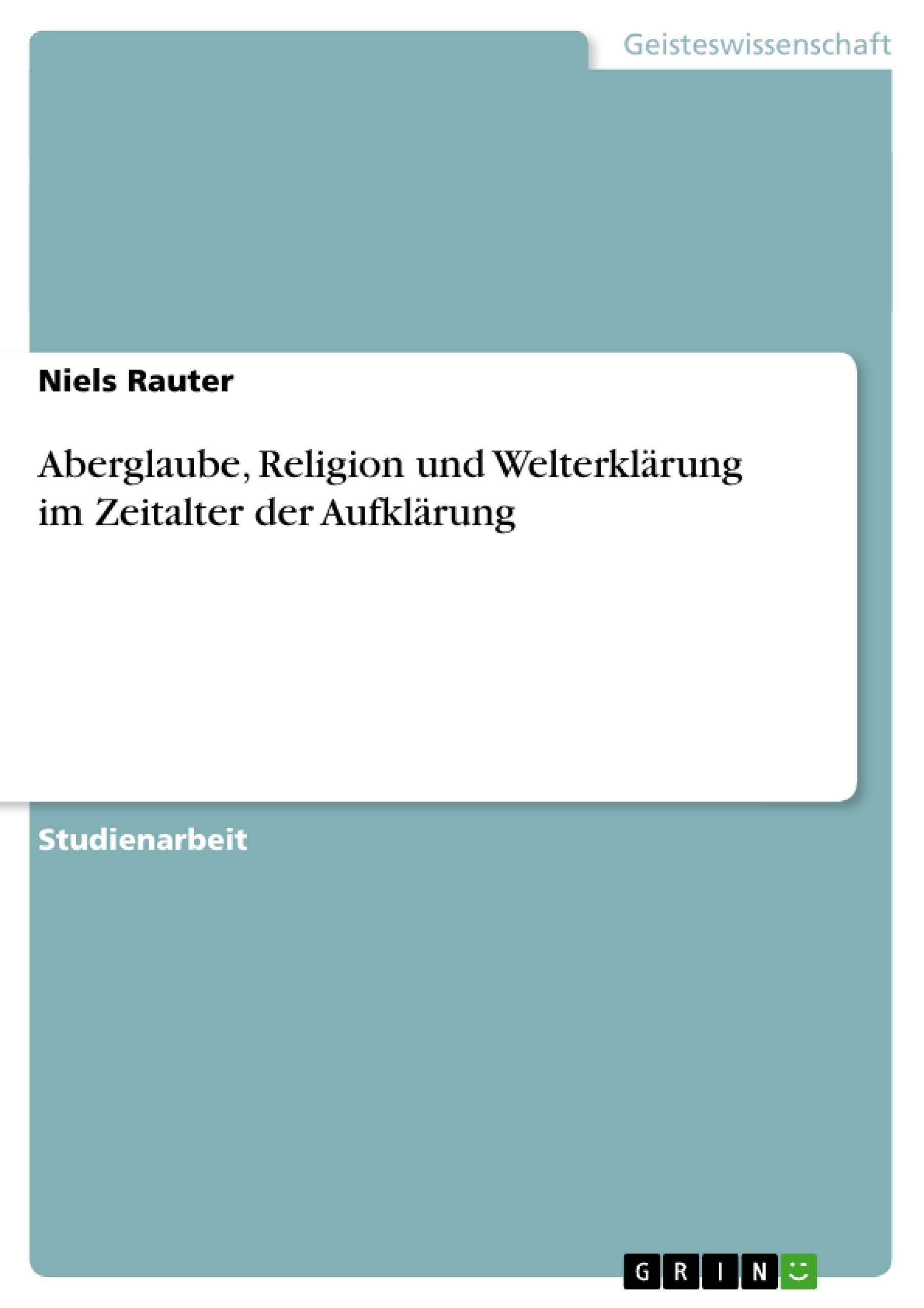Diese Arbeit befasst sich mit Aberglauben und Religion und ihren Einflüssen auf die Welterklärung der Menschen zur Zeit der Aufklärung.
Besonderes Augenmerk gilt dabei der Frage, ob die deutschen Aufklärer mit ihrem Drang alles Unerklärliche logisch zu ergründen und absolut rational und vernünftig zu behandeln, den Glauben und damit die Religion ebenfalls als eine Art des Aberglauben verstanden haben und ob sie versuchen wollten, diese durch Logik und Naturwissenschaften zu erklären, beziehungsweise zu durchschauen oder ob sie die Religion möglicherweise sogar komplett ablehnten und bekämpften.
Um den Einstieg in das Thema zu erleichtern, gehen der eigentlichen Arbeit mehrere Definitionen des Begriffes Aberglauben voraus. Der darauf folgende Hauptteil beinhaltet eine Darstellung des Umgangs mit dem Aberglauben sowie der Religionskritik durch die Aufklärung. Der letzte Teil der Arbeit zieht ein Fazit aus den vorangegangenen Abschnitten und versucht, die Fragestellung zufriedenstellend zu beantworten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Erläuterung des Begriffs: „Aberglaube“
- Aberglaube, Religion und ihr Einfluss auf die Welterklärung im Zeitalter der Aufklärung
- Umgang mit dem Aberglauben in der Zeit der Aufklärung
- Religionskritik durch die Aufklärung
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht den Umgang mit Aberglaube und Religion während der Aufklärungsepoche. Sie beleuchtet, wie die Aufklärer mit dem Drang zur Rationalität und Vernunft versuchten, die Welt zu erklären und wie sich diese Denkweise auf den Umgang mit Glauben und Religion auswirkte. Ein zentrales Anliegen ist die Beantwortung der Frage, ob die Aufklärung Religion als eine Form von Aberglaube verstand und sie mit Logik und Naturwissenschaften zu erklären versuchte oder ob sie diese sogar ablehnte und bekämpfte.
- Definition und Abgrenzung des Begriffs „Aberglaube“
- Der Umgang mit Aberglaube in der Zeit der Aufklärung
- Die Religionskritik durch die Aufklärung
- Die Rolle von Vernunft und Rationalität in der Aufklärung
- Der Einfluss von Aberglaube und Religion auf die Welterklärung
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt das Thema der Arbeit vor und erläutert die Zielsetzung sowie den Aufbau der Arbeit. Sie bettet die Thematik in den Kontext der Aufklärungsepoche ein und beleuchtet die Grundideen dieser Zeit, die stark von Rationalität, Vernunft und Naturwissenschaften geprägt war.
- Das zweite Kapitel widmet sich der Erläuterung des Begriffs „Aberglaube“. Es beleuchtet verschiedene Definitionen und zeigt die Vielschichtigkeit des Begriffs auf. Der Aberglaube wird als Restform des Heidentums verstanden, der aus den Relikten untergegangener Religionen und Mythenwelten entstanden ist. Er umfasst sowohl Schutz- und Abwehrhandlungen als auch Flüche, Heilzauber und Zukunftsdeutung. Des Weiteren wird die Abgrenzung des Aberglaubens zum Glauben im religiösen Sinn diskutiert.
- Kapitel 3 befasst sich mit dem Umgang mit Aberglaube und Religion in der Zeit der Aufklärung. Es untersucht die Kritik an Aberglaube und Vorurteilen sowie die Auseinandersetzung mit der Religion in dieser Epoche. Der Fokus liegt auf dem Einfluss von Vernunft und Rationalität auf den Umgang mit dem Unerklärlichen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt zentrale Schlüsselwörter wie Aberglaube, Religion, Aufklärung, Vernunft, Rationalität, Welterklärung, Kritik, Vorurteile, Religionskritik, und Naturwissenschaften. Sie fokussiert auf die Auseinandersetzung mit dem Unerklärlichen und die Bedeutung der Vernunft in der Erklärung der Welt.
- Quote paper
- Niels Rauter (Author), 2012, Aberglaube, Religion und Welterklärung im Zeitalter der Aufklärung, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/273845