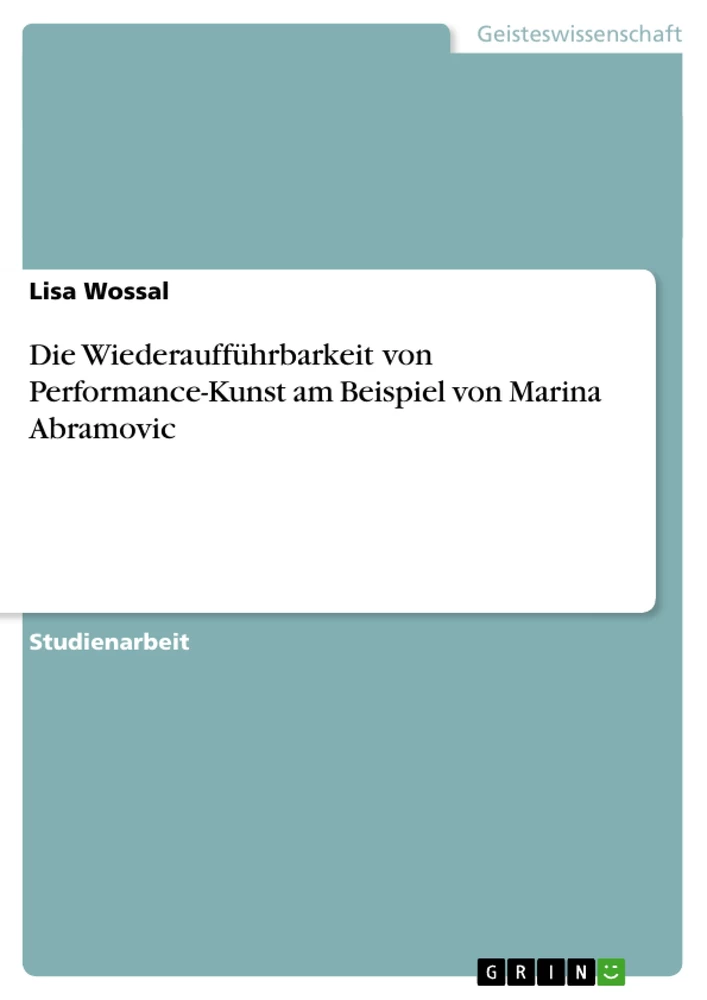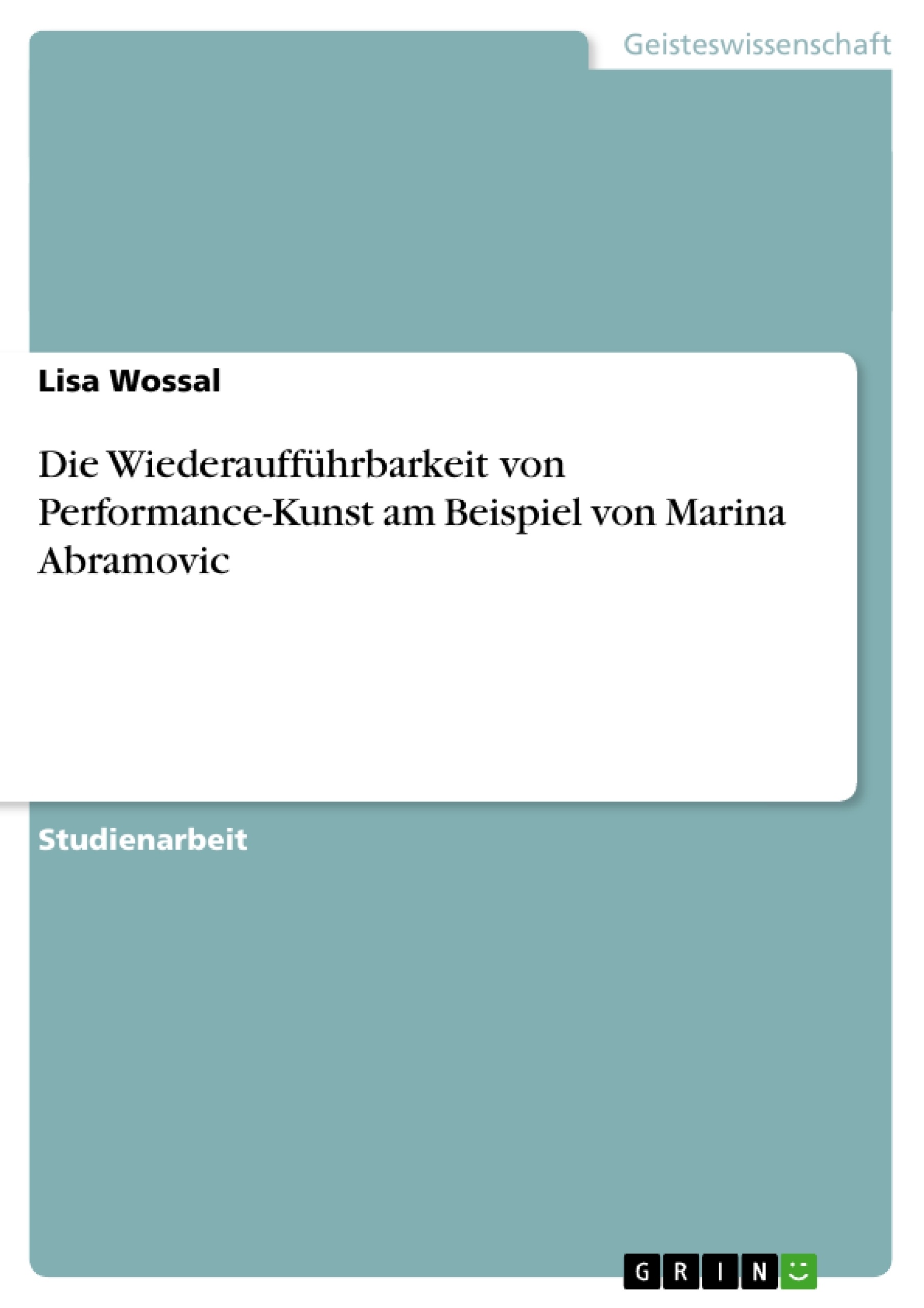„Performances only life is in the present“
Wie hier mit den Worten der Performance-Theoretikerin Peggy Phelan wird oft das Wesen, das Hauptmerkmal der Performance Kunst beschrieben. Die Definitionen erklären sie als situationsbezogene, mit Schwerpunkt auf Handlung und Aktion gelegte, vergängliche Darstellung. Das würde bedeuten, dass die Darbietung tatsächlich nur zu dem Zeitpunkt der Aufführung besteht, und auch nur für Publikum, das direkt anwesend ist. Um diese zeitliche und örtliche Begrenzung aufzuheben, wird immer wieder versucht Wege zu finden, um die Performance „weiterleben“ zu lassen, sie zu transportieren zu einem anderen Ort, einem späteren Zeitpunkt, vor ein anderes Publikum. Eine Möglichkeit dafür ist die Wiederausstellung durch Dokumentationen. Das bedeutet aber bei den meisten Werken eine Überführung in andere Medien, die Überführung der momentanen Aktionen eines Menschen in Video, Fotografien, Sound oder ähnlichem. Damit vollzieht sich eine grundlegende Veränderung, die sich auch auf die Bedeutung des Stückes und auf den Eindruck des Betrachters ausweiten kann. Für James Westcott ist diese Art der Dokumentation für eine Wiederausstellung durchaus möglich, jedoch sollte dabei auf das Missverhältnis und auf die Unterschiedlichkeit zwischen der ursprünglichen Performance und dem später ausgestelltem Medium hingewiesen werden. Mit einem anderen Medium wird das Kunstwerk nicht wieder ausgestellt, wie ein Gemälde, welches in Italien gemalt wurde und später in einem französischen Museum hängt (obwohl sich hierbei natürlich auch ein Bedeutungswandel vollziehen kann), sondern lediglich die Dokumentation eines Kunstwerks wird gezeigt. (...)
Eine zweite Möglichkeit bietet dann die Wiederaufführung, die Reperformance, wobei man diese noch einmal aufspalten kann in die Wiederaufführung durch den ursprünglichen Künstler und in die Wiederholung durch andere Künstler. Da die Bedeutung einer Performance oft aus der Situation heraus entsteht und auch stark von der Person des Künstlers abhängig ist, muss bei der Reperformance jede Änderung dieser Aspekte in der Erfassung des Stückes mit betrachtet werden. Auch die Frage nach Original oder Kopie kommt dabei schnell auf. (...)
Als eine große Verfechterin der Reperformance gilt Marina Abramović, an deren Beispiel ich mich in dieser Arbeit dem Thema nähern möchte.
Inhaltsverzeichnis
- 1. „Performances only life is in the present“
- 2. Marina Abramović und die Reperformance
- 2.1 Der Einfluss des Publikums
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Thematik der Reperformance in der Performancekunst, insbesondere am Beispiel von Marina Abramović. Die Zielsetzung besteht darin, die Herausforderungen und Möglichkeiten der Wiederaufführung vergänglicher Kunstformen zu beleuchten und die Bedeutung des Publikums und der veränderten Kontextualisierung zu analysieren.
- Die Definition und Charakteristika von Performancekunst
- Die Problematik der Dokumentation und Archivierung von Performance
- Die Reperformance als Strategie zur Bewahrung und Weitergabe von Performancekunst
- Der Einfluss des Publikums auf die Interpretation und Bedeutung der Performance
- Der Vergleich zwischen Originalperformance und Reperformance
Zusammenfassung der Kapitel
1. „Performances only life is in the present“: Der einführende Abschnitt beschreibt die ephemeren Eigenschaften von Performancekunst, die nur im Moment der Aufführung existiert. Er thematisiert den Versuch, diese Vergänglichkeit durch Dokumentation (Video, Fotografie, etc.) oder Reperformance zu überwinden. Die Arbeit von James Westcott wird zitiert, der auf das Missverhältnis zwischen Original und Dokumentation hinweist. Die unterschiedlichen Strategien von Künstlern – die Dokumentation in die Arbeit zu integrieren oder die Vergänglichkeit als zentrales Element zu nutzen – werden beleuchtet. Die Frage nach der Möglichkeit und den Grenzen der Bewahrung von Performance wird aufgeworfen.
2. Marina Abramović und die Reperformance: Dieses Kapitel fokussiert auf Marina Abramović als zentrale Figur der Reperformance-Debatte. Es wird Abramović’ Engagement für die Reperformance ihrer eigenen Werke und die von anderen Künstlern (z.B. „Seven Easy Pieces“) dargestellt. Die Bedeutung der Kommunikation und Erlaubnis des ursprünglichen Künstlers bei der Reperformance wird betont. Der Kapitel analysiert die tiefgreifenden Veränderungen, die bei der Reperformance entstehen, die von der räumlichen Umgebung bis zur Interpretation des Werkes durch die Künstlerin und das Publikum reichen. Das Beispiel von Bruce Naumans „Body Pressure“ veranschaulicht, wie sich die Bedeutung eines Werkes durch den Kontext der Reperformance grundlegend wandeln kann. Die Rolle des Publikums bei der Veränderung der Performance wird hervorgehoben.
2.1 Der Einfluss des Publikums: Dieser Unterabschnitt vertieft die Rolle des Publikums als integraler Bestandteil von Performancekunst. Die Aussage von Marina Abramović, dass Publikum und Performer untrennbar sind, wird zitiert und bildet die Grundlage für die Argumentation. Es wird diskutiert, wie die Einmaligkeit der Performance durch Wiederholungen verloren gehen kann, und welche Rolle die Authentizität spielt. Die Performance-Gruppe „The artist is absent“ wird erwähnt. Die Arbeiten „Imponderabilia“ und „Rythm 0“ von Abramović dienen als Beispiele für die direkte und indirekte Beteiligung des Publikums und den damit verbundenen Herausforderungen und unterschiedlichen Interpretationen. Die Ablehnung von „Rythm 0“ durch das Guggenheim Museum bei der "Seven Easy Pieces"-Reihe veranschaulicht den Unterschied zwischen Original- und Reperformances in Bezug auf Risiko und öffentliche Wahrnehmung.
Schlüsselwörter
Performancekunst, Reperformance, Marina Abramović, Dokumentation, Vergänglichkeit, Publikum, Authentizität, Originalität, Kontextualisierung, „Seven Easy Pieces“, Bedeutungswandel.
Häufig gestellte Fragen zu: Reperformance in der Performancekunst am Beispiel Marina Abramović
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Reperformance in der Performancekunst, insbesondere am Beispiel von Marina Abramović. Sie beleuchtet die Herausforderungen und Möglichkeiten der Wiederaufführung vergänglicher Kunstformen und analysiert die Bedeutung des Publikums und der veränderten Kontextualisierung.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Definition und Charakteristika von Performancekunst, die Problematik der Dokumentation und Archivierung, die Reperformance als Bewahrungsstrategie, den Einfluss des Publikums auf Interpretation und Bedeutung, und den Vergleich zwischen Originalperformance und Reperformance. Spezifische Beispiele wie Marina Abramović's "Seven Easy Pieces" und Bruce Naumans "Body Pressure" werden analysiert.
Welche Rolle spielt Marina Abramović in dieser Arbeit?
Marina Abramović dient als zentrale Fallstudie. Ihre Auseinandersetzung mit der Reperformance ihrer eigenen und der Werke anderer Künstler wird detailliert untersucht. Ihre Ansichten über die untrennbare Verbindung von Performer und Publikum bilden einen wichtigen Bestandteil der Argumentation.
Wie wird die Bedeutung des Publikums behandelt?
Die Arbeit betont die essentielle Rolle des Publikums in der Performancekunst. Es wird analysiert, wie die Einmaligkeit einer Performance durch Wiederholungen verloren gehen kann und wie das Publikum die Interpretation und Bedeutung der Werke beeinflusst. Die unterschiedlichen Reaktionen auf Abramović's "Rhythm 0" im Original und in der Reperformance werden als Beispiel herangezogen.
Welche Problematik der Dokumentation und Archivierung wird angesprochen?
Die Arbeit thematisiert die ephemeren Eigenschaften von Performancekunst und die Schwierigkeiten, diese Vergänglichkeit durch Dokumentation (Video, Fotografie etc.) zu überwinden. Das Missverhältnis zwischen Original und Dokumentation, sowie unterschiedliche Strategien von Künstlern im Umgang mit dieser Problematik werden diskutiert.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es darin?
Kapitel 1 befasst sich mit der Vergänglichkeit von Performancekunst und den Versuchen, diese durch Dokumentation oder Reperformance zu bewältigen. Kapitel 2 konzentriert sich auf Marina Abramović und ihre Arbeit mit Reperformances, inklusive der Analyse von Kontextveränderungen und der Bedeutung der Zustimmung des ursprünglichen Künstlers. Kapitel 2.1 vertieft den Einfluss des Publikums auf die Interpretation und Bedeutung von Reperformances.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Performancekunst, Reperformance, Marina Abramović, Dokumentation, Vergänglichkeit, Publikum, Authentizität, Originalität, Kontextualisierung, „Seven Easy Pieces“, Bedeutungswandel.
- Quote paper
- Lisa Wossal (Author), 2014, Die Wiederaufführbarkeit von Performance-Kunst am Beispiel von Marina Abramovic, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/273698