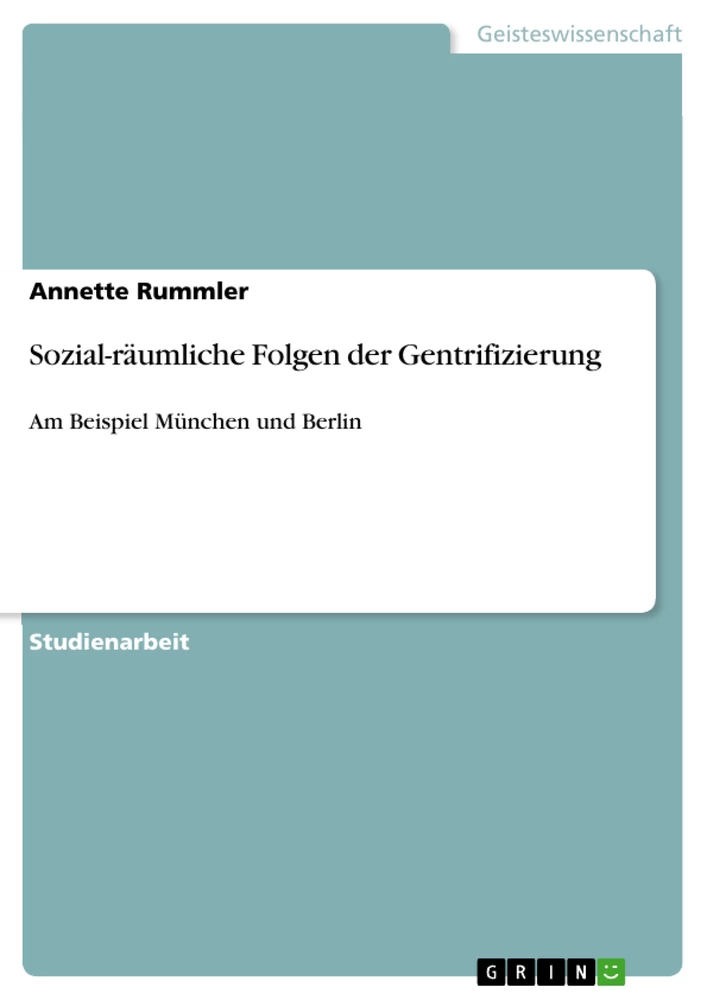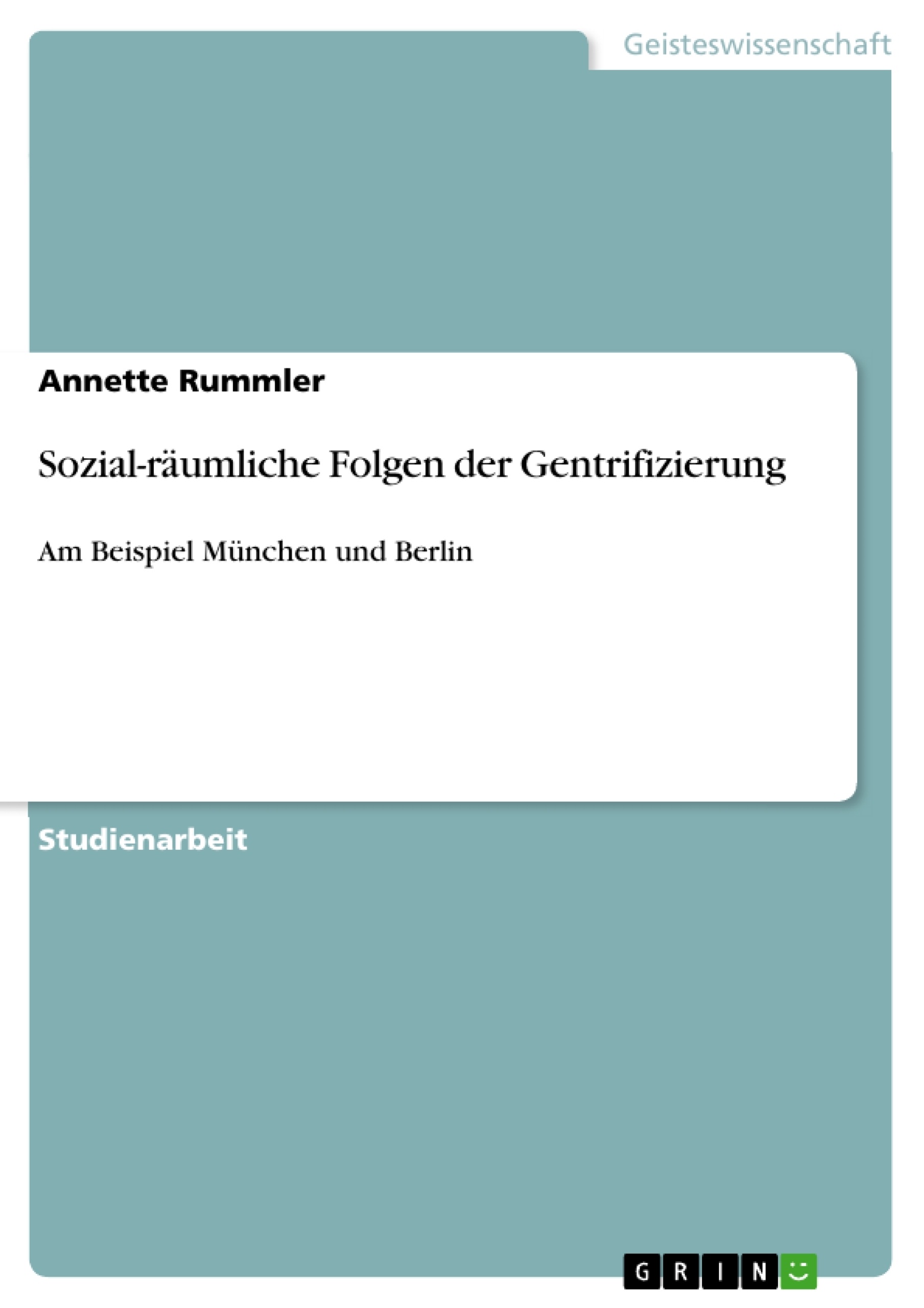Segregationsprozesse bestimmen die Stadtplanung unserer heutigen Zeit ganz wesentlich und spielen insofern eine große Rolle, als sie das Erscheinungsbild der Stadt sowohl nach innen als auch nach außen auf eine spezielle Art und Weise prägen. Das Ziel ist es, diese Segregation anhand städtischer und staatlicher Maßnahmen zu vermeiden, jedoch war das nicht immer so. Die Ausgrenzung bestimmter Gruppen wurde früher bewusst in Kauf genommen. Deshalb ist es heute, in einer kapitalistisch orientierten Gesellschaft, nur schwer möglich, eine weitere Verschärfung der sozialen sowie räumlichen Fragmentierung armer und einkommensschwacher Personen zu verhindern. Die Ausgrenzung benachteiligter Gruppen kann auf die unterschiedlichsten Arten vollzogen werden, eine davon ist die graduelle Aufwertung innenstadtnaher Arbeiterwohngebiete. Dies wird im Fachjargon durch den Begriff der „Gentrifizierung“ zum Ausdruck gebracht. Der Prozess der Gentrifizierung ist mannigfaltig und verläuft nicht immer nach einem bestimmten Schema. So haben sich im Laufe der Zeit auch die unterschiedlichsten Definitionen für die Aufwertung etablieren können. Ruth Glass hat als erste den Begriff der „Gentrifizierung“ (engl. gentrification) 1964 in Bezug auf London eingeführt und verstand folgendes darunter:
„One by one, many of the working class quarters of London have been invaded by the middle classes - upper and lower – shabby modest mews and cottages ... have been taken over when their leases expired, and have become elegant, expensive residences. Larger Victorian houses, downgraded in an earlier or recent period - which were used as lodging houses or were otherwise in multiple occupation - have been upgraded once again” (BLASIUS, 2008 S.857).
Ruth Glass bezog sich mit dem Begriff der „gentrification“ auf das englische Wort „gentry“, was soviel bedeutet wie „niederer Adel“ „[...] und bezeichnet damit ironisch die neuen Bewohner am Ort“ (BORSDORF & BENDER, 2010, S.220).
Viele weitere Definitionen beziehen sich meist nur auf die bauliche Aufwertung bestimmter Stadtteile, eine für die Stadtsoziologie durchaus wichtige von Helbrecht stammt aus dem Jahre 1996.
„Unter Gentrification versteht man einen stadtteilbezogenen Aufwertungsprozess, der auf der Verdrängung unterer Einkommensgruppen durch den Zuzug wohlhabenderer Schichten basiert und zu Qualitätsverbesserungen im Gebäudebestand führt“ (HEINEBERG, 2006, S.18).
Inhaltsverzeichnis
- Segregation - Problemfeld der Stadtplanung
- Gentrifizierung als soziologische Kategorie
- Der Prozess und die Folgen der Gentrifizierung
- Invasions-Sukzessions-Zyklus
- Gentrifizierungs-Modell
- Gründe der Gentrifizierung
- Alternative Gentrifizierungs-Ansätze
- Theorie der Grundrentendifferenz („rent gap“)
- Theorie der Wertdifferenz („value gap“)
- Mögliche Folgen der Gentrifizierung
- Stadtpolitische Gegenmaßnahme: Erhaltungssatzung
- Der Prozess und die Folgen der Gentrifizierung
- Diskussion der empirischen Befunde
- Beispiel München
- Beispiel Berlin
- Zur Erklärungsreichweite dieses Konzepts
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die sozial-räumlichen Folgen der Gentrifizierung. Ziel ist es, den Prozess der Gentrifizierung als soziologische Kategorie zu analysieren und seine Auswirkungen auf verschiedene Stadtteile zu beleuchten. Dabei werden verschiedene Theorien und empirische Beispiele herangezogen.
- Segregation als Problem der Stadtplanung
- Der Prozess der Gentrifizierung und seine verschiedenen Phasen
- Theorien zur Erklärung von Gentrifizierung (z.B. „rent gap“, „value gap“)
- Folgen der Gentrifizierung für die betroffene Bevölkerung
- Stadtpolitische Maßnahmen zur Bekämpfung der negativen Folgen der Gentrifizierung
Zusammenfassung der Kapitel
Segregation - Problemfeld der Stadtplanung: Dieser Abschnitt führt in das Thema Segregation als grundlegendes Problem der Stadtplanung ein. Er beschreibt, wie Segregation das Erscheinungsbild von Städten prägt und wie die Ausgrenzung bestimmter Bevölkerungsgruppen, insbesondere in kapitalistischen Gesellschaften, zu einer sozialen und räumlichen Fragmentierung führt. Die graduelle Aufwertung innerstädtischer Arbeiterwohngebiete durch Gentrifizierung wird als eine Form dieser Ausgrenzung identifiziert und als komplexer Prozess dargestellt, der unterschiedliche Definitionen und Ausprägungen aufweist. Der Begriff der Gentrifizierung wird historisch kontextualisiert und unterschiedliche Definitionen werden vorgestellt, beginnend mit Ruth Glass' ursprünglicher Beschreibung des Phänomens in London.
Gentrifizierung als soziologische Kategorie: Dieses Kapitel betrachtet Gentrifizierung als einen besonderen Aspekt der Reurbanisierung, bei dem wohlhabende Bevölkerungsgruppen in innerstädtische Gebiete zurückkehren und einkommensschwächere Bewohner verdrängen. Es wird hervorgehoben, dass die Anpassung von Wohnungen an die Bedürfnisse der Zugezogenen, oft durch bauliche Aufwertung, eine Folge und Voraussetzung dieses Prozesses ist. Der Verdrängungsprozess wird idealtypisch als doppelter Invasions-Sukzessions-Zyklus beschrieben, der in seinen einzelnen Phasen detailliert untersucht wird. Der Abschnitt betont die Vielfältigkeit des Gentrifizierungsprozesses und seine unterschiedlichen Auswirkungen in verschiedenen Quartieren.
Schlüsselwörter
Gentrifizierung, Segregation, Stadtplanung, Reurbanisierung, sozial-räumliche Folgen, Verdrängung, Invasions-Sukzessions-Zyklus, „rent gap“, „value gap“, Stadtpolitische Maßnahmen, Erhaltungssatzung, München, Berlin.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Text: Gentrifizierung und Segregation
Was ist der Hauptfokus des Textes?
Der Text analysiert die sozial-räumlichen Folgen der Gentrifizierung. Er untersucht den Prozess der Gentrifizierung als soziologische Kategorie und beleuchtet seine Auswirkungen auf verschiedene Stadtteile, unter Einbezug verschiedener Theorien und empirischer Beispiele aus München und Berlin.
Welche Themen werden im Text behandelt?
Der Text behandelt Segregation als Problem der Stadtplanung, den Prozess der Gentrifizierung in seinen verschiedenen Phasen, Theorien zur Erklärung von Gentrifizierung (wie „rent gap“ und „value gap“), die Folgen der Gentrifizierung für die betroffene Bevölkerung und stadtpolitische Maßnahmen zur Bekämpfung negativer Folgen. Es werden auch konkrete Beispiele aus München und Berlin analysiert.
Wie wird Gentrifizierung im Text definiert und erklärt?
Gentrifizierung wird als ein Aspekt der Reurbanisierung beschrieben, bei dem wohlhabende Bevölkerungsgruppen in innerstädtische Gebiete zurückkehren und einkommensschwächere Bewohner verdrängen. Der Prozess wird idealtypisch als doppelter Invasions-Sukzessions-Zyklus dargestellt und mit verschiedenen Theorien, wie der Theorie der Grundrentendifferenz („rent gap“) und der Theorie der Wertdifferenz („value gap“), erklärt. Der Text betont die Vielfältigkeit des Prozesses und seine unterschiedlichen Auswirkungen.
Welche Theorien werden zur Erklärung der Gentrifizierung herangezogen?
Der Text bezieht sich auf die Theorie der Grundrentendifferenz („rent gap“) und die Theorie der Wertdifferenz („value gap“) um den Prozess der Gentrifizierung zu erklären. Diese Theorien versuchen die wirtschaftlichen Triebkräfte hinter der Aufwertung von Stadtteilen zu beleuchten.
Welche Folgen der Gentrifizierung werden im Text beschrieben?
Der Text beschreibt die Verdrängung einkommensschwächerer Bevölkerungsgruppen als zentrale Folge der Gentrifizierung. Weitere Folgen werden im Zusammenhang mit sozialen und räumlichen Veränderungen der Stadtteile thematisiert. Der Text analysiert auch die Auswirkungen auf die soziale Struktur und die städtische Landschaft.
Welche stadtpolitischen Maßnahmen werden im Text diskutiert?
Als stadtpolitische Gegenmaßnahme wird die Erhaltungssatzung genannt, die dazu dient, negative Folgen der Gentrifizierung zu bekämpfen und den sozialen Wohnungsbau zu sichern.
Welche Städte werden als empirische Beispiele herangezogen?
Der Text nutzt München und Berlin als empirische Beispiele, um die beschriebenen Prozesse und Folgen der Gentrifizierung zu illustrieren und zu konkretisieren.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Text?
Schlüsselwörter sind: Gentrifizierung, Segregation, Stadtplanung, Reurbanisierung, sozial-räumliche Folgen, Verdrängung, Invasions-Sukzessions-Zyklus, „rent gap“, „value gap“, Stadtpolitische Maßnahmen, Erhaltungssatzung, München, Berlin.
Wie ist der Text aufgebaut?
Der Text ist in mehrere Abschnitte gegliedert: Inhaltsverzeichnis, Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselwörter. Diese Struktur ermöglicht einen schnellen Überblick über die wichtigsten Inhalte und Themen des Textes.
- Quote paper
- Annette Rummler (Author), 2013, Sozial-räumliche Folgen der Gentrifizierung, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/273658