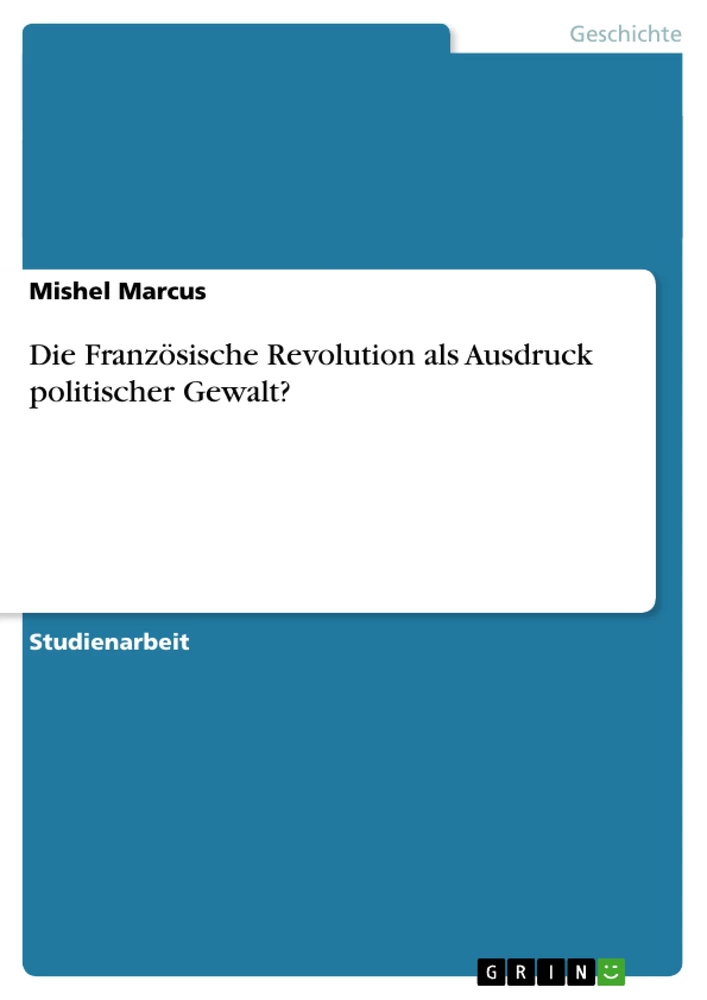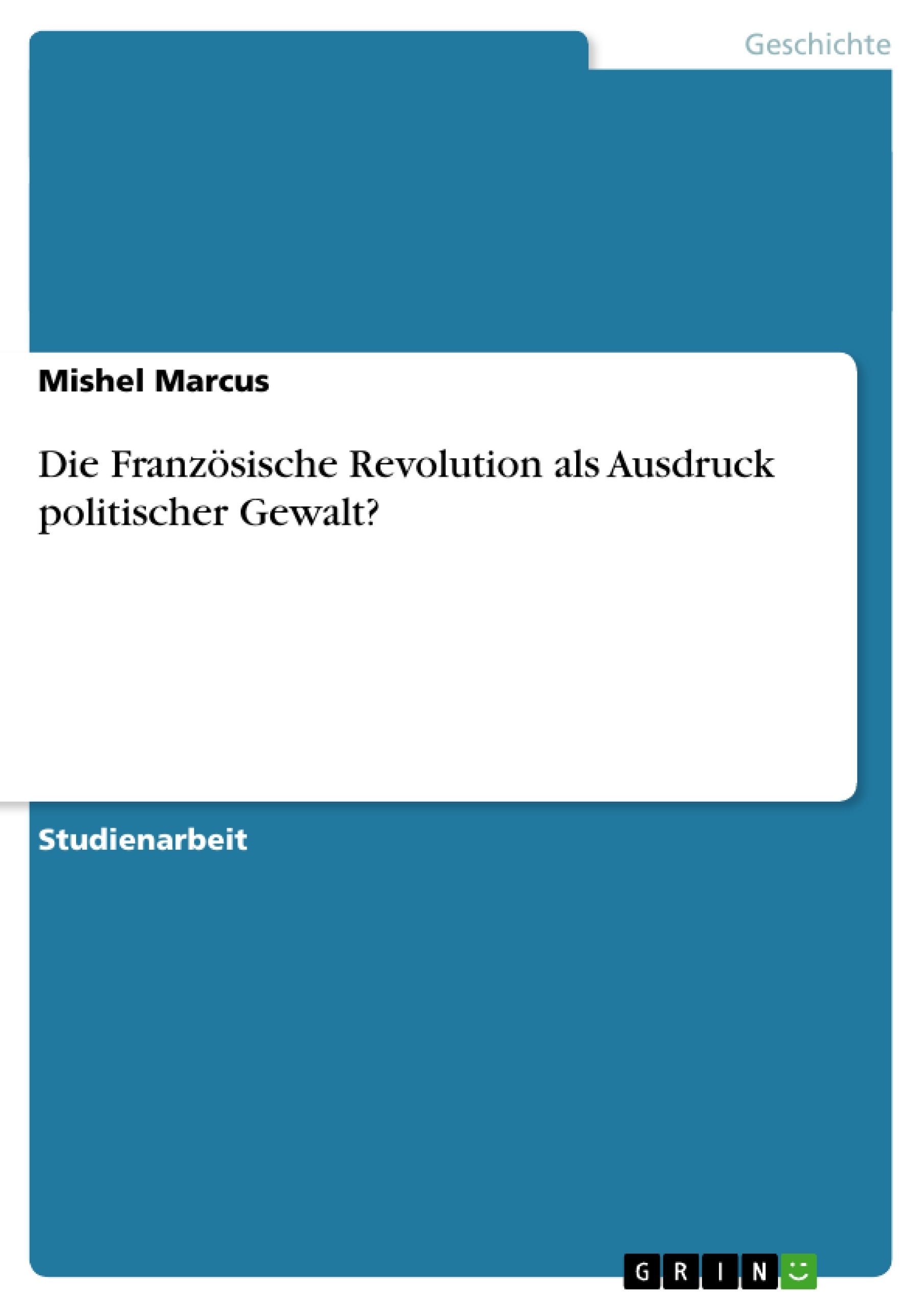Der Historiker Hans-Ulrich Thamer bezeichnete einst die Französische Revolution als „Laboratorium der Moderne“, indem diese einen wichtigen Prozess der Politisierung der Gesellschaft auslöste und damit den Durchbruch zur politischen Freiheit erkämpfte. Die Revolution setzte zwar enorme gesellschaftliche und politische Gestaltungsmöglichkeiten frei, aber sie führte nicht unbedingt in eine neue, in sich stabile Ordnung. Das von den Verfassungsstiftern in der Nationalversammlung anfangs als kompaktes Neugestaltungsprogramm konzipiert, erwies sich in Verbindung mit dem revolutionären Prozess als ein höchst komplexes Unterfangen, das die rationale Gestaltungskraft zunehmend überforderte und bald außer Kontrolle geriet .
In diesem Zusammenhang soll im Folgenden anhand des Forschungsansatzes des französischen Historikers François Furet untersucht werden, ob in den Ideen von 1789 das „Abgleiten“ (dérapage) der Revolution in politische Gewalt und in eine systematische Politik der Schreckensherrschaft bereits angelegt war. Anders als die sozialistisch-marxistischen Forscher (u.a. A. Mathiez, G. Lefebvre, A. Soboul, W. Markov), die die Französische Revolution im Sinne des historischen Materialismus als das Ergebnis eines Klassenkampfes interpretieren, liegt das Hauptaugenmerk von François Furet auf der Erforschung der Sozial- und Wirtschaftsgeschichte . Als Eckdaten gelten die Jahre 1789 bis 1799.
Die vorliegende Arbeit soll zuerst die Ursachen der Französischen Revolution beleuchten. Dem schließen sich die konkreten Abläufe der Revolution bei den Generalständen in Versailles, der Stadtbevölkerung in Paris und bei den Provinzstädten sowie den Bauern auf dem Land an. Im weiteren Verlauf sollen die Auswirkungen der politischen Radikalisierung ab 1791 thematisiert werden. Im letzten Abschnitt wird das Ergebnis der vorliegenden Hausarbeit in einem Fazit zusammengefasst.
1. Einleitung
Der Historiker Hans-Ulrich Thamer bezeichnete einst die Französische Revolution als „Laboratorium der Moderne“, indem diese einen wichtigen Prozess der Politisierung der Gesellschaft auslöste und damit den Durchbruch zur politischen Freiheit erkämpfte. Die Revolution setzte zwar enorme gesellschaftliche und politische Gestaltungsmöglichkeiten frei, aber sie führte nicht unbedingt in eine neue, in sich stabile Ordnung. Das von den Verfassungsstiftern in der Nationalversammlung anfangs als kompaktes Neugestaltungsprogramm konzipiert, erwies sich in Verbindung mit dem revolutionären Prozess als ein höchst komplexes Unterfangen, das die rationale Gestaltungskraft zunehmend überforderte und bald außer Kontrolle geriet[1].
In diesem Zusammenhang soll im Folgenden anhand des Forschungsansatzes des französischen Historikers François Furet untersucht werden, ob in den Ideen von 1789 das „Abgleiten“ (dérapage) der Revolution in politische Gewalt und in eine systematische Politik der Schreckensherrschaft bereits angelegt war. Anders als die sozialistisch-marxistischen Forscher (u.a. A. Mathiez, G. Lefebvre, A. Soboul, W. Markov), die die Französische Revolution im Sinne des historischen Materialismus als das Ergebnis eines Klassenkampfes interpretieren, liegt das Hauptaugenmerk von François Furet auf der Erforschung der Sozial- und Wirtschaftsgeschichte[2]. Als Eckdaten gelten die Jahre 1789 bis 1799.
Die vorliegende Arbeit soll zuerst die Ursachen der Französischen Revolution beleuchten. Dem schließen sich die konkreten Abläufe der Revolution bei den Generalständen in Versailles, der Stadtbevölkerung in Paris und bei den Provinzstädten sowie den Bauern auf dem Land an. Im weiteren Verlauf sollen die Auswirkungen der politischen Radikalisierung ab 1791 thematisiert werden. Im letzten Abschnitt wird das Ergebnis der vorliegenden Hausarbeit in einem Fazit zusammengefasst.
2. Die Krise des Ancien Régime
Als der Premierminister des Königs Ludwig XVI, Loménie de Brienne am 5. Juli 1787 die Einberufung von Generalständen ankündigte, die erstmals seit 1614 wieder zusammentreten sollten, konnte niemand die revolutionäre Dynamik vorhersehen. Positive Erwartungen daran knüpften aber vor allem die Mitglieder des Dritten Standes, die mehr als 95 % der Bevölkerung ausmachten. Die Generalstände waren im vorrevolutionären Frankreich die Versammlung der Vertreter aller Provinzen, die aus den Abgeordneten der Geistlichkeit, des Adels und des Dritten Standes bestand[3]. Der unmittelbare Anlass für die Einberufung der Generalstände lag sowohl in der prekären finanziellen Situation des absolutistischen Staates als auch in dem innenpolitischen Dauerkonflikt der Krone mit den Vertretungs- und Kontrollansprüchen der Parlamente. Der österreichische Erbfolgekrieg (1740-1748), der Siebenjährige Krieg (1756-1793) und schließlich die französische Intervention in den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg im Jahre 1778 hatten die französische Monarchie an den Rand des Bankrotts gebracht und die Erhebung neuer Steuern zu einer Notwendigkeit gemacht[4].
Der Staatsbankrott schien nur noch durch die Annullierung aller Steuerprivilegien vermeidbar zu sein und nun sollten auch die bislang steuerbefreiten, bevorzugten Stände des Adels und der Geistlichkeit betroffen sein, was wiederum ihre heftige Ablehnung hervorrief[5]. Die Aufhebung der Steuerprivilegien erwies sich jedoch als ein kompliziertes Unterfangen, da die adlig dominierten parléments, die für die Umsetzung von Gesetzen zuständig waren, ihre Unterstützung verweigerten. Um direkten Einfluss auf die Finanzgesetzgebung zu gewinnen, verweigerten sie jede Kooperation und forderten daraufhin die Einberufung der Generalstände.
Hier wird deutlich, dass die unmittelbare Vorgeschichte der Revolution als eine antiabsolutistische Adelsrevolution aufgefasst werden kann[6]. Die Reformkräfte im ökonomischen und sozialen aufstrebenden Bürgertum übernahmen die nachdrückliche Forderung der privilegierten Stände des Adels und des Klerus und gaben der Bewegung somit einen weitreichenden Charakter[7].
[...]
[1] Wolfgang Kruse: Die Französische Revolution, Paderborn 2005, S. 8. (im Folgenden zitiert als Kruse: Revolution)
[2] Lynn Hunt: Symbole der Macht. Macht der Symbole. Die Französische Revolution und der Entwurf einer politischen Kultur, Frankfurt am Main 1989.
[3] Hans-Ulrich Thamer: Die Französische Revolution, 3. Aufl., München 2009, S. 11f. (im Folgenden zitiert als Thamer: Revolution)
[4] Thamer: Revolution, S. 12f.
[5] Kruse: Revolution, S. 16.
[6] Kruse: Revolution, S. 17.
[7] Kruse: Revolution, S. 17.
- Quote paper
- Mishel Marcus (Author), 2013, Die Französische Revolution als Ausdruck politischer Gewalt?, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/273004