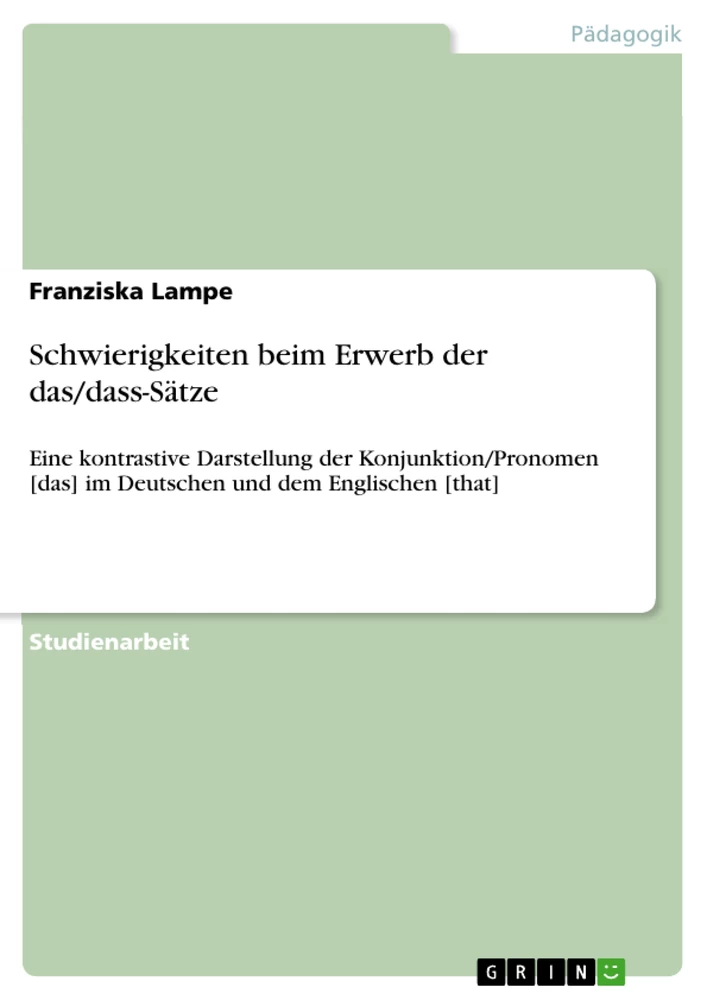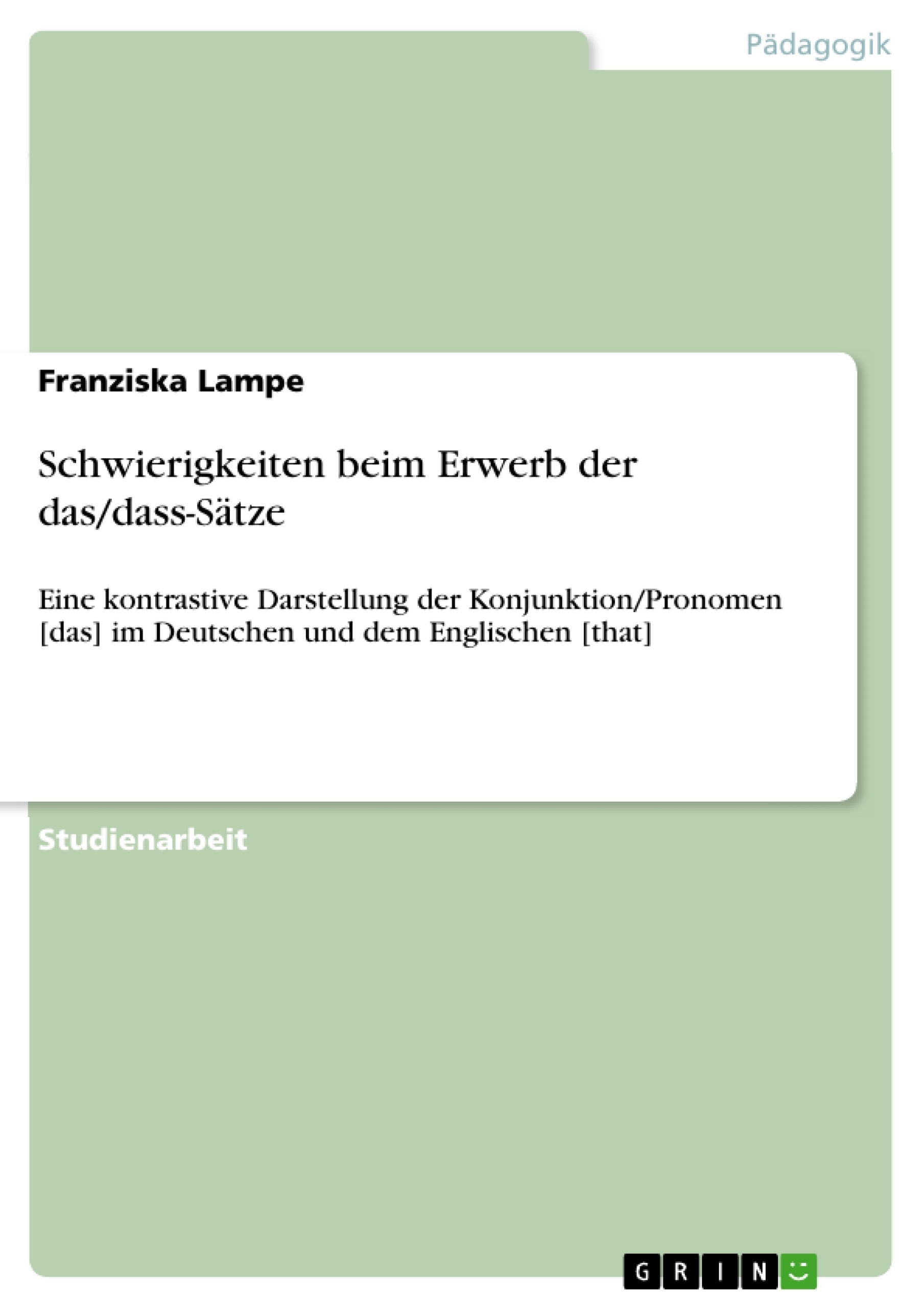In der vorliegenden Arbeit geht es um die dass Konjunktion sowie um das Pronomen das und welche Schwierigkeiten beim Schriftspracherwerb bei den Lernern vorkommen. Dazu wird eine Übersicht gegeben, über die Entwicklung der dass-Schreibung und warum es überhaupt eine orthographische Unterscheidung
zwischen Konjunktion und Pronomen gibt. Im zweiten Teil wird das Pronomen und die Konjunktion that aus dem Englischen kontrastiv dargestellt und die Funktion auch hinsichtlich der Kommatierung untersucht. Es soll veranschaulicht werden, wo Unterschiede, wo Parallelen zwischen dem Englischen und dem Deutschen sind und warum das Deutsche auch die Besonderheit der Doppelkonsonantenschreibung bei der Konjunktion nicht verzichten möchte.
Die eigenständigen dass/das-Formen haben sich aus einer ursprünglichen, rein deiktischen Form über verschiedene Grammatikalisierungsschritte gebildet, die dass-Konjunktion stellt die finale „Version“ dar. „Die Unterscheidungsschreibung von
Pronomen und Konjunktion ist...eines der ältesten [...] Mittel autonomgraphematischer, leserbezogener Differenzierungen in der deutschen Orthographie.“ (Munske 1993, 411 zit. in Feilke 2011, 345) Die Differenzierung von dass/das kann demnach also als Resümee dieser Entwicklung gesehen werden. Erste Belege einer regelhaften Schreibung sind nach Munske in Texten aus dem Jahr 1341 aufgetaucht und wurde 1607 in Wörterbüchern und Grammatiken aufgenommen. Die ursprüngliche
Schreibung [daz] hat zwischen einer pronominalen und konjunktionalen Funktion unterschieden und sich im Laufe der Jahre einer Verschiebung der Satzgrenzen unterzogen:
„Ich höre das. Er kommt.“, „Ich höre dass, er kommt.“ (Feilke 2011, 346). Dieser Vorgang der Reanalyse beschreibt das Eingliedern eines zuvor eigenständigen Satzes, in einen Nebensatz. Dadurch befindet sich das Wort [das] mitunter in mehrdeutigen Situationen und beinhaltet eine doppelte Lesart, aus der sich das
Bedürfnis zur Andersschreibung entwickelte, wodurch es zu einer Doppelkonsonantenschreibung bei der Konjunktion dass kam (ebd.). Die syntaktischen, semantischen und pragmatischen Kontexte geben im Weiteren vor, dass es sich um eine konjunktionale Schreibweise handelt. Diese Signale muss der Lerner zu lesen wissen .
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Entwicklung der dass-Schreibung
- Grammatische Struktur der dass-Schreibung
- Der Artikel/Demonstrativum das
- Das Relativum das
- Die dass-Konjunktion - grammatische Aspekt
- Empirie der dass-Schreibung
- Erklärungsversuche der Fehlschreibung
- Wenn Verwechslung, dann mit dem Demonstrativum
- Nichtkommatierung als Erklärung der Fehlschreibung
- that-clause im Englischen
- that als Demonstrativum
- that als Relativum
- Kommasetzung als syntaktische Grenzen vor that
- Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Schwierigkeiten beim Erwerb der korrekten Schreibung von „das“ und „dass“ im Deutschen. Es wird die Entwicklung der orthographischen Unterscheidung zwischen Pronomen und Konjunktion beleuchtet und ein kontrastiver Vergleich mit der englischen Konjunktion „that“ durchgeführt. Die Arbeit analysiert die grammatischen Strukturen und beleuchtet empirische Befunde zu Fehlschreibungen.
- Entwicklung der orthographischen Unterscheidung von „das“ und „dass“
- Grammatische Funktionen von „das“ (Artikel, Pronomen, Relativpronomen)
- Kontrastiver Vergleich mit der englischen Konjunktion „that“
- Analyse von Fehlschreibungen und deren Ursachen
- Die Rolle der Kommasetzung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Arbeit beschreibt die Thematik der Schwierigkeiten beim Erlernen der Unterscheidung zwischen der Konjunktion „dass“ und dem Pronomen „das“ im Deutschen. Sie kündigt einen Überblick über die Entwicklung der „dass“-Schreibung und einen kontrastiven Vergleich mit dem englischen „that“ an, um die Schwierigkeiten und die orthographische Besonderheit der deutschen Doppelkonsonantenschreibung zu beleuchten.
Die Entwicklung der dass-Schreibung: Dieses Kapitel verfolgt die historische Entwicklung der „dass“/„das“-Schreibung. Es beschreibt die Entstehung aus einer ursprünglichen deiktischen Form und die schrittweise Grammatikalisierung zur heutigen Konjunktion. Die Unterscheidungsschreibung wird als Ergebnis einer langen Entwicklung dargestellt, die mit ersten Belegen im 14. Jahrhundert beginnt und im 17. Jahrhundert in Wörterbüchern und Grammatiken Einzug hält. Der Prozess der Reanalyse, das Eingliedern eines eigenständigen Satzes in einen Nebensatz, wird als wesentlicher Faktor für die Entwicklung der Doppelkonsonantenschreibung bei der Konjunktion „dass“ erläutert. Die Bedeutung syntaktischer, semantischer und pragmatischer Kontexte für die korrekte Schreibung wird hervorgehoben.
Grammatische Struktur der dass-Schreibung: Dieses Kapitel analysiert die grammatischen Funktionen des Wortes „das“. Es werden die vier Funktionen – Artikel, Relativpronomen, Demonstrativpronomen und Konjunktion – unterschieden, wobei der Fokus auf den Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Unterscheidung zwischen Pronomen und Konjunktion liegt. Die heterographische Schreibweise („das“/„dass“) wird als Lösung für die Unterscheidung der verschiedenen grammatischen Funktionen dargestellt. Die Funktion des Artikels und Demonstrativpronomens wird kurz erläutert, da diese im Fokus der Untersuchung weniger im Vordergrund stehen. Die Funktionen als Relativpronomen und Konjunktion werden eingehender beschrieben.
Schlüsselwörter
das, dass, Konjunktion, Pronomen, Orthographie, Schriftspracherwerb, kontrastive Linguistik, Deutsch, Englisch, that, Grammatikalisierung, Fehlschreibung, Kommasetzung, syntaktische Ambiguität.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: "Die Schreibung von 'das' und 'dass'"
Was ist das Thema der Arbeit?
Die Arbeit befasst sich mit den Schwierigkeiten beim Erwerb der korrekten Schreibung von „das“ und „dass“ im Deutschen. Sie untersucht die historische Entwicklung der orthographischen Unterscheidung, die grammatischen Funktionen von „das“, und vergleicht dies mit der englischen Konjunktion „that“. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Analyse von Fehlschreibungen und deren Ursachen, inklusive der Rolle der Kommasetzung.
Welche Aspekte der „dass“-Schreibung werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung der „dass“-Schreibung von den Anfängen bis zur heutigen Verwendung. Es wird die grammatische Struktur von „das“ in seinen verschiedenen Funktionen (Artikel, Demonstrativpronomen, Relativpronomen, Konjunktion) analysiert. Ein kontrastiver Vergleich mit der englischen Konjunktion „that“ wird durchgeführt, um die Besonderheiten der deutschen Schreibung zu beleuchten. Die Arbeit untersucht empirische Befunde zu Fehlschreibungen und deren Ursachen, wie z.B. Verwechslungen mit dem Demonstrativpronomen und die Rolle der Kommasetzung.
Welche grammatischen Funktionen von „das“ werden untersucht?
Die Arbeit unterscheidet vier Funktionen von „das“: Artikel, Demonstrativpronomen, Relativpronomen und Konjunktion. Der Fokus liegt auf den Schwierigkeiten bei der Unterscheidung zwischen Pronomen und Konjunktion. Die heterographische Schreibweise („das“/„dass“) wird als Lösung zur Unterscheidung der grammatischen Funktionen dargestellt.
Wie wird der kontrastive Vergleich mit dem Englischen ("that") durchgeführt?
Die Arbeit vergleicht die deutsche „dass“-Schreibung mit der englischen Konjunktion „that“, um die orthographischen und grammatischen Besonderheiten des Deutschen hervorzuheben. Dabei werden die Funktionen von "that" als Demonstrativpronomen und Relativpronomen betrachtet, sowie die Rolle der Kommasetzung im Englischen.
Welche Rolle spielt die Kommasetzung?
Die Kommasetzung spielt eine wichtige Rolle bei der Unterscheidung von „das“ und „dass“. Die Arbeit analysiert, wie die Kommasetzung als syntaktische Grenze vor „that“ im Englischen und die Nicht-Kommatierung im Deutschen die Fehlschreibungen beeinflussen können.
Welche Ursachen für Fehlschreibungen werden diskutiert?
Die Arbeit untersucht verschiedene Ursachen für Fehlschreibungen von „das“ und „dass“, darunter Verwechslungen mit dem Demonstrativpronomen und die Nichtbeachtung der Kommasetzung. Es werden verschiedene Erklärungsversuche für diese Fehlschreibungen vorgestellt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: das, dass, Konjunktion, Pronomen, Orthographie, Schriftspracherwerb, kontrastive Linguistik, Deutsch, Englisch, that, Grammatikalisierung, Fehlschreibung, Kommasetzung, syntaktische Ambiguität.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit enthält Kapitel zur Einleitung, der Entwicklung der „dass“-Schreibung, der grammatischen Struktur der „dass“-Schreibung, empirischen Befunden zu Fehlschreibungen, dem Vergleich mit der englischen „that“-clause, der Kommasetzung und einer Zusammenfassung mit Ausblick.
- Arbeit zitieren
- Franziska Lampe (Autor:in), 2014, Schwierigkeiten beim Erwerb der das/dass-Sätze, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/272880