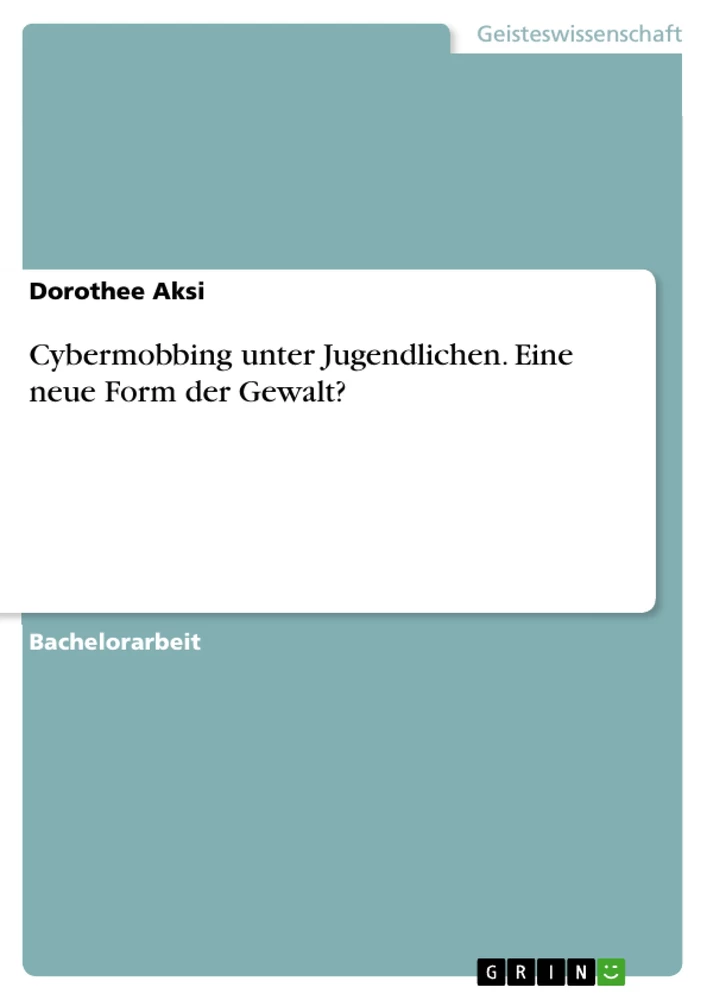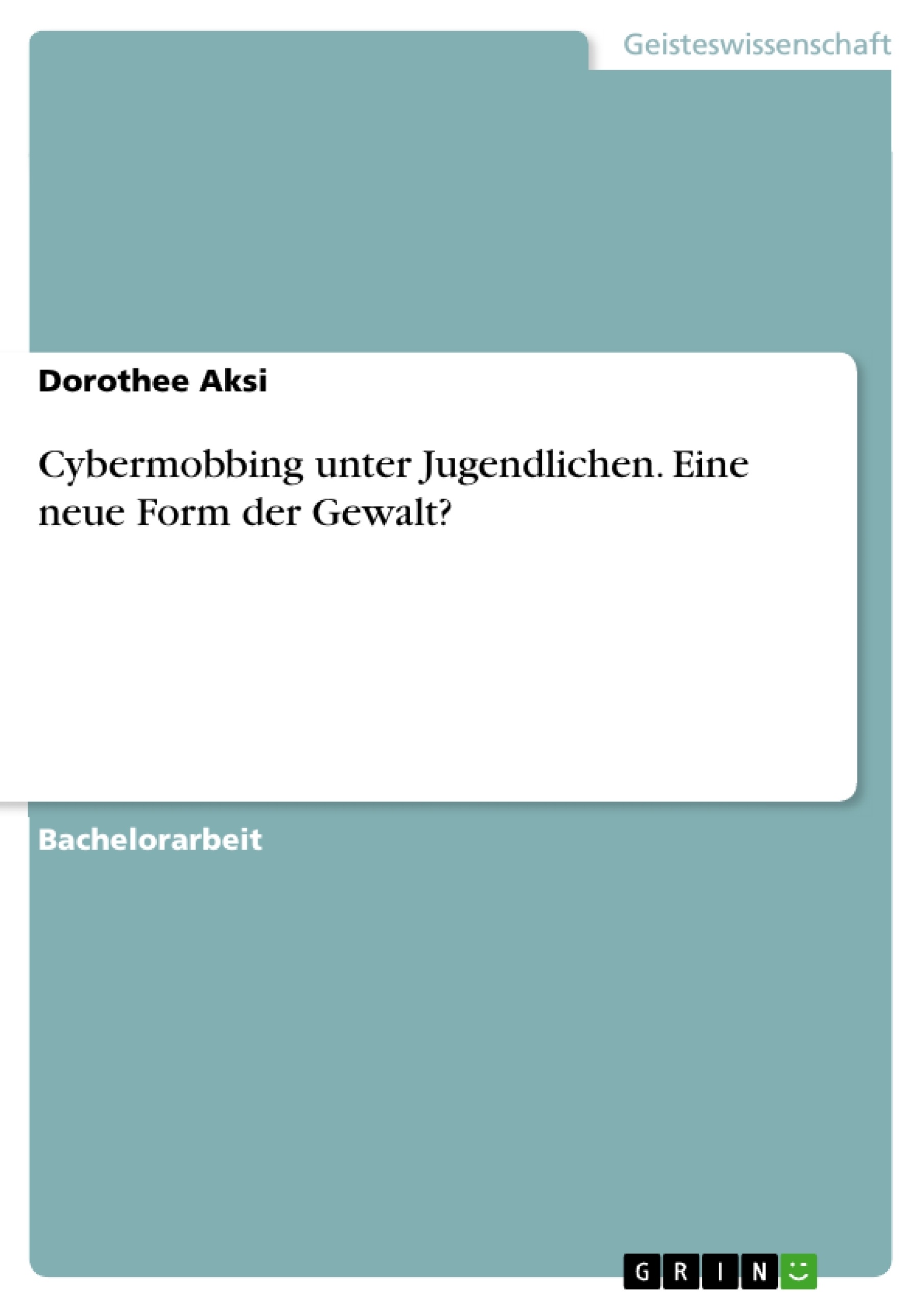Die Begriffe „Cybermobbing“ und „Cyberbullying“ findet in den Medien mittlerweile häufig Verwendung, dennoch sind sich viele der genauen Signifikanz der Begriffe nicht bewusst. Gerade die älteren Generationen, welche nicht mit Computern und Internet aufgewachsen sind, die also keine s.g. „Digitalnatives“ sind, können mit der Flut von neuen Begriffen, welche aus dem „Web 2.0“ stammen, oft überfordert sein. Somit wird ihnen eine realistische Einschätzung der damit verbundenen Gefahren, welche von den Medien gerne thematisiert werden, erheblich erschwert. Daher ist es wichtig, sich mit diesen, als Gefahren bezeichneten Phänomenen genauer und auch für die Allgemeinheit verständlich auseinanderzusetzen. Mit einem dieser Phänomene, nämlich dem Cybermobbing, beschäftigt sich die vorliegende Arbeit. Da Cybermobbing ebenso wie das traditionelle Mobbing ein sehr breit gefächertes Themengebiete darstellt, ist es unumgänglich das Thema einzugrenzen. Weil das Leben im Web 2.0 gerade für junge Menschen eine erhebliche Bedeutung hat, konzentriert sich diese Arbeit auf eine Altersgruppe zwischen 10 bis 21 Jahren – wobei dies als eine grobe Orientierung dienen soll und nicht als exakte Altersabgrenzung zu verstehen ist. Natürlich kommen Mobbing und Cybermobbing auch unter Erwachsenen vor. Wie Studien zeigen stellt Mobbing gerade am Arbeitsplatz ein ernstzunehmendes Problem dar. Doch kann dies hier nicht weiter berücksichtigt werden, da es den Rahmen dieser Arbeit übersteigen würde.
Ziel dieser Arbeit ist es, anhand von Fachliteratur und verschiedenen Studien die aktuellen Entwicklungen zu diesem Phänomen in der Bundesrepublik Deutschland zu untersuchen. Es wird herausgearbeitet, ob Cybermobbing tatsächlich eine Form der Gewalt darstellt oder nur durch die aktuelle mediale Aufarbeitung als solche stilisiert wird.[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Unterscheidung zwischen herkömmlichem Mobbing und Cybermobbing
- 2.1 Mobbing und Bullying
- 2.1.1 Definition Mobbing und Bullying
- 2.1.2 Merkmale des traditionellen Mobbings
- 2.1.3 Erscheinungsformen des traditionellen Mobbings
- 2.2 Cybermobbing und Cyberbullying
- 2.2.1 Definition Cybermobbing und Cyberbullying
- 2.2.2 Merkmale Cybermobbing
- 2.2.3 Erscheinungsformen von Cybermobbing und Cyberbullying
- 2.2.4 Methoden des Cybermobbings und Cyberbullyings
- 2.3 Beispielfälle für Cybermobbing
- 2.3.1 Flaming
- 2.3.2 Impersonation
- 2.3.3 Impersonation, Denigration und anschließendes Flaming
- 2.3.4 Happy Slapping
- 3. Rollen im Mobbingprozess
- 3.1 Das Opfer (Victim)
- 3.1.1 Opfertypus im traditionellen Mobbingprozess
- 3.1.2 Opfertypus im Cybermobbingprozess
- 3.1.3 Geschlechterverhältnis
- 3.1.4 Folgen von Cybermobbing für das Opfer
- 3.2 Der Täter (Bully)
- 3.2.1 Tätertypus
- 3.2.2 Geschlechterverhältnis
- 3.2.3 Verhalten der Täter im Cybermobbing-Prozess
- 3.2.4 Folgen für die Täter von Cybermobbing
- 3.3 Zuschauer und Mitläufer
- 4. Mögliche Ursachen von Cybermobbing
- 5. Ausmaße von Cybermobbing
- 5.1 Internet und Handynutzung von Jugendlichen
- 5.2 Prävalenz von Cybermobbing
- 6. Prävention und Handlungsstrategien für die Soziale Arbeit
- 6.1 Bisherige Präventions- und Interventionsstrategien
- 6.1.1 Prävention
- 6.1.2 Interventionsmöglichkeiten
- 6.2 Handlungsfelder für die Soziale Arbeit
- 6.2.1 Öffentlichkeitsarbeit
- 6.2.2 Schulsozialarbeit
- 7. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die aktuellen Entwicklungen von Cybermobbing in Deutschland und analysiert, ob es sich tatsächlich um eine Form von Gewalt handelt oder lediglich eine mediale Stilisierung. Der Fokus liegt auf Jugendlichen im Alter von 10 bis 21 Jahren. Die Arbeit stützt sich auf Fachliteratur und Studien.
- Definition und Abgrenzung von Cybermobbing und traditionellem Mobbing
- Analyse der Rollen im Cybermobbing-Prozess (Opfer, Täter, Zuschauer)
- Ursachen und Motive von Cybermobbing
- Ausmaß von Cybermobbing in Deutschland
- Präventions- und Interventionsstrategien für die Soziale Arbeit
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Cybermobbing ein und verdeutlicht die Notwendigkeit einer genaueren Auseinandersetzung mit diesem Phänomen, insbesondere für ältere Generationen, die mit den neuen Technologien weniger vertraut sind. Sie betont die Bedeutung des Themas für Jugendliche und grenzt den Fokus der Arbeit auf diese Altersgruppe ein, unter Verweis auf die Problematik von Mobbing auch unter Erwachsenen. Das Ziel der Arbeit wird klar definiert: die Untersuchung der aktuellen Entwicklungen von Cybermobbing in Deutschland und die Frage, ob es sich um eine Form von Gewalt handelt.
2. Unterscheidung zwischen herkömmlichem Mobbing und Cybermobbing: Dieses Kapitel definiert und differenziert zwischen Mobbing/Bullying und Cybermobbing/Cyberbullying. Es beschreibt die Merkmale und Erscheinungsformen beider Formen, um die Unterschiede herauszustellen. Durch die Gegenüberstellung werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Handlungsweisen, den Auswirkungen und den beteiligten Akteuren deutlich. Abschließend werden konkrete Fallbeispiele verschiedener Erscheinungsformen von Cybermobbing vorgestellt, um die theoretischen Ausführungen zu veranschaulichen.
3. Rollen im Mobbingprozess: Dieses Kapitel analysiert die gruppendynamischen Prozesse im Mobbing und beleuchtet die verschiedenen Rollen: Opfer, Täter und die oft vernachlässigten Zuschauer und Mitläufer. Es werden die jeweiligen Charakteristika der Opfer- und Tätertypen untersucht, sowohl im traditionellen Mobbing als auch im Cybermobbingkontext, einschließlich der Geschlechterverhältnisse und der langfristigen Folgen für alle Beteiligten. Die Rolle der Zuschauer und Mitläufer wird als entscheidender Faktor im Mobbingprozess herausgestellt, da diese die Eskalation oft begünstigen oder auch verhindern können.
4. Mögliche Ursachen von Cybermobbing: Dieses Kapitel befasst sich mit den Ursachen und Motiven von Cybermobbing. Es untersucht die Auslöser und Verstärker des Verhaltens von Tätern, indem es die individuellen Tätertypen benennt und durch den Vergleich mit traditionellem Mobbing Unterschiede und Gemeinsamkeiten aufzeigt. Es werden psychologische, soziale und technologische Faktoren analysiert, die zum Cybermobbing beitragen können.
5. Ausmaße von Cybermobbing: Das Kapitel präsentiert eine Übersicht über das Ausmaß von Cybermobbing in Deutschland, basierend auf Studien und Statistiken. Es bietet einen internationalen Vergleich und beleuchtet den Zusammenhang zwischen der Nutzung neuer Kommunikationstechnologien und der Verbreitung von Cybermobbing unter Jugendlichen. Der Einfluss der neuen Medien und die Bedeutung des Internets und des Handys für junge Menschen werden analysiert.
6. Prävention und Handlungsstrategien für die Soziale Arbeit: Dieses Kapitel untersucht die Rolle der Sozialen Arbeit im Umgang mit Cybermobbing. Es gibt einen Überblick über bestehende Präventions- und Interventionsstrategien und entwickelt Handlungsfelder für die Soziale Arbeit, insbesondere in Bezug auf Öffentlichkeitsarbeit und Schulsozialarbeit. Es wird analysiert, welche Möglichkeiten die Soziale Arbeit hat, um Cybermobbing effektiv zu bekämpfen und präventiv entgegenzuwirken.
Schlüsselwörter
Cybermobbing, Cyberbullying, Mobbing, Bullying, Internet, soziale Medien, Jugendliche, Gewalt, Prävention, Intervention, Soziale Arbeit, Täter, Opfer, Zuschauer, Gruppendynamik, Digital Natives.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Cybermobbing - Eine Analyse
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die aktuellen Entwicklungen von Cybermobbing in Deutschland und analysiert, ob es sich um eine Form von Gewalt handelt oder lediglich eine mediale Stilisierung. Der Fokus liegt auf Jugendlichen im Alter von 10 bis 21 Jahren. Die Arbeit stützt sich auf Fachliteratur und Studien.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Definition und Abgrenzung von Cybermobbing und traditionellem Mobbing, die Analyse der Rollen im Cybermobbing-Prozess (Opfer, Täter, Zuschauer), die Ursachen und Motive von Cybermobbing, das Ausmaß von Cybermobbing in Deutschland und Präventions- und Interventionsstrategien für die Soziale Arbeit.
Wie wird Cybermobbing von traditionellem Mobbing abgegrenzt?
Die Arbeit definiert und differenziert zwischen Mobbing/Bullying und Cybermobbing/Cyberbullying. Sie beschreibt die Merkmale und Erscheinungsformen beider Formen, um die Unterschiede herauszustellen. Durch die Gegenüberstellung werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Handlungsweisen, den Auswirkungen und den beteiligten Akteuren deutlich. Konkrete Fallbeispiele veranschaulichen die theoretischen Ausführungen.
Welche Rollen werden im Cybermobbing-Prozess betrachtet?
Die Arbeit analysiert die gruppendynamischen Prozesse im Mobbing und beleuchtet die verschiedenen Rollen: Opfer, Täter und Zuschauer/Mitläufer. Es werden die jeweiligen Charakteristika der Opfer- und Tätertypen untersucht, sowohl im traditionellen Mobbing als auch im Cybermobbingkontext, einschließlich der Geschlechterverhältnisse und der langfristigen Folgen für alle Beteiligten. Die Rolle der Zuschauer und Mitläufer wird als entscheidender Faktor im Mobbingprozess herausgestellt.
Welche Ursachen für Cybermobbing werden untersucht?
Die Arbeit befasst sich mit den Ursachen und Motiven von Cybermobbing. Sie untersucht die Auslöser und Verstärker des Verhaltens von Tätern, indem sie die individuellen Tätertypen benennt und durch den Vergleich mit traditionellem Mobbing Unterschiede und Gemeinsamkeiten aufzeigt. Psychologische, soziale und technologische Faktoren, die zum Cybermobbing beitragen können, werden analysiert.
Wie groß ist das Ausmaß von Cybermobbing in Deutschland?
Das Kapitel zum Ausmaß von Cybermobbing präsentiert eine Übersicht basierend auf Studien und Statistiken. Es bietet einen internationalen Vergleich und beleuchtet den Zusammenhang zwischen der Nutzung neuer Kommunikationstechnologien und der Verbreitung von Cybermobbing unter Jugendlichen. Der Einfluss der neuen Medien und die Bedeutung des Internets und des Handys für junge Menschen werden analysiert.
Welche Rolle spielt die Soziale Arbeit in der Prävention und Intervention?
Die Arbeit untersucht die Rolle der Sozialen Arbeit im Umgang mit Cybermobbing. Sie gibt einen Überblick über bestehende Präventions- und Interventionsstrategien und entwickelt Handlungsfelder für die Soziale Arbeit, insbesondere in Bezug auf Öffentlichkeitsarbeit und Schulsozialarbeit. Es wird analysiert, welche Möglichkeiten die Soziale Arbeit hat, um Cybermobbing effektiv zu bekämpfen und präventiv entgegenzuwirken.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Cybermobbing, Cyberbullying, Mobbing, Bullying, Internet, soziale Medien, Jugendliche, Gewalt, Prävention, Intervention, Soziale Arbeit, Täter, Opfer, Zuschauer, Gruppendynamik, Digital Natives.
Gibt es ein Inhaltsverzeichnis?
Ja, die Arbeit enthält ein detailliertes Inhaltsverzeichnis mit Kapiteln und Unterkapiteln, welches die Struktur und den Umfang der Arbeit verdeutlicht. (Siehe Inhaltsverzeichnis im ursprünglichen HTML-Dokument).
Wer ist die Zielgruppe dieser Arbeit?
Die Arbeit richtet sich an Personen, die sich mit dem Thema Cybermobbing auseinandersetzen möchten, insbesondere an Fachkräfte der Sozialen Arbeit, Pädagogen, Eltern und alle, die an der Prävention und Intervention von Cybermobbing interessiert sind.
- Quote paper
- Dorothee Aksi (Author), 2012, Cybermobbing unter Jugendlichen. Eine neue Form der Gewalt?, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/272500