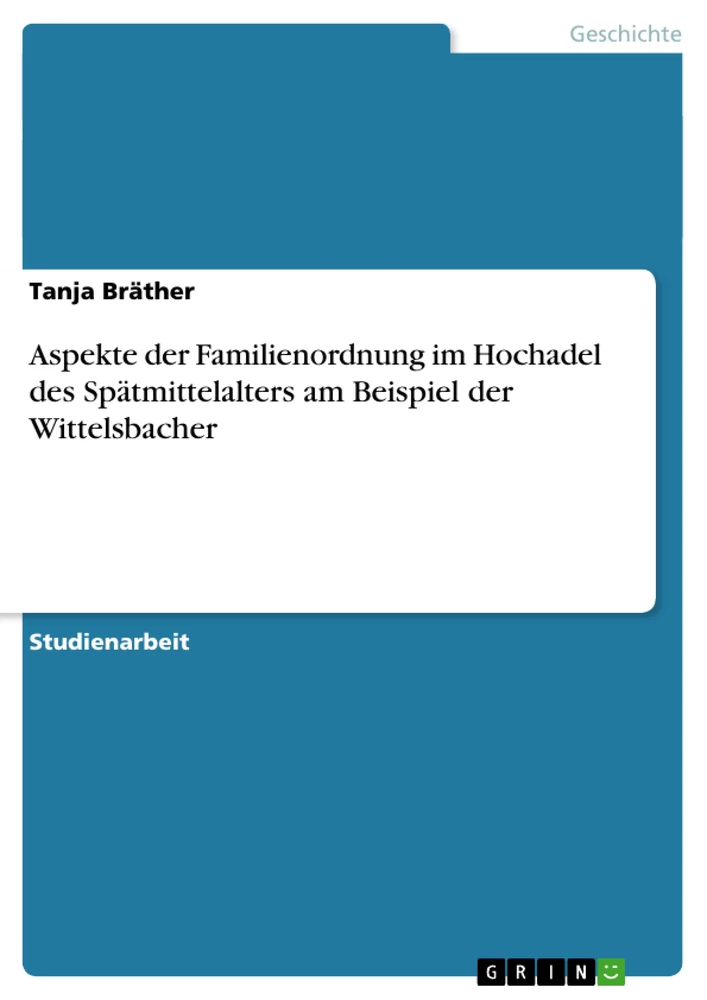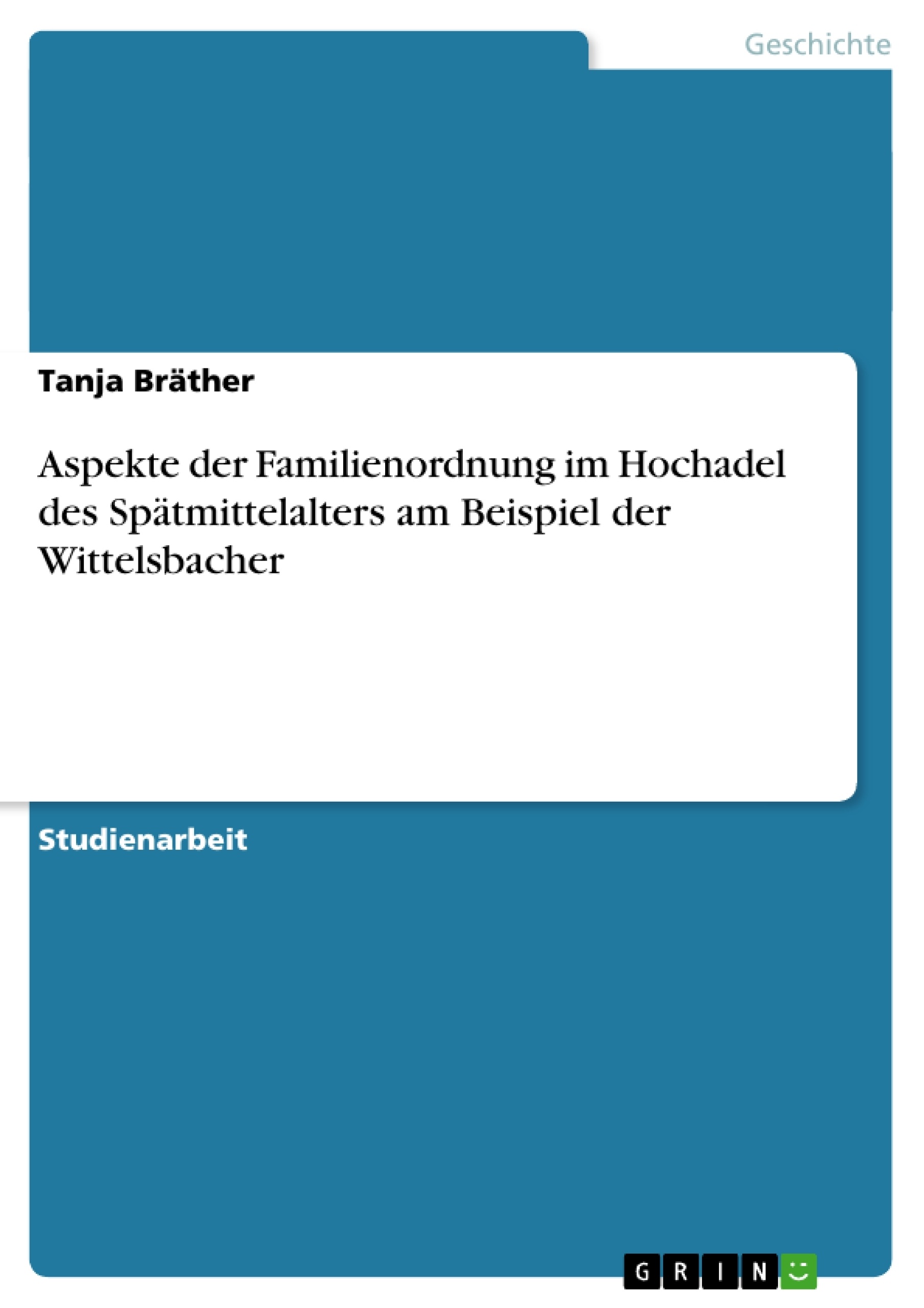Dass der Familienbegriff des Spätmittelalters sich klar von unseren heutigen Familienvorstellungen abgrenzt ist unumstritten. Die spätmittelalterliche Familie war ein hierarchisch gegliedertes Gefüge fest zugewiesener Rollenverteilungen, aus denen es kaum möglich war auszusteigen. Wie diese Beziehungskomplex konkret aussah soll nun im Folgende am Beispiel des wittelsbacherischen Hochadels näher betrachtet werden. Um die Ambitionen verstehen zu können, warum zu dieser Zeit ein so straffes und man könnte meinen auch erstarrtes Modell der Familie vorherrschte, ist es notwendig sich zumindest einführend einen Überblick über das generative Verhalten und die dynastischen Grundgedanken des damaligen Hochadels zu verschaffen.
Bereits sehr ausführlich hat sich Karl-Heinz Spieß mit dem Familienbegriff im spätmittela lterlichen Hochadel befasst. Jedoch handelt es sich bei diesem Werk fast ausschließlich um den niederrheinischen Hochadel. In meinen Ausführungen soll das Bild vervollständigt werden, indem ich von den Thesen Spieß’ ausgehen und diese mit der Geschichte und Genealogie der Wittelsbacher überprüfen werde.
Um der Vollständigkeit willen beschränke ich mich nicht nur auf die Wittelsbacher im Mannesstamm, sondern beziehe ebenso die Töchter mit ein, die vom Hause Wittelsbach in andere Höfe bzw. Linien eingeheiratet haben, und greife bisweilen auf Beispiele außerhalb des Spätmittelalters zurück. Um den Rahmen jedoch nicht zu sprengen, ist es nötig, sich haup tsächlich auf die ‚Kernfamilie’ zu beschränken, also den Familienbegriff im engeren Sinne zu betrachten und nicht als gesamter Familienverband. Außerdem lege ich den Schwerpunkt der Arbeit auf die Stellung der Kinder gegenüber den Eltern und werde das Verhältnis der Ehepartner wie das der Geschwister zueinander nur indirekt am Rande erwähnen. Untersucht habe ich ausschließlich die bayerischen Herzöge, der behandelte Zeitraum erstreckt sich demnach zufolge von Otto I. (1180) bis zum Tode Albrechts IV. (1508).
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Generatives Verhalten
- Erhaltung des Geschlechts und Stärkung der Herrschaft
- Gründe des Aussterbens
- Aspekte der Familienordnung
- Familienbegriff und -hierarchie
- Das Verhältnis des Vaters zu den Kindern
- Die geistlichen Söhne
- Die weltlichen Söhne
- Die geistlichen Töchter
- Die weltlichen Töchter
- Das Verhältnis der Mutter zu den Kindern
- Zusammenfassung und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Aspekte der Familienordnung im spätmittelalterlichen Hochadel am Beispiel der Wittelsbacher. Sie zielt darauf ab, den Familienbegriff des Spätmittelalters mit dem heutigen zu vergleichen und die Motivationen hinter dem damals vorherrschenden, streng hierarchischen Familienmodell zu beleuchten. Die Arbeit basiert auf den Thesen von Karl-Heinz Spieß, erweitert diese jedoch durch die Untersuchung der Wittelsbacher.
- Generatives Verhalten der Wittelsbacher und dessen Einfluss auf die Dynastie
- Der Familienbegriff im Spätmittelalter und seine Hierarchien
- Das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern im wittelsbachischen Hochadel
- Vergleich der Wittelsbacher mit dem niederrheinischen Hochadel nach Spieß
- Strategien zur Sicherung der Dynastie und Vermeidung des Aussterbens
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Unterschiede zwischen dem spätmittelalterlichen und dem modernen Familienbegriff. Sie hebt die hierarchische Struktur und die festen Rollenverteilungen der spätmittelalterlichen Familie hervor und kündigt die Untersuchung der wittelsbachischen Familie als Fallbeispiel an. Die Arbeit verortet sich im Kontext der Forschung von Karl-Heinz Spieß zum niederrheinischen Hochadel und kündigt an, dessen Thesen mit der Geschichte der Wittelsbacher zu überprüfen. Der Fokus liegt auf der Kernfamilie und dem Verhältnis zwischen Eltern und Kindern im Zeitraum von Otto I. (1180) bis Albrecht IV. (1508).
Generatives Verhalten: Dieses Kapitel analysiert das generative Verhalten der Wittelsbacher, beginnend mit dem Leitsatz der "generativen Kontinuität" nach Spieß. Albrecht IV. wird als Beispiel für die Bedeutung von "Haus, Dynastie und Erbrecht" angeführt. Die Arbeit diskutiert Strategien zur Vermeidung des Aussterbens, wie die uneingeschränkte Vermehrung und die beschränkte Heiratszulassung (im Gegensatz zum niederrheinischen Adel). Die Wittelsbacher zeigen hohe Kinderzahlen, jedoch ohne feste Regelungen zur Geburtenkontrolle. Die Kapitel beleuchtet die Herausforderungen der Erbteilung und den langen Prozess der Konsolidierung der bayerischen Herrschaft unter Albrecht IV. durch die Einführung der Primogenitur. Die hohen Kinderzahlen werden mit dem Ziel verbunden, die Wahrscheinlichkeit eines männlichen Erben zu maximieren.
Schlüsselwörter
Wittelsbacher, Spätmittelalter, Familienordnung, Hochadel, Generatives Verhalten, Dynastie, Erbrecht, Primogenitur, Kinderzahl, Familienhierarchie, Karl-Heinz Spieß.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse der Familienordnung der Wittelsbacher im Spätmittelalter
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Familienordnung der Wittelsbacher im Spätmittelalter. Sie untersucht den Familienbegriff, die Hierarchien innerhalb der Familie, das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern und die Strategien zur Sicherung der Dynastie und Vermeidung des Aussterbens. Die Arbeit vergleicht das wittelsbachische Modell mit dem niederrheinischen Hochadel nach Karl-Heinz Spieß.
Welche Zeitspanne wird betrachtet?
Der Fokus liegt auf der Kernfamilie und dem Verhältnis zwischen Eltern und Kindern der Wittelsbacher im Zeitraum von Otto I. (1180) bis Albrecht IV. (1508).
Welche zentralen Themen werden behandelt?
Zentrale Themen sind das generative Verhalten der Wittelsbacher (inkl. Strategien zur Vermeidung des Aussterbens und hohe Kinderzahlen), der Familienbegriff im Spätmittelalter und dessen Hierarchien, das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern im wittelsbachischen Hochadel, ein Vergleich mit dem niederrheinischen Hochadel nach Spieß und Strategien zur Sicherung der Dynastie.
Wie wird der Familienbegriff im Spätmittelalter dargestellt?
Die Arbeit hebt die hierarchische Struktur und die festen Rollenverteilungen der spätmittelalterlichen Familie hervor und vergleicht sie mit dem modernen Familienbegriff. Die strenge Hierarchie und die Bedeutung von Haus, Dynastie und Erbrecht werden betont.
Welche Rolle spielt Karl-Heinz Spieß in dieser Arbeit?
Die Arbeit basiert auf den Thesen von Karl-Heinz Spieß über den niederrheinischen Hochadel. Sie erweitert diese Thesen durch die Untersuchung der Wittelsbacher und vergleicht beide Adelsfamilien.
Wie wird das generative Verhalten der Wittelsbacher analysiert?
Das Kapitel zum generativen Verhalten analysiert die hohen Kinderzahlen der Wittelsbacher und deren Bedeutung für die Sicherung der Dynastie. Es werden Strategien zur Vermeidung des Aussterbens diskutiert, wie die uneingeschränkte Vermehrung und die beschränkte Heiratszulassung. Die Herausforderungen der Erbteilung und die Einführung der Primogenitur unter Albrecht IV. werden ebenfalls beleuchtet.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Wittelsbacher, Spätmittelalter, Familienordnung, Hochadel, Generatives Verhalten, Dynastie, Erbrecht, Primogenitur, Kinderzahl, Familienhierarchie, Karl-Heinz Spieß.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst Kapitel zu Einleitung, Generativem Verhalten (inkl. Erhaltung des Geschlechts und Gründe des Aussterbens), Aspekten der Familienordnung (inkl. Familienbegriff, Hierarchie und Verhältnis der Eltern zu den Kindern), sowie Zusammenfassung und Fazit.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit nennt explizit Karl-Heinz Spieß als wichtige Quelle und Forschungsansatz. Weitere Quellen werden im Text vermutlich detailliert zitiert, sind aber in dieser Übersicht nicht explizit genannt.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Wissenschaftler und Studierende, die sich mit der Geschichte des Spätmittelalters, der Familiensoziologie und der Geschichte des Hochadels beschäftigen. Sie bietet eine detaillierte Analyse der Familienordnung einer wichtigen europäischen Adelsfamilie.
- Quote paper
- Tanja Bräther (Author), 2003, Aspekte der Familienordnung im Hochadel des Spätmittelalters am Beispiel der Wittelsbacher, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/27127