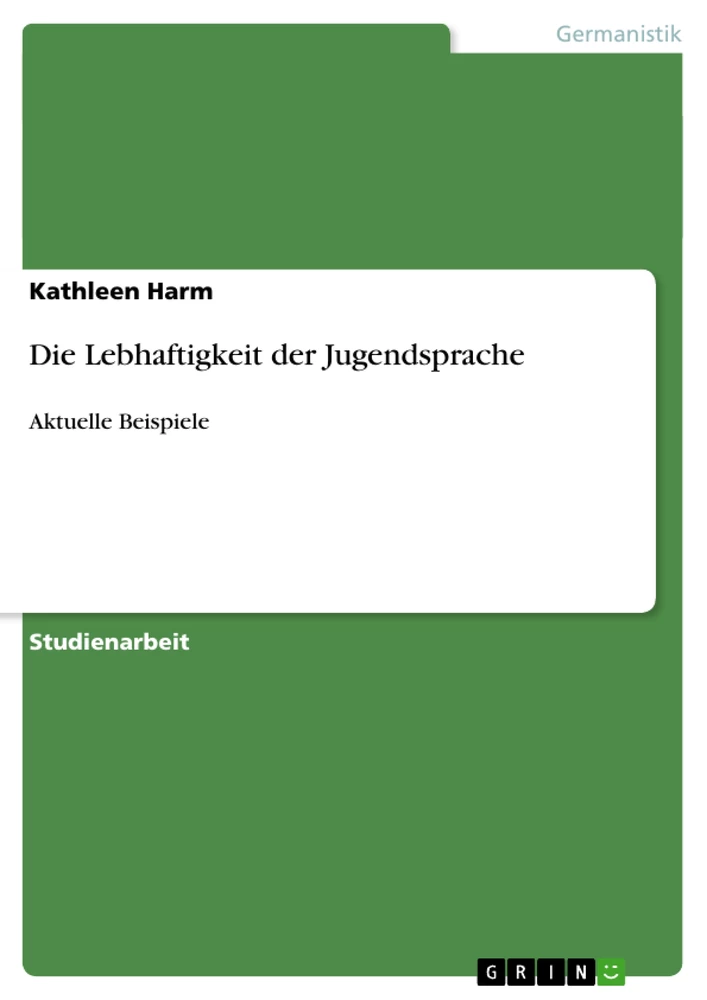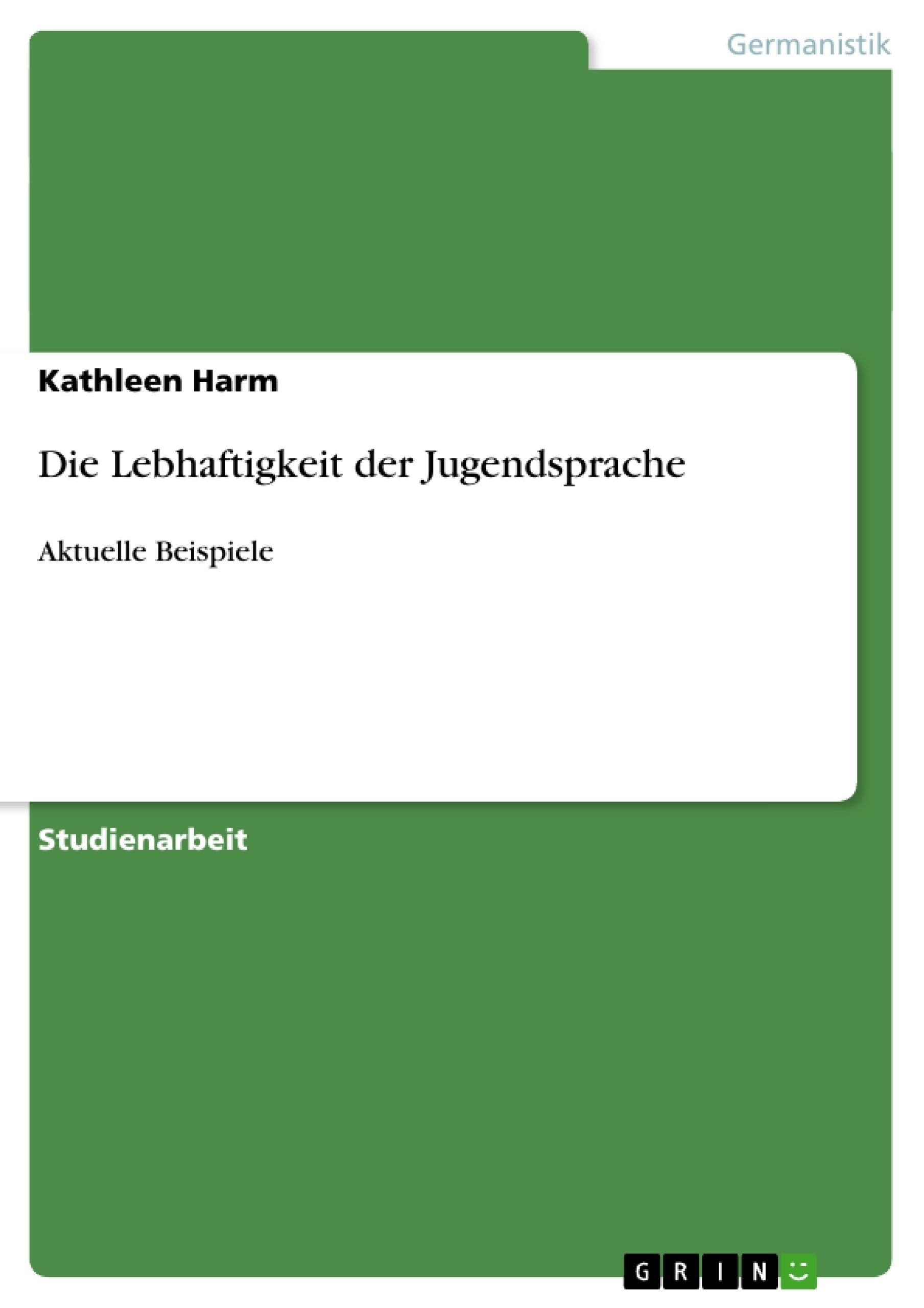Das Phänomen Jugendsprache ist ein viel diskutiertes Thema in der Sprachforschung also auch in der Gesellschaft. Bei dem Gebrauch des Wortes „Jugendsprache“ ist jedoch zu beachten, dass mit diesem Begriff keine Sprache mit eigener Grammatik, differenziertem Wortschatz und normativer Geltungen gemeint ist. Es sind vielmehr jugendliche Sprechweisen, welche ein „[…] Ausweich- und Überholmanöver […]“ ihrer zugrundeliegenden Standardsprache repräsentieren.
Die menschliche Sprache, die einer Sprechergemeinschaft als Verständigungsmittel dient und nach Hockett u.a. die Merkmale Produktivität, Arbitrarität sowie Semantizität inne hat , erweist sich in der jugendlichen Sprachproduktion als beson-ders innovativ. Es kommt dabei nicht selten zu einem Spiel mit der Arbitrarität und einer überraschenden Veränderung der Semantizität, sodass daraus zahlreiche Wör-terbücher wie „Endgeil - Das voll konkrete Lexikon der Jugendsprache“ von Hermann Ehmann hervorgebracht werden. Ausgehend von dieser kreativen Leistungsfä-higkeit der Jugendlichen, stellen wir folgende Hypothese auf:
„Jugendsprache ist lebhafter als die Standardsprache“.
Davon ausgehend soll herausgearbeitet werden, inwieweit der jugendliche Sprechstil lebhafter ist und woran sich dieses kennzeichnen lässt. Dafür wird zunächst der Begriff „Jugendsprache“ kurz erläutert sowie deren sprachliche Phänomene theoretisch dargelegt. Der Fokus liegt dabei auf die Entstehung eines Sonderwortschatzes und dem phraseologischen Sprechen. Um die Ausgangshypothese analysieren zu können, haben wir aktuelle Ausdrücke und Redewendungen mittels Fragebogen erhoben. In einem abschließenden Fazit werden die Ergebnisse der Analyse zusammengefasst und hinsichtlich unserer These kritisch reflektiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriff Jugendsprache
- Sprachliche Phänomene
- Lexikalische Merkmale
- „Sprüchekultur“ – Phraseologismen in der „Jugendsprache“
- Analyse
- Erläuterung der Materialerhebung
- Analyse Lexik
- Analyse Phraseme
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Hypothese, dass Jugendsprache lebhafter als die Standardsprache ist. Ziel ist es, die Lebhaftigkeit jugendlicher Sprechweisen zu belegen und deren Merkmale zu beschreiben. Die Arbeit konzentriert sich dabei auf die Analyse von lexikalischen Besonderheiten und phraseologischen Strukturen.
- Begriffsbestimmung von Jugendsprache
- Analyse lexikalischer Merkmale (Neologismen, Wortveränderungen, etc.)
- Untersuchung phraseologischer Strukturen ("Sprüchekultur")
- Vergleich Jugendsprache und Standardsprache
- Methodische Herangehensweise an die Datenanalyse
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Arbeit führt in das Thema Jugendsprache ein und stellt die zentrale Hypothese auf, dass Jugendsprache lebhafter als die Standardsprache ist. Sie beschreibt den Forschungsansatz, der die Erhebung aktueller jugendsprachlicher Ausdrücke mittels Fragebogen umfasst und die Analyse lexikalischer und phraseologischer Merkmale in den Fokus rückt. Die Einleitung skizziert den Aufbau der Arbeit und die methodische Vorgehensweise zur Überprüfung der Hypothese.
Begriff Jugendsprache: Dieses Kapitel definiert den Begriff "Jugendsprache" als gruppenspezifische Sprechweise und Soziolekt. Es betont die Heterogenität von Jugendsprachen und diskutiert die vielfältigen Gründe für deren Verwendung, insbesondere die Funktionen der Selbstinszenierung, Gruppenidentifikation und -kohäsion. Der Kapitel verdeutlicht, dass Jugendsprache kein einheitliches System darstellt, sondern vielmehr aus verschiedenen Varietäten besteht, die sich informeller Konventionen bedienen.
Sprachliche Phänomene: Dieses Kapitel beschreibt die sprachlichen Charakteristika von Jugendsprache. Es hebt deren Dynamik, Wandlungsfähigkeit und Kreativität hervor, die sich in Sprachspielen mit dem Material der Standardsprache äußert. Der Fokus liegt auf der Entstehung eines Sonderwortschatzes und dem phraseologischen Sprechen, auch "Sprüchekultur" genannt, die durch klischeehafte idiomatische Redewendungen, übertriebene Vergleiche und die Verwendung von Wörtern der Gemeinsprache in spezieller Bedeutung geprägt ist.
Analyse: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der empirischen Untersuchung. Es erläutert die Methode der Materialerhebung (Fragebogenstudie mit 16-jährigen Schülern) und analysiert die gewonnenen Daten hinsichtlich lexikalischer und phraseologischer Merkmale. Die Analyse deckt die kreative Wortbildung, die semantischen Veränderungen und die Verwendung von Idiomen auf und vergleicht diese mit der Standardsprache.
Schlüsselwörter
Jugendsprache, Soziolekt, Lexik, Phraseologie, Idiomatik, Neologismen, Wortbildung, Metapher, Sprachwandel, Kreativität, Standardsprache, empirische Untersuchung, Fragebogen, Analyse.
Häufig gestellte Fragen zur Seminararbeit: Jugendsprache
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die Hypothese, dass Jugendsprache lebhafter ist als die Standardsprache. Der Fokus liegt auf der Analyse lexikalischer Besonderheiten (z.B. Neologismen, Wortveränderungen) und phraseologischer Strukturen ("Sprüchekultur"). Die Arbeit beinhaltet eine empirische Untersuchung mittels Fragebogen unter 16-jährigen Schülern.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Begriffsbestimmung von Jugendsprache, Analyse lexikalischer Merkmale, Untersuchung phraseologischer Strukturen, Vergleich Jugendsprache und Standardsprache, methodische Herangehensweise an die Datenanalyse. Es werden sprachliche Phänomene wie die Entstehung eines Sonderwortschatzes und die "Sprüchekultur" (klischeehafte idiomatische Redewendungen, übertriebene Vergleiche etc.) untersucht.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Begriffsbestimmung von Jugendsprache, ein Kapitel zu sprachlichen Phänomenen (Lexik und Phraseologie), ein Kapitel zur Analyse der empirischen Daten und ein Fazit. Das Inhaltsverzeichnis bietet einen detaillierten Überblick über die einzelnen Kapitel und Unterkapitel.
Welche Methode wurde zur Datengewinnung verwendet?
Die Daten wurden mittels einer Fragebogenstudie mit 16-jährigen Schülern erhoben. Die Ergebnisse dieser empirischen Untersuchung werden im Kapitel "Analyse" präsentiert und hinsichtlich lexikalischer und phraseologischer Merkmale analysiert.
Welche Ergebnisse werden in der Arbeit präsentiert?
Die Analyse deckt die kreative Wortbildung, semantische Veränderungen und die Verwendung von Idiomen in der Jugendsprache auf und vergleicht diese mit der Standardsprache. Die Ergebnisse belegen (oder widerlegen) die Hypothese, dass Jugendsprache lebhafter ist als die Standardsprache.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Jugendsprache, Soziolekt, Lexik, Phraseologie, Idiomatik, Neologismen, Wortbildung, Metapher, Sprachwandel, Kreativität, Standardsprache, empirische Untersuchung, Fragebogen, Analyse.
Welche zentralen Hypothesen werden in der Arbeit geprüft?
Die zentrale Hypothese lautet, dass Jugendsprache lebhafter als die Standardsprache ist. Die Arbeit prüft diese Hypothese durch die Analyse lexikalischer und phraseologischer Merkmale der Jugendsprache.
Was ist das Fazit der Arbeit?
(Das Fazit wird in der vollständigen Arbeit detailliert dargestellt. Diese FAQ basiert nur auf dem bereitgestellten Vorschautext.)
- Quote paper
- Kathleen Harm (Author), 2013, Die Lebhaftigkeit der Jugendsprache, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/271186