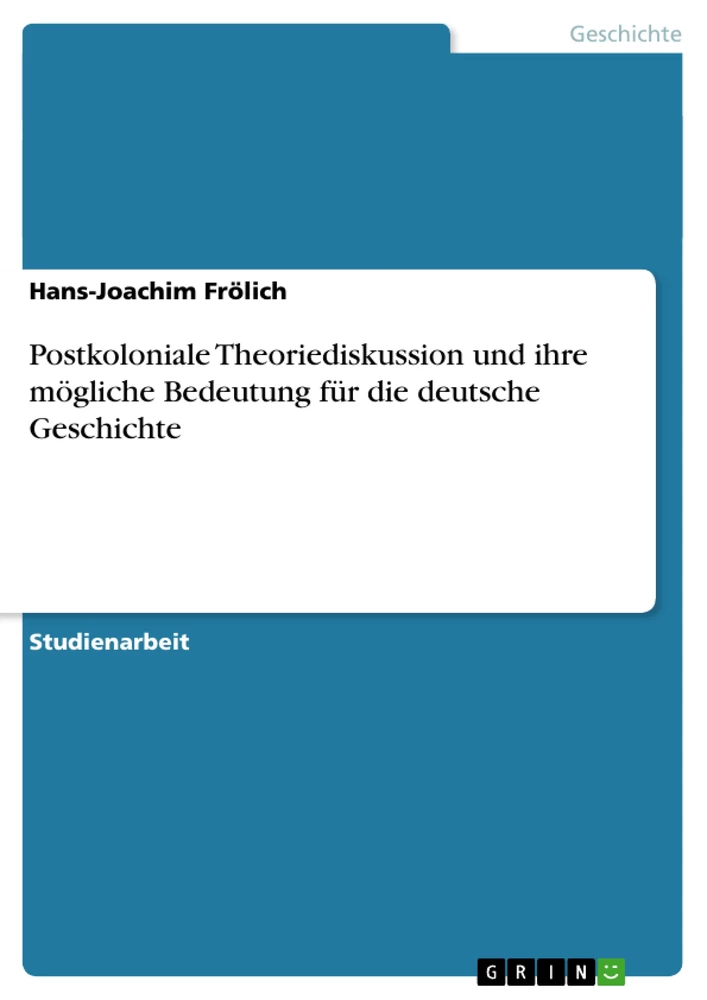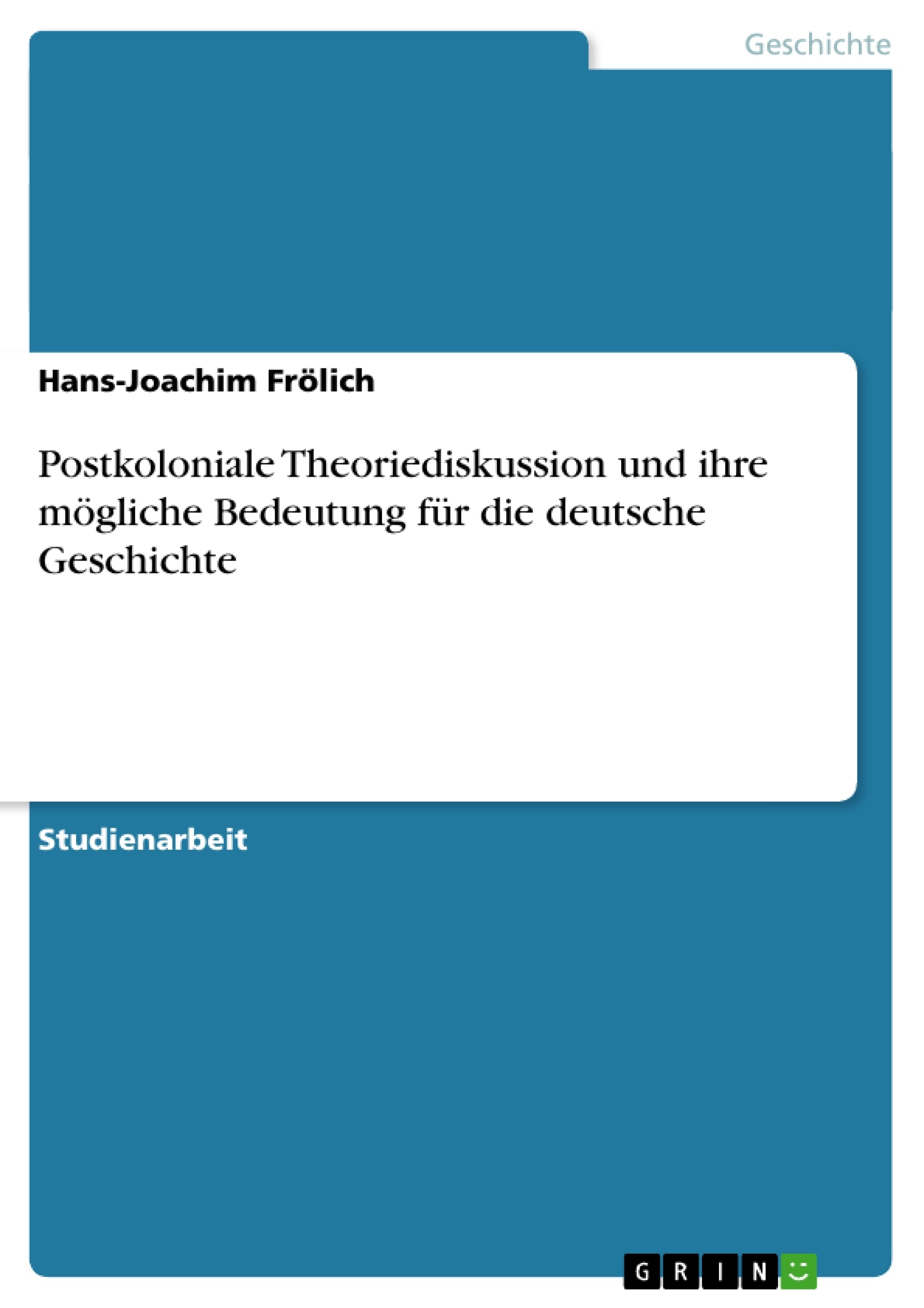Die postcolonial studies sind, zumal in Deutschland, eine noch relativ junge wissenschaftliche Richtung. Dementsprechend euphorisch fallen bisweilen die Hoffnungen aus, die in sie gesetzt werden.
Solche neue Sendungsideologie kann nicht unwidersprochen bleiben. Mit Blick auf Edward Said und dessen These vom Orientalismus-Diskurs schreibt Jürgen Osterhammel:
„Das Studium von Texten (...) rechtfertigt sich so allenfalls durch den Text um Text wiederholten Nachweis der Fehlrepräsentation, Zerrspiegelung und Entstellung außereuropäischer Kulturen (...). Erst in der „postkolonialen” Gegenwart, so glauben zahlreiche Vertreter <u.a. des Postkolonialismus>, ist die Annäherung an die Wahrheit des ‚Anderen’ möglich geworden.”
Das Thema ist umstritten. Dieser Streit kann hier nicht geschlichtet werden. Der Ansatz ist ein viel pragmatischerer: Welche Anregungen, welche Elemente der postkolonialen Theoriediskussion können für die deutsche Geschichte fruchtbar gemacht werden? Passt das überhaupt, postkoloniale Ideen für ein kolonial doch vergleichsweise wenig bedeutsames Land?
Zur Beantwortung dieser Fragen werden nach einer begrifflichen Klärung zunächst einige Ansätze der postkolonialen Debatte nachgezeichnet und Beispiele einer Anknüpfung an die deutsche Geschichte vorgestellt.
Es zeigt sich dann, dass die - vom Postkolonialismus angeregte - Überwindung nationalstaatlich zentrierter Geschichtswissenschaft einige theoretische Überlegungen nötig gemacht hat und macht. Schließlich drängen sich aus den Schriften einiger postkolonialer Autoren fundamentale Fragen auf. Diese, keineswegs ganz neuen, epistemologischen Probleme einer Geschichtswissenschaft jenseits ihrer europäischen Wurzeln sollen zuletzt nur ausschnittartig beleuchtet werden.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. „Postkolonialismus” - was ist das?
- 1. Ein wissenschaftlicher Sammelbegriff
- 2. Die politische Dimension
- 3. Ein Epochenbegriff?
- III. Deutschland postkolonial
- 1. „Was hat das alles mit Deutschland zu tun?”
- 2. Beispiele kolonialer Verflechtung Deutschlands
- IV. Postkoloniale Theorie, historiographische Methodologie - und die Praxis der Geschichtsschreibung?
- 1. Vergleich, Transfer, transnationale Gesellschaftsgeschichte, histoire croisée
- 2. Hat der Eurozentrismus ein Jenseits?
- V. Schluß
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit untersucht das Potential postkolonialer Theorien für die deutsche Geschichtswissenschaft. Sie hinterfragt die Anwendbarkeit postkolonialer Konzepte auf ein Land mit vergleichsweise geringer kolonialer Vergangenheit und beleuchtet die damit verbundenen Herausforderungen und Chancen.
- Begriffliche Klärung des Postkolonialismus
- Analyse der Anwendbarkeit postkolonialer Theorien auf die deutsche Geschichte
- Untersuchung der Auswirkungen auf die historiographische Methodologie
- Diskussion des Eurozentrismus und die Suche nach einer transnationale Perspektive
- Bewertung des Beitrags postkolonialer Studien zur deutschen Geschichtswissenschaft
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der postkolonialen Studien in der deutschen Geschichtswissenschaft ein. Sie stellt die zentrale Forschungsfrage nach dem Nutzen postkolonialer Theorien für die deutsche Geschichte und skizziert den methodischen Ansatz der Arbeit. Die Einleitung verweist auf kontroverse Debatten um die Bedeutung und Anwendbarkeit des Postkolonialismus und positioniert die vorliegende Arbeit als pragmatischen Versuch, konkrete Anwendungsmöglichkeiten zu identifizieren.
II. „Postkolonialismus” - was ist das?: Dieses Kapitel bietet eine differenzierte Begriffsklärung des Postkolonialismus. Es unterscheidet zwischen dem Postkolonialismus als wissenschaftlichem Sammelbegriff, seiner politischen Dimension und der Frage nach seiner Eignung als Epochenbegriff. Der Fokus liegt auf der Vielschichtigkeit des Begriffs und der breiten Anwendung in verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen, bedingt durch die weitreichenden Auswirkungen des Kolonialismus. Es wird darauf hingewiesen, dass der Postkolonialismus nicht nur die materiellen Auswirkungen des Kolonialismus beleuchtet, sondern insbesondere den kulturellen und geistigen Einfluss Europas betont, inklusive der Kritik an eurozentrischen Perspektiven.
III. Deutschland postkolonial: Dieses Kapitel untersucht die Relevanz postkolonialer Theorien für die deutsche Geschichte. Es hinterfragt zunächst die scheinbare Diskrepanz zwischen der vergleichsweise geringen kolonialen Vergangenheit Deutschlands und der Anwendung postkolonialer Konzepte. Anschließend werden konkrete Beispiele kolonialer Verflechtungen Deutschlands aufgezeigt, die den Einfluss des Kolonialismus auf die deutsche Geschichte belegen und die Anwendbarkeit postkolonialer Perspektiven stützen.
IV. Postkoloniale Theorie, historiographische Methodologie - und die Praxis der Geschichtsschreibung?: Dieses Kapitel befasst sich mit den Auswirkungen postkolonialer Theorien auf die historiographische Methodologie und die Praxis der Geschichtsschreibung. Es analysiert den Drang zur Überwindung einer nationalstaatlich zentrierten Geschichtswissenschaft und die theoretischen Überlegungen, die dies notwendig machen. Der Fokus liegt auf dem Vergleich, dem Transfer von Wissen und der Entwicklung einer transnationalen Gesellschaftsgeschichte. Schließlich werden grundlegende epistemologische Fragen einer Geschichtswissenschaft jenseits europäischer Wurzeln angeschnitten.
Schlüsselwörter
Postkolonialismus, deutsche Geschichte, historiographische Methodologie, Eurozentrismus, transnationale Geschichte, Kolonialismus, Edward Said, Orientalismus, Globalisierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Postkoloniale Theorien in der deutschen Geschichtswissenschaft
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht das Potential postkolonialer Theorien für die deutsche Geschichtswissenschaft. Sie hinterfragt die Anwendbarkeit postkolonialer Konzepte auf Deutschland und beleuchtet die damit verbundenen Herausforderungen und Chancen. Im Fokus steht die Frage, welchen Nutzen postkoloniale Theorien für die Erforschung der deutschen Geschichte bieten.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Begriffliche Klärung des Postkolonialismus, Analyse der Anwendbarkeit postkolonialer Theorien auf die deutsche Geschichte, Untersuchung der Auswirkungen auf die historiographische Methodologie, Diskussion des Eurozentrismus und die Suche nach einer transnationalen Perspektive sowie die Bewertung des Beitrags postkolonialer Studien zur deutschen Geschichtswissenschaft.
Wie ist die Hausarbeit strukturiert?
Die Hausarbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Eine Einleitung, ein Kapitel zur Begriffsklärung des Postkolonialismus, ein Kapitel zur Relevanz postkolonialer Theorien für die deutsche Geschichte, ein Kapitel zu den Auswirkungen auf die historiographische Methodologie und ein Schlusskapitel. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt der Thematik und baut auf den vorherigen Kapiteln auf.
Was versteht die Hausarbeit unter „Postkolonialismus”?
Die Hausarbeit bietet eine differenzierte Begriffsklärung des Postkolonialismus. Sie unterscheidet zwischen dem Postkolonialismus als wissenschaftlichem Sammelbegriff, seiner politischen Dimension und der Frage nach seiner Eignung als Epochenbegriff. Die Arbeit betont die Vielschichtigkeit des Begriffs und seine breite Anwendung in verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen. Es wird hervorgehoben, dass der Postkolonialismus nicht nur die materiellen Auswirkungen des Kolonialismus beleuchtet, sondern insbesondere den kulturellen und geistigen Einfluss Europas und die Kritik an eurozentrischen Perspektiven.
Welche Relevanz hat der Postkolonialismus für die deutsche Geschichte?
Die Hausarbeit untersucht die Relevanz postkolonialer Theorien für die deutsche Geschichte, trotz der scheinbar geringen kolonialen Vergangenheit Deutschlands. Sie zeigt anhand konkreter Beispiele kolonialer Verflechtungen Deutschlands den Einfluss des Kolonialismus auf die deutsche Geschichte auf und stützt damit die Anwendbarkeit postkolonialer Perspektiven.
Wie beeinflusst der Postkolonialismus die historiographische Methodologie?
Die Arbeit analysiert die Auswirkungen postkolonialer Theorien auf die historiographische Methodologie und die Praxis der Geschichtsschreibung. Es wird der Drang zur Überwindung einer nationalstaatlich zentrierten Geschichtswissenschaft und die theoretischen Überlegungen dazu analysiert. Im Fokus stehen der Vergleich, der Wissenstransfer und die Entwicklung einer transnationalen Gesellschaftsgeschichte. Epistemologische Fragen einer Geschichtswissenschaft jenseits europäischer Wurzeln werden ebenfalls angeschnitten.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Hausarbeit?
Schlüsselwörter sind: Postkolonialismus, deutsche Geschichte, historiographische Methodologie, Eurozentrismus, transnationale Geschichte, Kolonialismus, Edward Said, Orientalismus, Globalisierung.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Hausarbeit?
Die konkreten Schlussfolgerungen der Arbeit sind im Schlusskapitel zusammengefasst und bewerten den Beitrag postkolonialer Studien zur deutschen Geschichtswissenschaft. Die Einleitung weist bereits auf kontroverse Debatten um die Bedeutung und Anwendbarkeit des Postkolonialismus hin und positioniert die vorliegende Arbeit als pragmatischen Versuch, konkrete Anwendungsmöglichkeiten zu identifizieren.
- Quote paper
- Hans-Joachim Frölich (Author), 2003, Postkoloniale Theoriediskussion und ihre mögliche Bedeutung für die deutsche Geschichte, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/26918