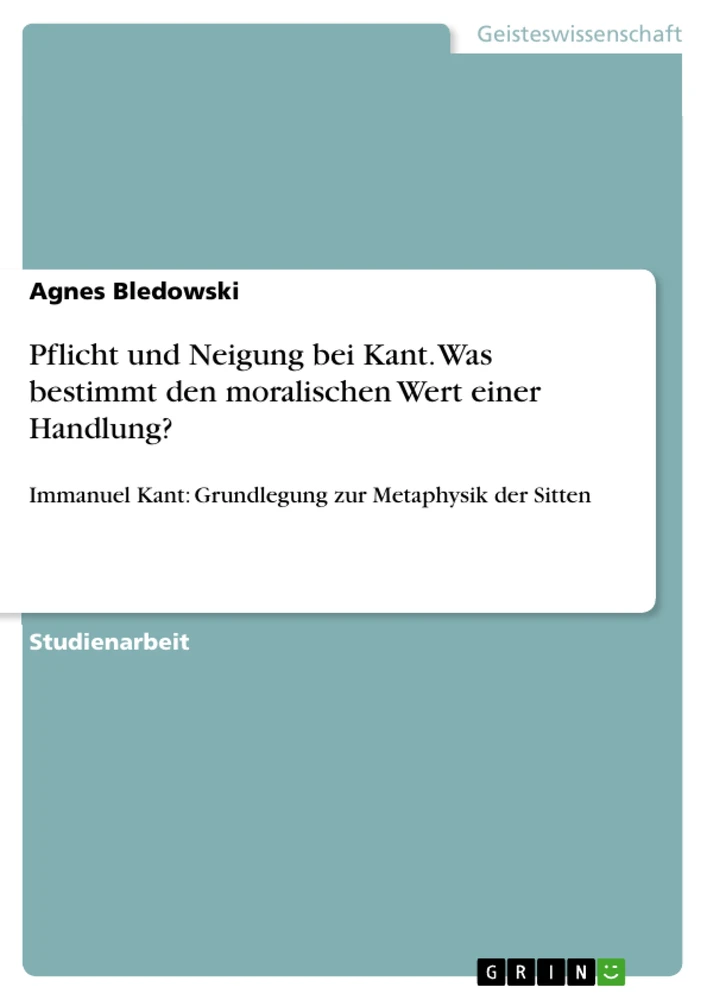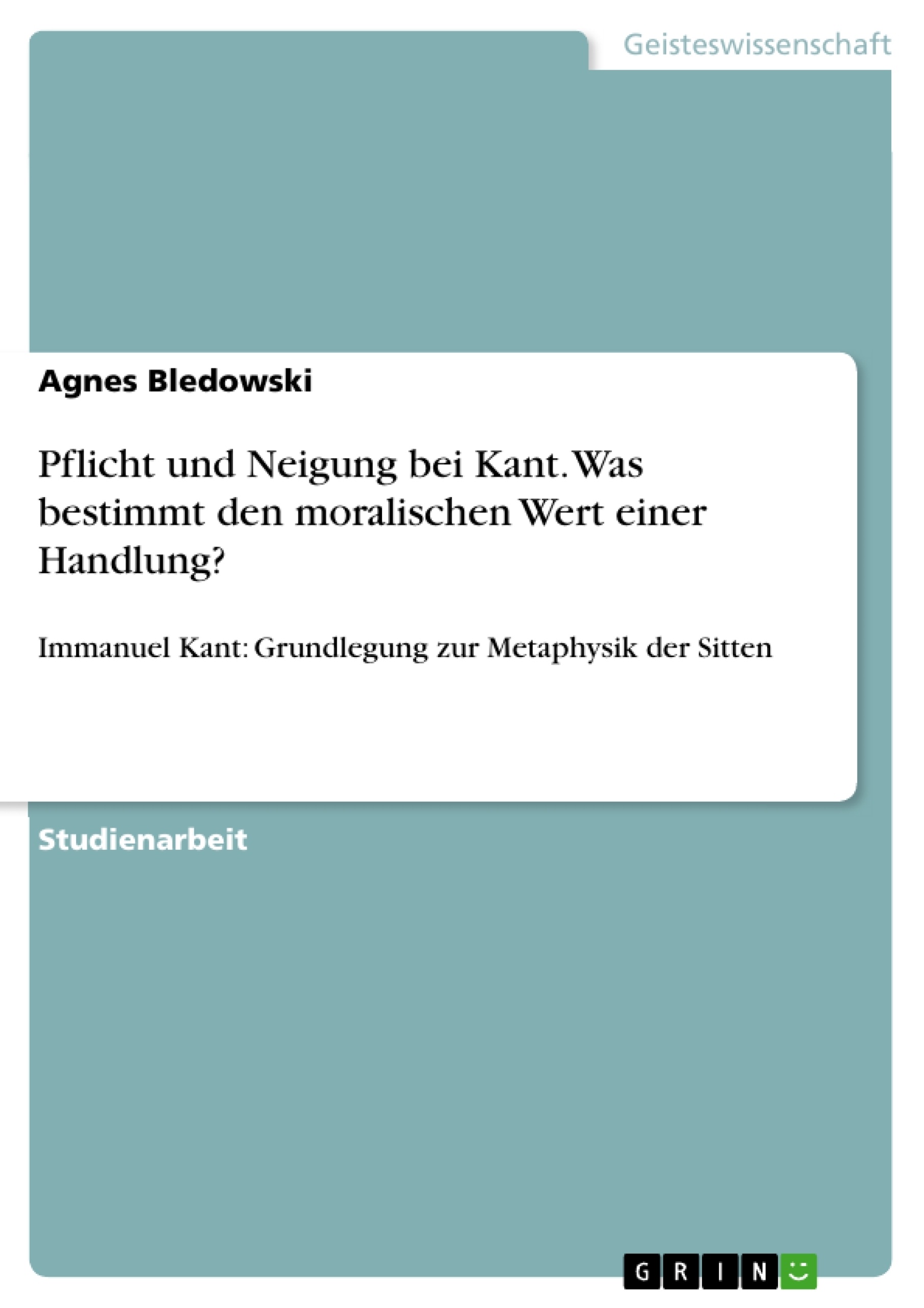Welche Handlung ist die moralisch wertvollere? Die Hilfe, die ich meinen Freund zukommen lasse, oder jene, die mein Feind genießt?
Im ersten Abschnitt der „Grundlegung zur Metaphysik der Sitten“ gibt uns Kant eine Vorstellung davon, wodurch eine Handlung einen moralischen Wert erlangt.
Moralisch wertvoll sei eine Handlung, sobald diese rein aus Pflicht ausgeführt werde. Es dürfe uns nichts weiter zu dieser Handlung motivieren, als die Pflicht oder genauer, die Achtung vor dem Gesetz. Das bedeutet, Neigungen wie Liebe oder Mitleid als Motiv machen eine Handlung nicht moralisch und somit ist Kant der Ansicht, nur die Hilfe meinem Feind gegenüber sei wirklich moralisch.
Intuitiv steht man dieser These eher skeptisch gegenüber.
Diese rigorose Sichtweise Kants veranlasste Schiller, das Gedicht „Gewissensskrupel und Decisium“ zu schreiben, welches diesen Zwiespalt überspitzt darstellt.
Auch in seiner philosophischen Schrift „Über Anmut und Würde“ bezieht sich Schiller auf die Position Kants zum moralischen Wert einer Handlung.
In dieser Hausarbeit wird der Weg Kants zu seinem Pflichtbegriff erläutert und in diesem Zusammenhang aufgezeigt, was Kant unter einer „moralisch wertvollen Handlung“ versteht. Anschließend wird Schillers Gegenposition aufgrund seiner Gedichte „Gewissensskrupel“ und „Decisium“ sowie seiner philosophischen Schrift „Über Anmut und Würde“ dargestellt. Zum Schluss werde ich zu einer Lösung kommen, die uns Kants These verständlich und akzeptabel macht. Dazu werde ich anhand des ersten Abschnittes untersuchen, ob und wo Kant seinen Aussagen zu viel Interpretationsspielraum gelassen hat.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Grundlegung zur Metaphysik der Sitten
- Der gute Wille
- Die Pflicht und die Neigung
- Das Problem
- Menschenfreund vs. Menschenfeind
- Reaktion
- Schiller - Über Anmut und Würde
- Schiller Gewissensskrupel und Decisium
- Wie sollen wir Kant verstehen?
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit widmet sich der Frage nach dem moralischen Wert einer Handlung und dem Verhältnis von Pflicht und Neigung. Sie untersucht Kants These, dass eine Handlung nur dann moralisch wertvoll ist, wenn sie rein aus Pflicht ausgeführt wird, und beleuchtet die Kritik Schillers an dieser Position.
- Kants Begriff des guten Willens und seine Begründung
- Das Verhältnis von Pflicht und Neigung in der Moral
- Schillers Kritik an Kants Pflichtmoral
- Interpretationsspielräume in Kants Aussagen
- Suche nach einer verständlichen und akzeptablen Interpretation von Kants These
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Fragestellung der Arbeit vor und erläutert kurz Kants Grundthese, wonach nur Handlungen, die aus Pflicht ausgeführt werden, moralisch wertvoll sind. Sie benennt die Gegenposition Schillers und skizziert den weiteren Aufbau der Arbeit.
Das Kapitel „Grundlegung zur Metaphysik der Sitten“ widmet sich Kants Argumentation in seiner Schrift. Es werden die wichtigsten Begriffe wie „guter Wille“, „Pflicht“ und „Neigung“ erläutert und der Kategorische Imperativ als Prüfstein für den moralischen Wert einer Handlung vorgestellt.
Im Kapitel „Das Problem“ wird die These Kants anhand des Beispiels des Menschenfreundes und des Menschenfeindes veranschaulicht.
Das Kapitel „Reaktion“ beleuchtet Schillers Gegenposition, die er in seinen Gedichten „Gewissensskrupel und Decisium“ und seiner philosophischen Schrift „Über Anmut und Würde“ artikuliert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt zentrale Begriffe der Kantschen Moralphilosophie, wie „guter Wille“, „Pflicht“, „Neigung“, „Kategorischer Imperativ“ und „moralisch wertvolle Handlung“. Sie setzt sich kritisch mit Kants These auseinander und bezieht sich auf Werke von Schiller und Sekundärliteratur zum Thema.
- Quote paper
- Agnes Bledowski (Author), 2013, Pflicht und Neigung bei Kant. Was bestimmt den moralischen Wert einer Handlung?, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/267839