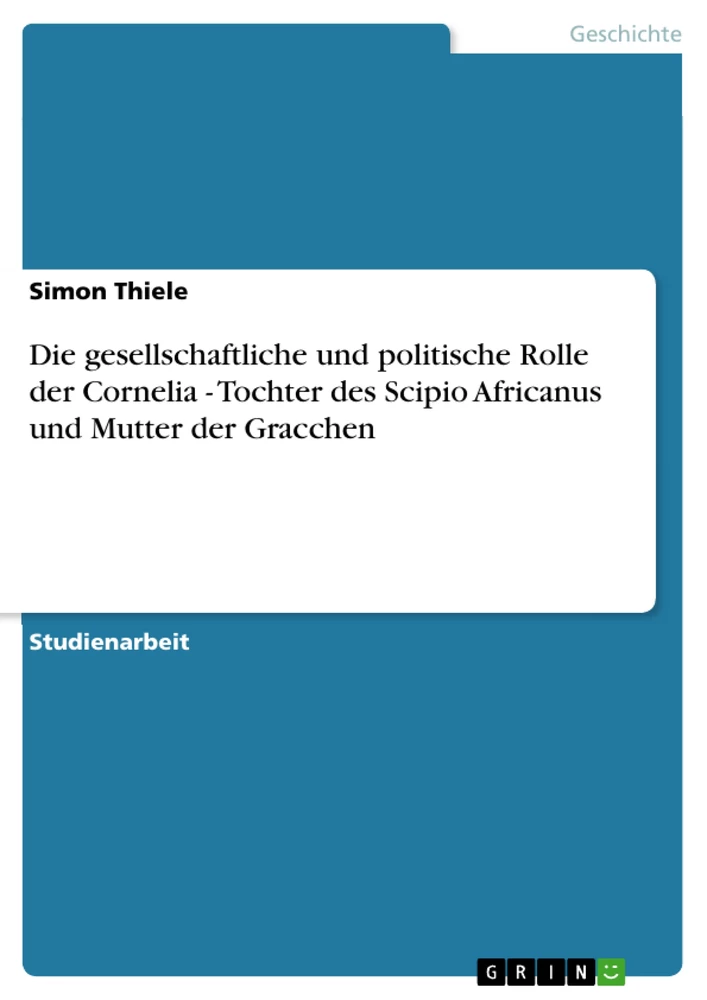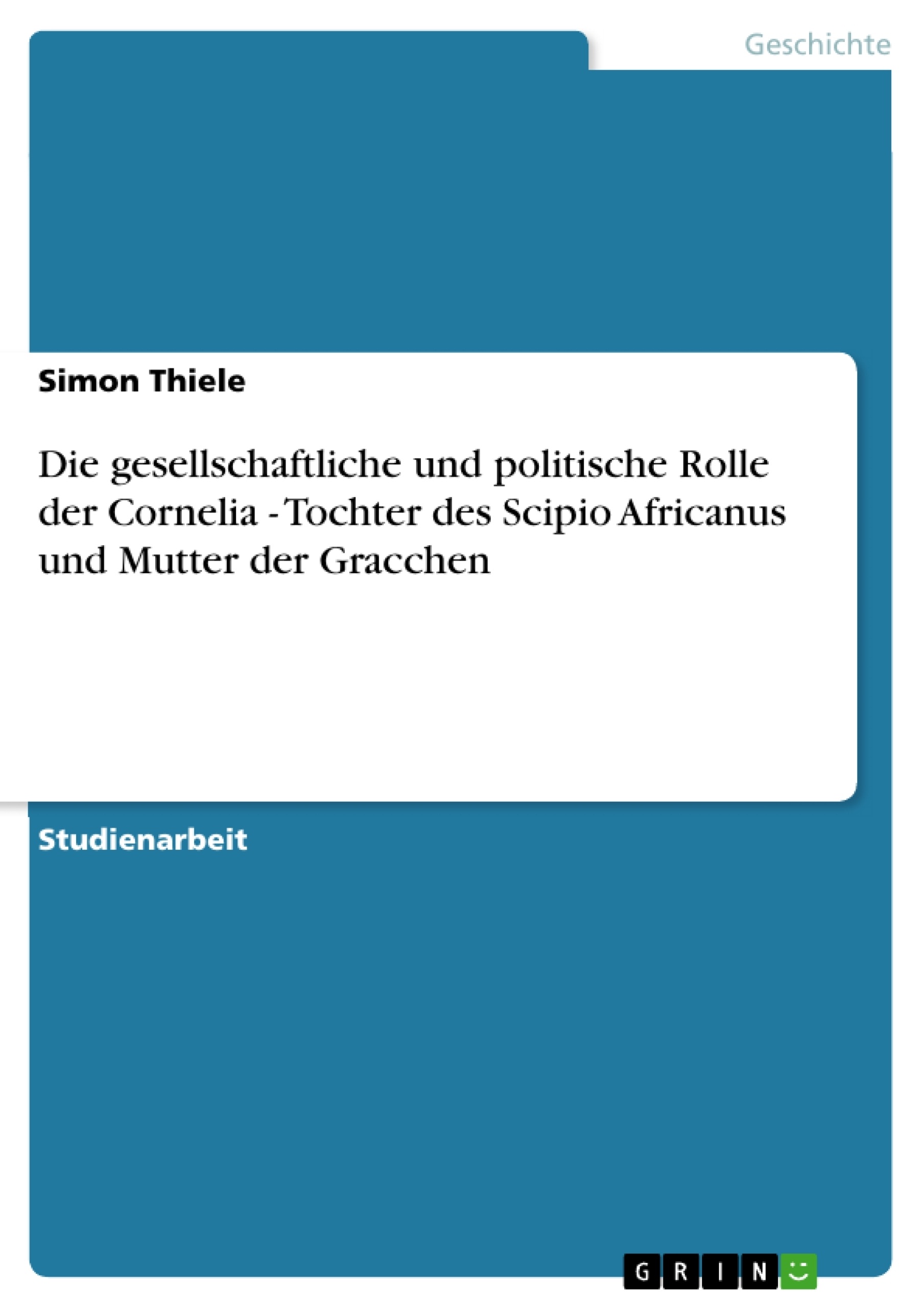Die Stellung der Frau im alten Rom war von völliger Unterordnung gegenüber dem männlichen Geschlecht gekennzeichnet. Laut FÖRTSCH befand sich eine Frau in Rom stets unter irgendeiner Art der männlichen Vormundschaft und war vom Staatsleben ausgeschlossen. Eine politische Rolle oder staatsrechtliche Funktion blieb ihr verwehrt, vielmehr habe sie darauf zu achten gehabt, dass weder Gutes noch Schlechtes über sie geredet wurde - frei gesagt: Frauen existierten im öffentlichen Leben nicht. Und auch im Privaten waren römische Frauen in der Regel einer strengen Abgrenzung ihrer Rechte und Pflichten ausgesetzt. Wie GARDNER in ihrer sehr ausführlichen Abhandlung über die Rechte der Frauen im antiken Rom erläutert, waren Frauen im rechtlichen Handeln stark eingeschränkt und bedurften der Einwilligung eines Mannes für eine rechtswirksame Initiative. Umso erstaunlicher und aufsehenerregender ist es, wenn in antiken Quellen über Frauen berichtet wird, die nicht nur als mündige Gattin eines ruhmreichen römischen Mannes, sondern auch darüber hinaus öffentlich in Erscheinung getreten sind. Ein von der Forschung sehr rege diskutiertes Beispiel einer solchen vermeintlich untypischen altrömischen Frau soll in dieser Arbeit genauer betrachtet werden: Cornelia, Tochter des an Ruhm kaum übertroffenen Publius Cornelius Scipio Africanus und Mutter der Gracchen. Ihre politische Rolle in den aufrührerischen Jahren der Volkstribunate des Tiberius und des Gaius Gracchus ist ein in Forscherkreisen viel diskutiertes Thema und bis heute nicht abschließend geklärt. Diese Arbeit soll einen Überblick verschaffen über die Verweise zum Leben der Cornelia und ihrem Verhältnis zu ihren Söhnen, die in den antiken Quellen von Plutarch, Appian, Cassius Dio und Cicero - und sicherlich auch weiteren, hier Unbeachteten - vorhanden sind. Außerdem soll aufgezeigt werden, welche Rolle der Cornelia aus heutiger, wissenschaftlicher Sicht zugeschrieben wird. Schlussendlich ist es das Ziel, Rückschlüsse über mögliche Chancen und Grenzen des wissenschaftlichen Diskurses zu ziehen und möglicherweise neue Ansätze zu liefern.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Biographie der Cornelia
- 3. Cornelia in der antiken Überlieferung
- 3.1 Plutarchs Leben und Werk
- 3.2 Hinweise auf Cornelia in ausgewählten antiken Quellen
- 4. Die Rolle der Cornelia aus heutiger Sicht der Forschung
- 5. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die gesellschaftliche und politische Rolle der Cornelia, Mutter der Gracchen, anhand antiker Quellen und aktueller Forschung. Ziel ist es, ein umfassendes Bild von Cornelias Leben und Einfluss zu zeichnen und den wissenschaftlichen Diskurs um ihre Bedeutung zu beleuchten.
- Cornelias Leben und Familie innerhalb der römischen Oberschicht
- Cornelias Darstellung in antiken Quellen (Plutarch, Appian, Cassius Dio, Cicero)
- Die Interpretation von Cornelias Rolle im Kontext der Gracchen-Brüder
- Bewertung der wissenschaftlichen Perspektiven auf Cornelias Einfluss
- Mögliche neue Ansätze zur Erforschung von Cornelias politischer und gesellschaftlicher Bedeutung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die Forschungsfrage nach der gesellschaftlichen und politischen Rolle Cornelias im Kontext der römischen Republik. Sie betont die ungewöhnliche Position einer Frau im öffentlichen Leben Roms und hebt die Bedeutung Cornelias als Mutter der Gracchen hervor. Das Zitat von Christian Morgenstern kontrastiert die traditionelle Unterordnung von Frauen mit Cornelias bemerkenswertem Einfluss. Die Arbeit skizziert den Forschungsansatz und die Zielsetzung: Analyse antiker Quellen und Einordnung in den aktuellen wissenschaftlichen Diskurs, um neue Ansätze zur Interpretation von Cornelias Rolle zu entwickeln.
2. Die Biographie der Cornelia: Dieses Kapitel beschreibt Cornelias Herkunft aus einer der angesehensten Familien Roms, ihre Heirat mit Tiberius Sempronius Gracchus (einem politischen Gegner ihres Vaters Scipio Africanus) und die Geburt ihrer drei Kinder, darunter die berühmten Volkstribunen Tiberius und Gaius Gracchus. Die Darstellung der Heirat beleuchtet die politischen Strategien der römischen Oberschicht und die Bedeutung von Eheschließungen zur Stärkung des politischen Einflusses. Cornelias Leben als Witwe und ihre Ablehnung eines Heiratsantrags des ägyptischen Königs werden ebenfalls thematisiert. Die Quellenlage wird kritisch diskutiert, wobei die unterschiedlichen Auffassungen der Historiker zu Daten und Ereignissen hervorgehoben werden.
3. Cornelia in der antiken Überlieferung: Der Fokus liegt auf der Analyse antiker Quellen, insbesondere Plutarchs Biographien von Tiberius und Gaius Gracchus, die wichtige Informationen über Cornelia liefern. Das Kapitel beleuchtet auch die Hinweise auf Cornelia in den Schriften von Appian, Cassius Dio und Cicero. Die unterschiedlichen Perspektiven und Darstellungen werden verglichen und bewertet, um ein umfassenderes Bild von Cornelias Image in der Antike zu erhalten. Plutarchs Werk wird als wichtigste Quelle hervorgehoben und näher erläutert, während die anderen Quellen als ergänzende Informationen dienen.
Schlüsselwörter
Cornelia, Gracchen, Römische Republik, Frauenrolle, antike Quellen, Plutarch, politische Einflussnahme, Nobilität, wissenschaftlicher Diskurs, römische Geschichte.
Häufig gestellte Fragen zur Seminararbeit: Cornelia, Mutter der Gracchen
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die gesellschaftliche und politische Rolle von Cornelia, der Mutter der Gracchen, anhand antiker Quellen und aktueller Forschung. Ziel ist es, ein umfassendes Bild von Cornelias Leben und Einfluss zu zeichnen und den wissenschaftlichen Diskurs um ihre Bedeutung zu beleuchten.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt Cornelias Leben und Familie innerhalb der römischen Oberschicht, ihre Darstellung in antiken Quellen (Plutarch, Appian, Cassius Dio, Cicero), die Interpretation ihrer Rolle im Kontext der Gracchen-Brüder, eine Bewertung der wissenschaftlichen Perspektiven auf ihren Einfluss und mögliche neue Ansätze zur Erforschung ihrer politischen und gesellschaftlichen Bedeutung.
Welche Quellen werden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit basiert hauptsächlich auf antiken Quellen, insbesondere Plutarchs Biographien von Tiberius und Gaius Gracchus. Zusätzlich werden Hinweise auf Cornelia in den Schriften von Appian, Cassius Dio und Cicero berücksichtigt und verglichen. Die unterschiedlichen Perspektiven und Darstellungen dieser Quellen werden analysiert und bewertet.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Biographie Cornelias, Cornelia in der antiken Überlieferung, Cornelias Rolle aus heutiger Sicht der Forschung und Zusammenfassung. Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und den Ansatz vor. Die Biographie beschreibt Cornelias Leben und Familie. Das dritte Kapitel analysiert die antiken Quellen. Das vierte Kapitel beleuchtet die aktuelle Forschung. Die Zusammenfassung fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Cornelia, Gracchen, Römische Republik, Frauenrolle, antike Quellen, Plutarch, politische Einflussnahme, Nobilität, wissenschaftlicher Diskurs, römische Geschichte.
Was ist das Hauptziel der Arbeit?
Das Hauptziel ist es, ein umfassendes und differenziertes Bild von Cornelias Leben und ihrer Rolle in der römischen Republik zu erstellen, indem antike Quellen kritisch analysiert und in den aktuellen wissenschaftlichen Diskurs eingeordnet werden. Dabei sollen auch neue Interpretationen und Forschungsansätze aufgezeigt werden.
Wie wird Plutarchs Werk in der Arbeit behandelt?
Plutarchs Biographien von Tiberius und Gaius Gracchus werden als wichtigste Quelle für Informationen über Cornelia betrachtet und ausführlich analysiert. Die anderen antiken Quellen dienen als ergänzende Informationen, um ein möglichst umfassendes Bild zu erhalten.
Welche Bedeutung hat Cornelias Ehe und ihre Entscheidung, den ägyptischen König nicht zu heiraten?
Cornelias Ehe mit Tiberius Sempronius Gracchus wird im Kontext der politischen Strategien der römischen Oberschicht und der Bedeutung von Eheschließungen zur Stärkung des politischen Einflusses beleuchtet. Ihre Ablehnung des Heiratsantrags des ägyptischen Königs wird ebenfalls thematisiert und in Bezug zu ihrem Leben und ihrer Rolle diskutiert.
- Quote paper
- Simon Thiele (Author), 2013, Die gesellschaftliche und politische Rolle der Cornelia - Tochter des Scipio Africanus und Mutter der Gracchen, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/267696