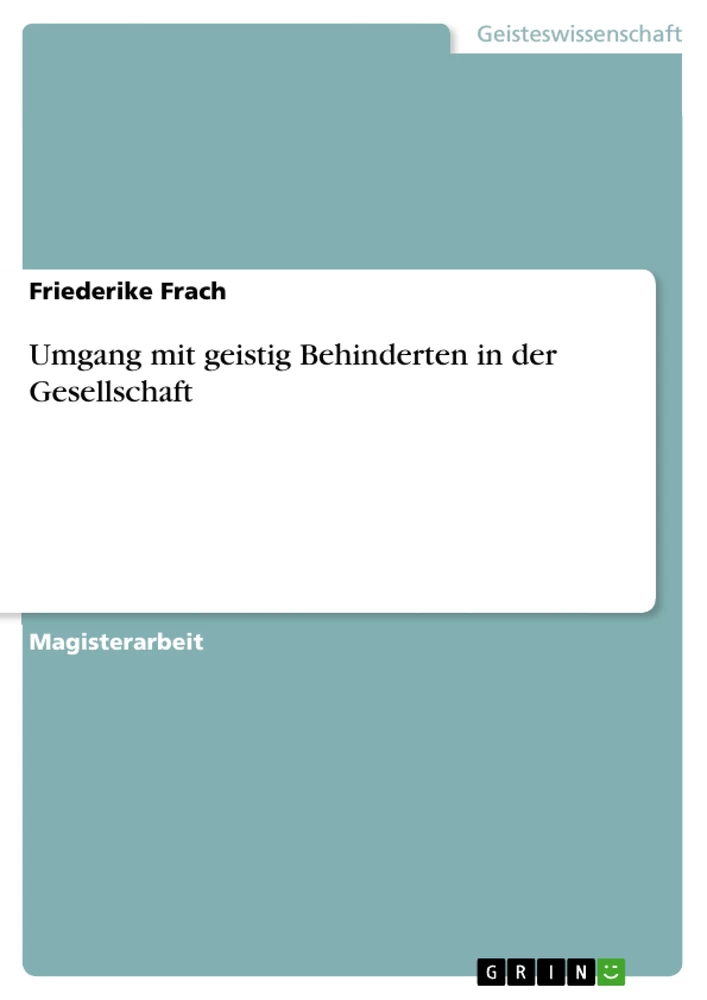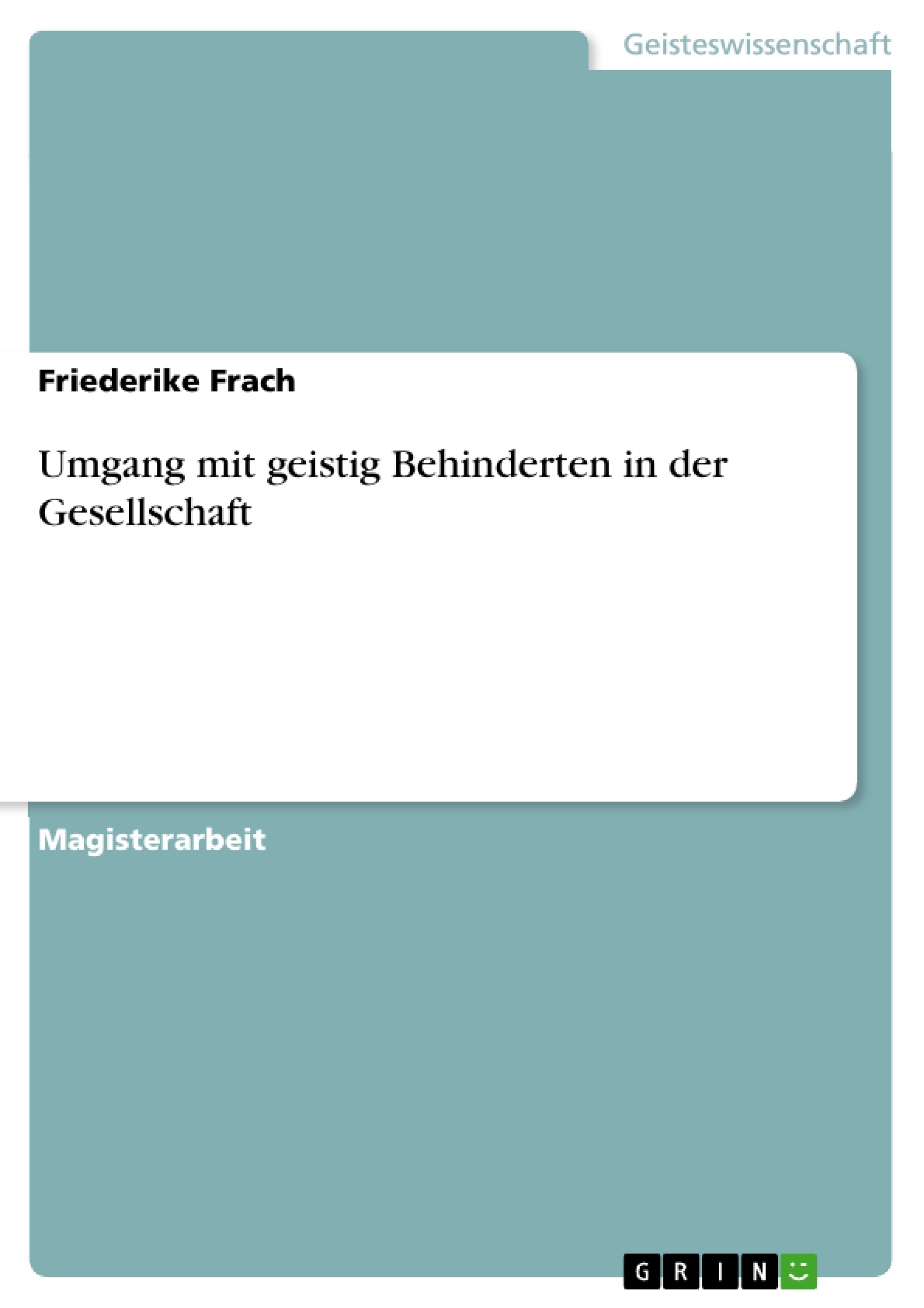Die ersten beiden Kapitel setzen sich unter anthropologischen Gesichtspunkten mit dem Phänomen geistige Behinderung auseinander. Dabei geht es zunächst um den Wandel der Bezeichnungen, mit denen geistige Behinderung umschrieben wurde und wird. An dieser Stelle werde ich auf die Diskussion um die moralisch richtige Verwendung der Termini eingehen. Im Anschluss daran sollen Textbeispiele aus der philosophischen Literatur und Beschreibungen von Zeitzeugen eine Annäherung an das Bild von der geistigen Behinderung durch die Jahrhunderte ermöglichen. [...] Dabei werde ich jene Kulturen und sozialen Systeme berücksichtigen, auf die sich unsere Gesellschaft beruft.
Um den Umgang mit geistig Behinderten in verschiedenen Ethnien zu erläutern, habe ich im dritten Kapitel Beispiele für Modelle und gesellschaftliche Konstruktionen in archaischen Kulturen und in nichtchristlichen Religionen zusammengetragen.
Im Vergleich dazu lassen sich Reaktionen und Verhaltensweisen gegenüber geistig Behinderten in unserer heutigen Kultur einordnen. So benenne ich im vierten Teil gesellschaftstheoretische Definitionen. Außerdem werde ich Erklärungsmuster für den Umgang mit geistig Behinderten und Prinzipien der Kategorisierung vorstellen. Daran schließt sich fünftens eine Darstellung der tatsächlichen Situation in der Bundesrepublik Deutschland an. [...]Hier berufe ich mich auf die neuesten Quellen zum Thema.3 Die Darstellung der Sachlage aus der Sicht der Pädagogen, Betreuer und Wissenschaftler bildet ein Gegengewicht zu den eigenen Ansichten der betroffenen Menschen.
So besteht der sechste Teil der Arbeit hauptsächlich aus Beispielen.[...] In Form von Interviews und literarischen Quellen kommen hier geistig Behinderte mit ihrer ganz persönlichen Sicht zu Wort.
Im siebten (...) Teil werde ich die aufgestellten Thesen mit den gewonnenen Eindrücken vergleichen. Aus der Zusammenstellung der Arbeit ergeben sich die wichtigsten Leitfragen. [...]Hier stellt sich die Frage nach dem Wandel der Bezeichnungen und nach dem Umgang mit geistig Behinderten durch die Jahrhunderte. Den zusammengetragenen Beispielen und der daraus gewonnenen Quintessenz stehen Umgangsformen aus jenen Kulturen gegenüber, die nur wenig von den monotheistischen Weltreligionen geprägt worden sind. Gibt es heute Rückkopplungen zwischen den Gesellschaftssystemen? Zu guter Letzt möchte ich die Außensicht der Betreuer und Forscher mit den Reflektionen der Betroffenen in Beziehung setzen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Zur Etymologie des Begriffs Geistige Behinderung
- 1.1 Definition des Begriffs Behinderung
- 1.2 Verbale Kennzeichnung Geistiger Behinderung
- 2. Zur Geschichte des Umgangs mit geistig Behinderten im europäischen Kulturkreis
- 2.1 Die Urzeit
- 2.2 Mesopotamien
- 2.3 Das Alte Ägypten
- 2.4 Griechische Antike
- 2.5 Römisches Reich
- 2.6 Frühes Christentum
- 2.7 Das Mittelalter
- 2.8 Renaissance
- 2.9 Aufklärung
- 2.10 Industrialisierung
- 2.11 20. Jahrhundert
- 3. Die Anderen und das Anderssein. Über den Umgang mit geistig Behinderten in verschiedenen Religionen und Ethnien
- 3.1 Afrika
- 3.1.1 Beispiel Senegal
- 3.2 Amerika
- 3.2.1 Indianische Kulturen
- 3.3 Asien
- 3.3.1 Hinduismus am Beispiel Indien
- 3.3.2 Buddhismus
- 3.3.3 Buddhisten, Christen und Konfuzianer in Süd-Korea
- 3.3.4 Judentum
- 3.3.5 Islam - angesiedelt sowohl in Asien als auch in Nordafrika
- 3.4 Australien
- 3.4.1 Polynesische Kulturen am Beispiel Tonga
- 3.4.2 Polynesische Kulturen am Beispiel Samoa
- 3.5 Zusammenfassung
- 3.1 Afrika
- 4. Zum Umgang mit Geistiger Behinderung heute. Einstellungen und Verhalten gegenüber geistig Behinderten in der westlichen Kultur
- 5. Bundesrepublik Deutschland
- 5.1 Geistig behinderte Kinder
- 5.1.1 Der Elementarbereich
- 5.1.2 Während der Schulzeit
- 5.2 Geistig behinderte Jugendliche und Erwachsene
- 5.2.1 Zur Wohnsituation
- 5.2.2 Das Arbeitsleben
- 5.2.3 Freizeit im Leben geistig behinderter Menschen
- 5.1 Geistig behinderte Kinder
- 6. Erfahrungen: Der Blick von Innen
- 6.1 Kreative Freizeitgestaltung
- 6.2 Produktives Reisen
- 6.3 Texte und Bilder
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit untersucht den Umgang mit geistig behinderten Menschen in der Gesellschaft, sowohl historisch als auch im gegenwärtigen Kontext. Ziel ist es, einen umfassenden Überblick über die Entwicklung der Einstellungen und des Verhaltens gegenüber geistig Behinderten zu geben und den "Blick von außen" mit den Erfahrungen Betroffener zu verbinden.
- Historische Entwicklung des Umgangs mit geistiger Behinderung
- Kulturelle und religiöse Perspektiven auf geistige Behinderung
- Die Situation geistig behinderter Menschen in der Bundesrepublik Deutschland
- Integrative Projekte und der Versuch der Normalisierung
- Perspektiven der Betroffenen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beleuchtet die oft unbewusste Vermeidung von Kontakt mit geistig behinderten Menschen in der heutigen Gesellschaft und führt integrative Projekte als Gegenbeispiel an. Sie betont die Notwendigkeit der Normalisierung und verweist auf die eigene Forschungsarbeit, die den "Blick von außen" mit dem Erleben der Betroffenen verbindet, unterstützt durch eine Videodokumentation des Theaterprojekts "RAMBA ZAMBA".
1. Zur Etymologie des Begriffs Geistige Behinderung: Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition von Behinderung und der sprachlichen Entwicklung des Begriffs "geistige Behinderung". Es analysiert die semantische Entwicklung und die damit verbundenen gesellschaftlichen Konnotationen.
2. Zur Geschichte des Umgangs mit geistig Behinderten im europäischen Kulturkreis: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden historischen Überblick, der vom Umgang mit geistig Behinderten in der Urzeit bis ins 20. Jahrhundert reicht. Es beleuchtet die unterschiedlichen Perspektiven und Praktiken in verschiedenen Epochen und Kulturen (Mesopotamien, Ägypten, Griechenland, Rom, Frühchristentum, Mittelalter, Renaissance, Aufklärung und Industrialisierung), um die Wandlung der gesellschaftlichen Sichtweise zu dokumentieren. Der Fokus liegt auf den jeweiligen kulturellen und gesellschaftlichen Konzepten von Normalität und Abweichung.
3. Die Anderen und das Anderssein: Dieses Kapitel erforscht den Umgang mit geistiger Behinderung in verschiedenen Religionen und Ethnien weltweit. Es präsentiert Fallstudien aus Afrika (Senegal), Amerika (indianische Kulturen), Asien (Hinduismus, Buddhismus, Konfuzianismus, Judentum, Islam) und Australien (polynesische Kulturen), um ein differenziertes Bild der vielfältigen kulturellen Perspektiven und Praktiken zu liefern und Gemeinsamkeiten und Unterschiede aufzuzeigen. Der Vergleich der verschiedenen Kulturen und ihrer Ansätze verdeutlicht die relative Natur von Konzepten von „Normalität“ und „Anderssein“.
4. Zum Umgang mit Geistiger Behinderung heute: Dieses Kapitel analysiert die aktuellen Einstellungen und das Verhalten gegenüber geistig behinderten Menschen in der westlichen Kultur. Es untersucht die Veränderungen und Kontinuitäten im Umgang mit geistiger Behinderung im Vergleich zu historischen Perspektiven. Es wird der aktuelle Stand der Integration, die Herausforderungen und die notwendigen Veränderungen beleuchtet.
5. Bundesrepublik Deutschland: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Situation geistig behinderter Menschen in der Bundesrepublik Deutschland. Es untersucht die Situation von Kindern im Elementarbereich und während der Schulzeit, sowie die Wohnsituation, die Arbeitsbedingungen und die Freizeitgestaltung von Jugendlichen und Erwachsenen. Der Fokus liegt auf der Integration und den Möglichkeiten der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.
Schlüsselwörter
Geistige Behinderung, Inklusion, Exklusion, Geschichte, Kultur, Religion, Ethnie, Bundesrepublik Deutschland, Integration, Normalisierung, Lebensqualität, Teilhabe, Gesellschaft, Einstellungen, Verhalten, Erfahrungen, Betroffene.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Magisterarbeit: Umgang mit Geistiger Behinderung
Was ist der Gegenstand dieser Magisterarbeit?
Die Magisterarbeit untersucht umfassend den Umgang mit geistig behinderten Menschen in der Gesellschaft – historisch betrachtet und im aktuellen Kontext. Sie verbindet den "Blick von außen" (gesellschaftliche Perspektiven) mit den Erfahrungen Betroffener, um ein ganzheitliches Bild zu liefern.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit deckt ein breites Spektrum an Themen ab, darunter die historische Entwicklung des Umgangs mit geistiger Behinderung in verschiedenen Kulturen und Epochen (von der Urzeit bis zur Gegenwart), kulturelle und religiöse Perspektiven auf geistige Behinderung weltweit, die aktuelle Situation geistig behinderter Menschen in der Bundesrepublik Deutschland (inkl. Kinder, Jugendliche und Erwachsene), integrative Projekte und den Prozess der Normalisierung sowie die Perspektiven der Betroffenen selbst.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung, Etymologie des Begriffs "Geistige Behinderung", Historischer Umgang mit geistiger Behinderung im europäischen Kulturkreis, Umgang mit geistiger Behinderung in verschiedenen Religionen und Ethnien weltweit, Umgang mit geistiger Behinderung in der heutigen westlichen Kultur (mit Fokus auf die Bundesrepublik Deutschland) und schließlich die Erfahrungen Betroffener ("Der Blick von Innen"). Jedes Kapitel bietet detaillierte Analysen und Fallstudien.
Wie wird die historische Entwicklung des Umgangs mit geistiger Behinderung dargestellt?
Die Arbeit zeichnet einen umfassenden historischen Überblick nach, beginnend bei der Urzeit und reichend bis ins 20. Jahrhundert. Sie beleuchtet verschiedene Kulturen (Mesopotamien, Ägypten, Griechenland, Rom usw.) und Epochen (Frühchristentum, Mittelalter, Renaissance, Aufklärung, Industrialisierung), um die Wandlung der gesellschaftlichen Sichtweise auf geistige Behinderung aufzuzeigen und die jeweiligen kulturellen Konzepte von Normalität und Abweichung zu analysieren.
Wie werden kulturelle und religiöse Perspektiven berücksichtigt?
Die Arbeit untersucht den Umgang mit geistiger Behinderung in diversen Religionen und Ethnien weltweit. Sie präsentiert Fallstudien aus Afrika, Amerika, Asien und Australien, um die Vielfalt kultureller Perspektiven und Praktiken zu zeigen, Gemeinsamkeiten und Unterschiede aufzuzeigen und die relative Natur von Konzepten wie "Normalität" und "Anderssein" zu verdeutlichen.
Wie wird die Situation in der Bundesrepublik Deutschland dargestellt?
Das Kapitel zur Bundesrepublik Deutschland konzentriert sich auf die Situation geistig behinderter Menschen in Deutschland, untersucht die Lebenssituation von Kindern (Elementarbereich und Schule), Jugendlichen und Erwachsenen (Wohnsituation, Arbeit, Freizeit) und beleuchtet die Integration und Teilhabemöglichkeiten am gesellschaftlichen Leben.
Welche Rolle spielen die Erfahrungen Betroffener?
Die Arbeit integriert explizit die Perspektive der Betroffenen ("Der Blick von Innen"). Sie präsentiert beispielsweise kreative Freizeitgestaltung, Erfahrungen mit Reisen und persönliche Texte und Bilder, um ein authentisches und umfassendes Bild zu ermöglichen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Geistige Behinderung, Inklusion, Exklusion, Geschichte, Kultur, Religion, Ethnie, Bundesrepublik Deutschland, Integration, Normalisierung, Lebensqualität, Teilhabe, Gesellschaft, Einstellungen, Verhalten, Erfahrungen, Betroffene.
Welche Methode wird in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit kombiniert historische Analysen mit aktuellen Studien und Fallbeispielen. Sie integriert qualitative Daten (z.B. Interviews, persönliche Berichte) mit quantitativen Daten, um ein umfassendes Bild zu zeichnen. Die Verbindung von "Blick von außen" und den Erfahrungen Betroffener ist ein zentrales Merkmal der Methodik.
Wo finde ich weitere Informationen?
Weitere Informationen sind im detaillierten Inhaltsverzeichnis der Arbeit enthalten, welches Einleitung, Kapitelübersichten und Schlüsselwörter auflistet. Zusätzlich wird auf eine Videodokumentation eines Theaterprojekts verwiesen.
- Quote paper
- Friederike Frach (Author), 2003, Umgang mit geistig Behinderten in der Gesellschaft, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/26766