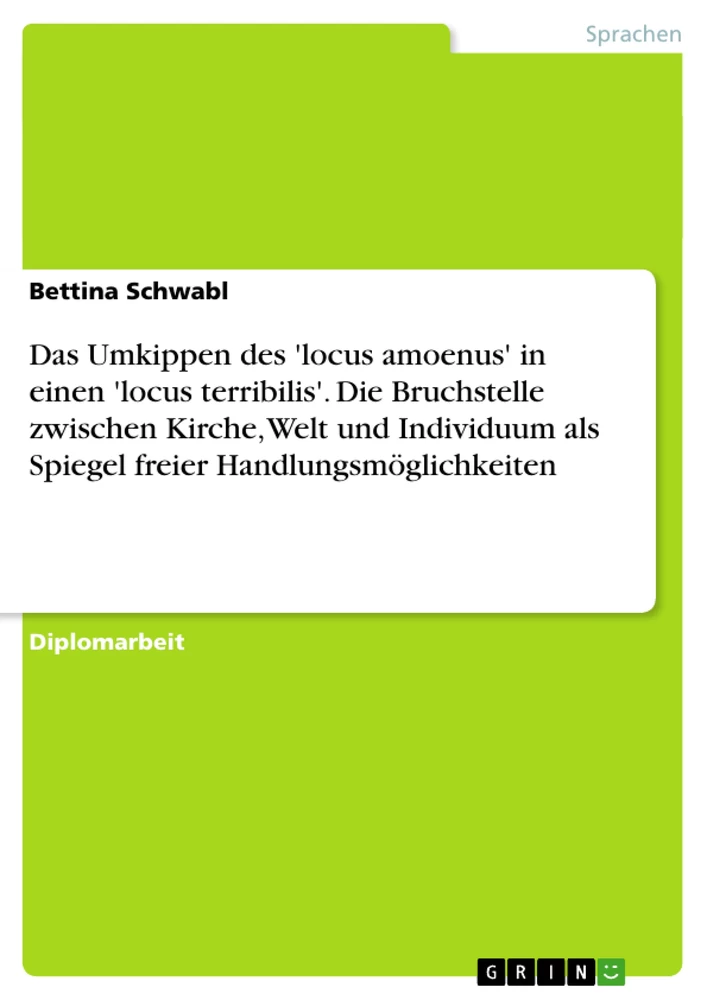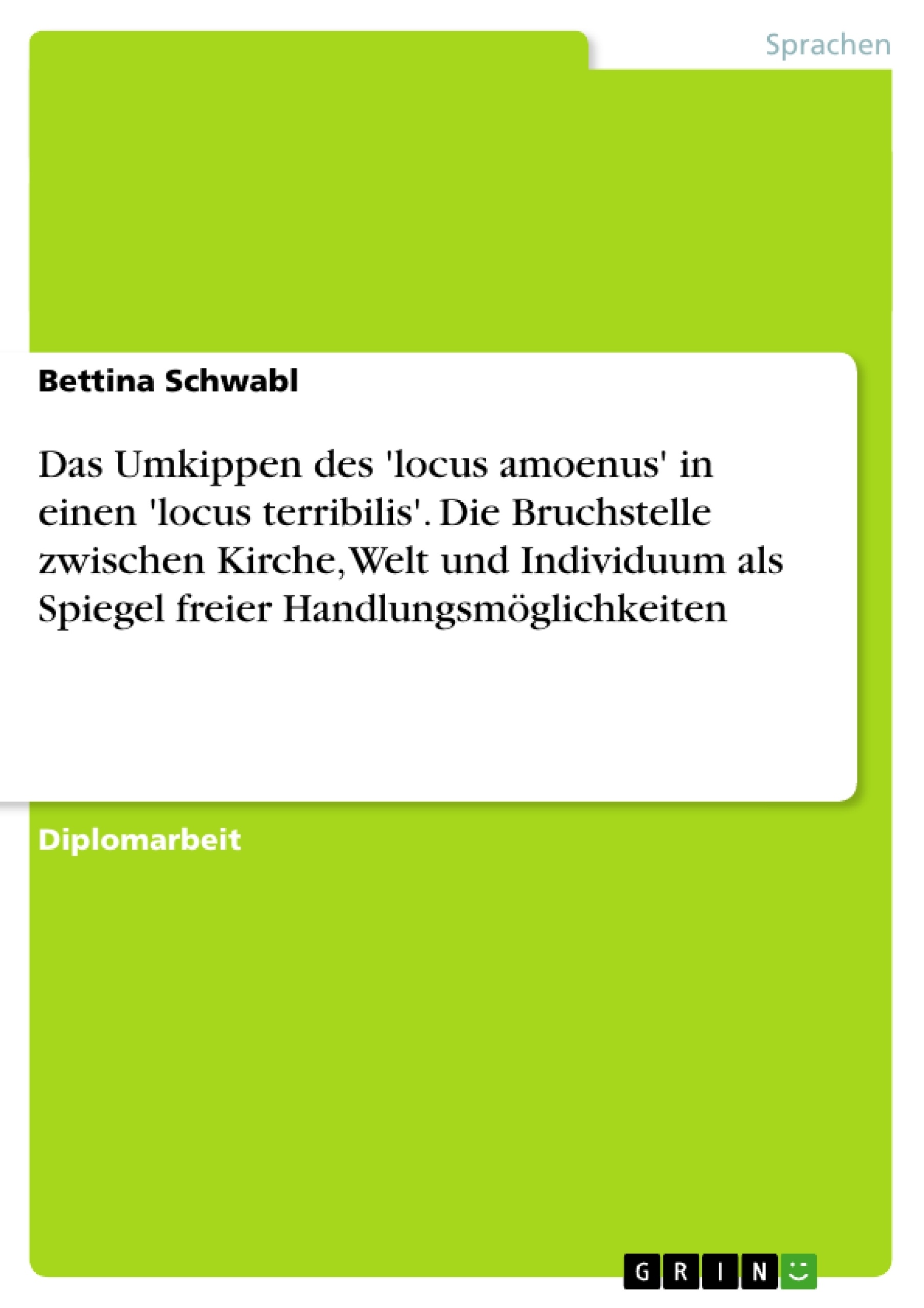In der vorliegenden Arbeit soll die Besonderheit eines „kippenden“, also eines in seiner Stimmung umschlagenden locus amoenus betrachtet und Überlegungen zu ihrer Bedeutung und Entstehung angestellt werden. Zu diesem Zweck werden die Darstellungen des locus amoenus in Hartmanns „Erec“, in Gottfrieds „Tristan“, im „Nibelungenlied“ sowie in Hartmanns „Iwein“ auf ihre Gemeinsamkeiten gleichwie auf ihre Unterschiede untersucht und diese analysiert, um so eine werkübergreifende Struktur erfassen zu können. Zunächst werden die theoretischen Grundlagen vorgestellt und danach auf die jeweiligen Stellen der genannten Werke angewendet werden, um sie anschließend einem Vergleich zu unterziehen. Von Interesse werden dabei folgende Elemente sein:
− Aufbau und Darstellung des locus amoenus
− Schachtelung der Szenen
− Herbeiführen des Kippmoments des locus amoenus in einen locus terribilis
− Darstellung des locus terribilis sowie die
− Auflösung der Missverhältnisse
Dies geschieht mit dem Ziel, verwertbare Interpretationsansätze zum Kippen des locus amoenus in einen locus terribilis sichtbar zu machen. Das Umschlagen des locus amoenus in den ausgewählten Werken vollzieht sich inhaltlich und zeigt sich nicht durch die Umgestaltung des Motivs. Gerade dadurch entsteht eine Bruchstelle zur üblichen Norm, die zunächst zwischen literarischem Rahmen und inhaltlichem Handeln erzeugt wird. Dieser Besonderheit soll in der vorliegenden Arbeit interpretativ nachgegangen werden.
Da Kunst immer Ausdruck ihrer Zeit ist, könnte hier eine hintergründige Umstrukturierung gesellschaftlicher Normen zu Tage treten. Diese These steht in Zusammenhang mit kulturhistorischen Interpretationsansätzen , welche die Loslösung feudal strukturierter Gesellschaften aus religiösen Doktrinen und die allmähliche Fokussierung gesellschaftsinhärenter Werte auf weltliche Grundsätze mit der Konsequenz individualisierter Handlungsmöglichkeiten im behandelten Zeitfenster thematisiert.
Sollte der Rahmen einer Diplomarbeit nicht ausreichen, respektive nicht an die Methodik heranreichen, dieses Phänomen mittelalterlicher Literatur genügend zu ergründen, so soll diese Arbeit zumindest einen Beitrag zur Erfassung einer neuen Forschungsfrage in der literaturhistorischen Wissenschaft leisten und dieser motivischen Besonderheit Raum und Aufmerksamkeit verschaffen. Somit hoffe ich darauf, auch künftig noch von Kundigeren belehrt zu werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Auswahl der untersuchten Werke
- 2.1. Der locus amoenus und andere Topoi
- 2.2. Konzepte der Toposforschung
- 2.3. Die soziale Umgebung als Auslöser individueller Entscheidungen?
- 2.3.1. Das Verhältnis kulturgeschichtlicher Forschung zur Literatur
- 2.4. Die räumliche Umgebung als Auslöser individueller Entscheidungen?
- 2.4.1. Gott-Mensch - Natur: Über das Verhältnis von Natur und Mensch im Mittelalter
- 2.5. Der Autor als Brücke zwischen außen- und innerliterarischer Wirklichkeit
- 3. Struktur und Aufbau des locus amoenus
- 3.1. Aufbau - Mikro- und Makrostruktur der Erzählung
- 3.2. Kippmoment
- 3.3. Gesellschaftliche Umbrüche und veränderte Selbstwahrnehmung
- 3.4. Der Einzelne in der mittelalterlichen Gesellschaft
- 3.5. Formulierung einer Theorie über die Funktionen des locus amoenus als Brennpunkt gesellschaftlicher Organisation
- 4. Hartmann von Aue - „Erec“
- 4.1. Der locus amoenus bei Hartmann
- 4.1.1. Verweilen auf Karnant
- 4.2. Der Baumgarten - ein anderes Paradies
- 4.2.1. Das Zelt Mabonagrins - ein Ort im Ort
- 4.3. Der locus terribilis bei Hartmann
- 4.3.1. Kippmoment im „Erec“
- 4.4. Erec - ein Held der Selbstreflexion
- 4.4.1. Mabonagrin
- 4.4.2. Überlegungen zur Parallelisierung Mabonagrins mit dem jungen Erec
- 4.5. Zusammenfassung
- 4.6. Interpretation
- 4.6.1. Minne- und Gesellschaftskonzeption
- 4.6.2. Die Verbindung zum Hof
- 4.6.3. Perspektivenwechsel beim Blick auf den Baumgarten
- 5. Gottfried von Straßburg - „Tristan“
- 5.1. Der locus amoenus bei Gottfried - mehr Hof als Wildnis?
- 5.2. Die Minnegrotte
- 5.2.1. Autor-Werk-Publikum. Die Minnegrotte als Höhepunkt einer dramatisch-romantischen Handlung
- 5.3. Der locus terribilis bei Gottfried
- 5.3.1. Das Kippen des locus amoenus im „Tristan“
- 5.4. Perspektivenwechsel beim Blick auf die Minnegrotte
- 5.4.1. Akzent des Perspektivenwechsels: Dreiecksbeziehung Marke-Isolde-Tristan und deren moralische Verstrickungen
- 5.4.2. Über die dichotome Darstellung der Minneproblematik im „Tristan“
- 5.5. Zusammenfassung
- 5.5.1. Die Verbindung zum Hof
- 5.5.2. Der Minnetrank als auslösender Problemfaktor der „Tristanminne“
- 5.6. Interpretation
- 5.6.1. Eine Allegorie der „wahren“ Minne?
- 5.6.2. Generationenkonflikt
- 5.6.3. Ausgliederung aus der Gesellschaft
- 6. Weitere Beispiele: „Nibelungenlied“ und „Iwein“
- 6.1. Das „Nibelungenlied“
- 6.1.1. Der locus amoenus im „Nibelungenlied“
- 6.1.2. Kippmoment des „Nibelungenlieds“
- 6.1.3. Räumliche Trennungen und Exklusivitäten in der Sphäre des locus amoenus
- 6.1.4. Resümee über die Vergleichbarkeit des „Nibelungenlieds“ mit anderen Werken des kippenden locus amoenus
- 6.1.5. Interpretation
- 6.2. „Iwein“
- 6.2.1. Der locus amoenus im „Iwein“
- 6.2.2. Das Kippen des locus amoenus im „Iwein“ Hartmanns
- 6.2.3. Interpretation
- 7. Vergleich der Romane
- 7.1. Gemeinsamkeiten der locus amoenus-Darstellungen
- 7.1.1. Abgeschiedenheit des Naturortes I: Die Trennung vom Hof
- 7.1.2. Die multisensorische Kennzeichnung der Exklusivitätsaufhebung
- 7.1.3. Abgeschiedenheit des Naturortes II: Die Verbindung zum Hof
- 7.1.4. Aufbau des locus amoenus-Motivs: Räumliche Verschachtelung
- 7.1.5. Exkurs: Die Schuld der Frauen
- 7.2. Unterschiede der Darstellungen des locus amoenus
- 7.2.1. Inszenierungen des locus amoenus mit klassischem Inventar
- 7.2.2. Minneorte und Kampfplätze - is love a battlefield?
- 8. Interpretation des locus amoenus als Schlüsselszeneder mittelalterlichen Gesellschaft
- 8.1. Kulturtheoretische Ansätze
- 8.1.1. Neuverteilung des Machtverhältnisses Kirche / Welt
- 8.1.2. Beeinflussung der Literatur um 1200 durch gesellschaftliche Verhältnisse
- 8.1.3. Die Rolle einer institutionell vermittelten Religion
- 8.2. Raum und Zeit im mittelalterlichen Erzählen
- 8.3. Der Mensch - ein Individuum?
- 8.3.1. Perspektivenwechsel: Innen- und Außenperspektive als Erkenntnisgrundlagen gesellschaftlicher Verpflichtung
- 8.3.2. Die höfische Gemeinschaft als richtende Instanz
- 8.3.3. Exkurs: Minne als individueller Weg: Triebbeherrschung als Bedingung gemeinschaftlichen Lebens
- 8.3.4. Reintegrierung Ausgeschlossener in die Gemeinschaft
- 9. Resümee über die untersuchten Funktionen des locus amoenus
- 9.1. Formal-strukturelles Element
- 9.2. Inhaltlich-abtrennendes Element
- 9.3. Überlegungen zur literaturgeschichtlichen Einreihung
- 9.3.1. Literarische Motive
- 9.3.2. Jüngste Forschung
- 9.3.3. Menschlicher Geist als Interpretationswerkzeug
- 9.4. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den „kippenden“ locus amoenus in ausgewählten mittelhochdeutschen Texten. Ziel ist die Analyse der Bedeutung und Entstehung dieses Motivs und seiner Funktion als Spiegel gesellschaftlicher Veränderungen. Die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Darstellung des locus amoenus in den untersuchten Werken werden verglichen, um eine werkübergreifende Struktur zu identifizieren.
- Der Wandel des locus amoenus zum locus terribilis
- Die Funktion des locus amoenus als Spiegel gesellschaftlicher Normen und Umbrüche
- Die Rolle des Individuums in der mittelalterlichen Gesellschaft
- Der Einfluss religiöser und weltlicher Werte auf die literarische Darstellung
- Vergleichende Analyse der ausgewählten Texte
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Zielsetzung der Arbeit: die Analyse des „kippenden“ locus amoenus in mittelhochdeutschen Texten wie Hartmanns „Erec“, Gottfrieds „Tristan“, dem „Nibelungenlied“ und Hartmanns „Iwein“. Es werden die zu untersuchenden Elemente wie Aufbau und Darstellung des locus amoenus, das Herbeiführen des Kippmoments und die Auflösung der Missverhältnisse benannt. Die Arbeit zielt auf verwertbare Interpretationsansätze zum Kippen des locus amoenus in einen locus terribilis ab, wobei die These im Vordergrund steht, dass dies eine Umstrukturierung gesellschaftlicher Normen widerspiegelt.
2. Auswahl der untersuchten Werke: Dieses Kapitel legt die methodischen und theoretischen Grundlagen der Arbeit dar. Es werden die ausgewählten Werke vorgestellt und die Konzepte der Toposforschung erläutert. Ein Schwerpunkt liegt auf der Untersuchung des Verhältnisses von sozialer und räumlicher Umgebung zu individuellen Entscheidungen im Kontext der mittelalterlichen Gesellschaft, und wie sich dies in den literarischen Werken ausdrückt.
3. Struktur und Aufbau des locus amoenus: Hier wird die Struktur und der Aufbau des locus amoenus-Motivs analysiert. Es werden Mikro- und Makrostruktur der Erzählung, das Kippmoment, gesellschaftliche Umbrüche und die Rolle des Individuums in der mittelalterlichen Gesellschaft betrachtet. Das Kapitel mündet in die Formulierung einer Theorie über die Funktionen des locus amoenus als Brennpunkt gesellschaftlicher Organisation.
4. Hartmann von Aue - „Erec“: Dieses Kapitel analysiert die Darstellung des locus amoenus und locus terribilis in Hartmanns „Erec“. Es wird der Baumgarten als idealisierter Ort beschrieben, der im Laufe der Handlung sein positives Bild verliert und in einen Ort der Gefahr und des Unglücks umschlägt. Erecs Entwicklung und seine Selbstreflexion im Kontext des Kippmoments werden detailliert untersucht. Die Minne- und Gesellschaftskonzeption des Werkes und die Verbindung zum Hof spielen dabei eine zentrale Rolle. Der Perspektivenwechsel im Blick auf den Baumgarten wird als entscheidendes Element hervorgehoben.
5. Gottfried von Straßburg - „Tristan“: Das Kapitel analysiert den „Tristan“ von Gottfried von Straßburg hinsichtlich des locus amoenus-Motivs. Im Gegensatz zu Hartmann von Aue wird hier der Hof als möglicher locus amoenus interpretiert. Die Minnegrotte als Höhepunkt der romantischen Handlung und deren dramatischer Umschwung werden untersucht. Die Dreiecksbeziehung zwischen Tristan, Isolde und Marke und deren moralische Verstrickungen werden als zentraler Aspekt des Kippmoments hervorgehoben. Die Arbeit beleuchtet den Generationenkonflikt und die Ausgliederung aus der Gesellschaft als wesentliche Themen.
6. Weitere Beispiele: „Nibelungenlied“ und „Iwein“: Dieses Kapitel erweitert die Analyse auf das „Nibelungenlied“ und Hartmanns „Iwein“. Es wird untersucht, wie der locus amoenus in diesen Werken dargestellt wird, und welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu den vorher analysierten Werken bestehen. Die Kapitel behandeln die jeweiligen Kippmomente und deren Interpretation im Kontext der jeweiligen Werke.
7. Vergleich der Romane: Dieser Abschnitt vergleicht die Darstellungen des locus amoenus in allen untersuchten Romanen. Gemeinsamkeiten wie die Abgeschiedenheit des Naturortes und seine multisensorische Kennzeichnung werden herausgestellt. Auch Unterschiede in der Inszenierung und die Beziehung zwischen Minne und Kampf werden analysiert.
8. Interpretation des locus amoenus als Schlüsselszeneder mittelalterlichen Gesellschaft: Das Kapitel bietet eine kulturtheoretische Interpretation des locus amoenus als Spiegelbild gesellschaftlicher Prozesse. Die Neuverteilung der Machtverhältnisse zwischen Kirche und Welt und der Einfluss gesellschaftlicher Verhältnisse auf die Literatur werden diskutiert. Der Fokus liegt auf dem Individuum und seiner Rolle in der höfischen Gemeinschaft. Die Bedeutung von Minne als individueller Weg und die Reintegration Ausgeschlossener werden ebenfalls thematisiert.
9. Resümee über die untersuchten Funktionen des locus amoenus: Das Schlusskapitel fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen. Es werden die formal-strukturellen und inhaltlich-abtrennenden Elemente des locus amoenus-Motivs nochmals hervorgehoben, und die literaturgeschichtliche Einordnung wird diskutiert.
Schlüsselwörter
Locus amoenus, locus terribilis, mittelhochdeutsche Literatur, Hartmann von Aue, Gottfried von Straßburg, Nibelungenlied, Iwein, mittelalterliche Gesellschaft, Minne, Kippmoment, Kulturgeschichte, Individuum, Hofkultur, religiöse und weltliche Werte.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse des „kippenden“ locus amoenus in mittelhochdeutschen Texten
Was ist der Gegenstand der vorliegenden Arbeit?
Die Arbeit analysiert das Motiv des „kippenden“ locus amoenus in ausgewählten mittelhochdeutschen Texten. Der Fokus liegt auf der Untersuchung der Bedeutung, Entstehung und Funktion dieses Motivs als Spiegel gesellschaftlicher Veränderungen.
Welche Texte werden untersucht?
Die Analyse umfasst die Werke „Erec“ von Hartmann von Aue, „Tristan“ von Gottfried von Straßburg, das „Nibelungenlied“ und „Iwein“ von Hartmann von Aue.
Was ist ein „kippender“ locus amoenus?
Ein „kippender“ locus amoenus beschreibt einen idealisierten Ort (locus amoenus), der im Verlauf der Erzählung in seinen Gegenpol, einen Ort der Gefahr und des Unheils (locus terribilis), umschlägt. Dieser Wandel spiegelt die Veränderungen in der Erzählung wider.
Welche Aspekte des locus amoenus werden untersucht?
Die Analyse betrachtet die Struktur und den Aufbau des locus amoenus, das „Kippmoment“, welches den Wandel des Ortes einleitet, und die Auflösung der entstehenden Missverhältnisse. Es werden sowohl mikro- als auch makrostrukturelle Aspekte der Erzählungen berücksichtigt.
Welche methodischen und theoretischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf Konzepte der Toposforschung und untersucht das Verhältnis von sozialer und räumlicher Umgebung zu individuellen Entscheidungen in der mittelalterlichen Gesellschaft. Der Autor sucht nach werkübergreifenden Strukturen in der Darstellung des locus amoenus.
Wie wird der locus amoenus in den einzelnen Werken analysiert?
Jedes der ausgewählten Werke wird einzeln auf die Darstellung des locus amoenus und dessen „Kippen“ hin untersucht. Die Analyse beinhaltet die Beschreibung der idealisierten Orte, den Ablauf des Wandels und die Interpretation im Kontext des jeweiligen Werkes. Besondere Aufmerksamkeit wird der Rolle der Figuren, dem Einfluss gesellschaftlicher Normen und dem Verhältnis von Minne und Kampf gewidmet.
Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede bestehen in der Darstellung des locus amoenus in den untersuchten Werken?
Die Arbeit vergleicht die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Darstellung des locus amoenus in allen vier Werken. Es werden Aspekte wie die Abgeschiedenheit des Ortes, seine multisensorische Kennzeichnung und die Beziehung zwischen Minne und Kampf analysiert. Der Vergleich ermöglicht die Identifikation werkübergreifender Strukturen.
Welche kulturtheoretische Interpretation des locus amoenus wird angeboten?
Der locus amoenus wird als Spiegelbild gesellschaftlicher Prozesse interpretiert. Die Analyse beleuchtet den Einfluss religiöser und weltlicher Werte, die Neuverteilung von Machtverhältnissen zwischen Kirche und Welt und die Rolle des Individuums in der höfischen Gemeinschaft.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit fasst die Ergebnisse zusammen und diskutiert die literaturgeschichtliche Einordnung des Motivs. Es wird die Funktion des locus amoenus als formal-strukturelles und inhaltlich-abtrennendes Element hervorgehoben. Die Bedeutung des menschlichen Geistes als Interpretationswerkzeug wird betont.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Locus amoenus, locus terribilis, mittelhochdeutsche Literatur, Hartmann von Aue, Gottfried von Straßburg, Nibelungenlied, Iwein, mittelalterliche Gesellschaft, Minne, Kippmoment, Kulturgeschichte, Individuum, Hofkultur, religiöse und weltliche Werte.
- Quote paper
- Bettina Schwabl (Author), 2013, Das Umkippen des 'locus amoenus' in einen 'locus terribilis'. Die Bruchstelle zwischen Kirche, Welt und Individuum als Spiegel freier Handlungsmöglichkeiten, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/267460