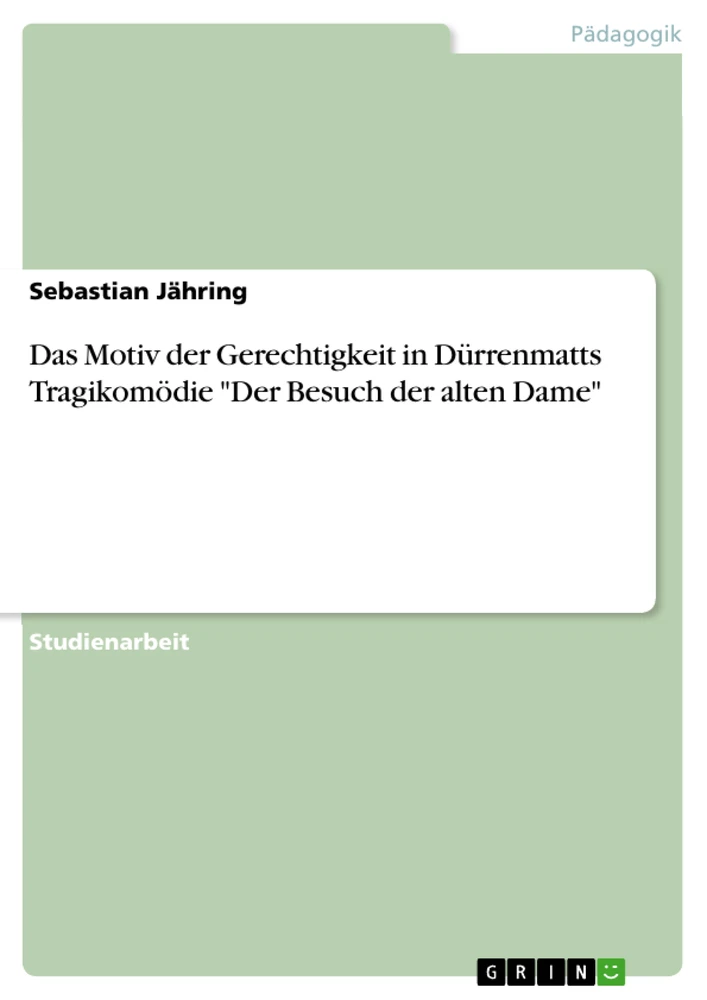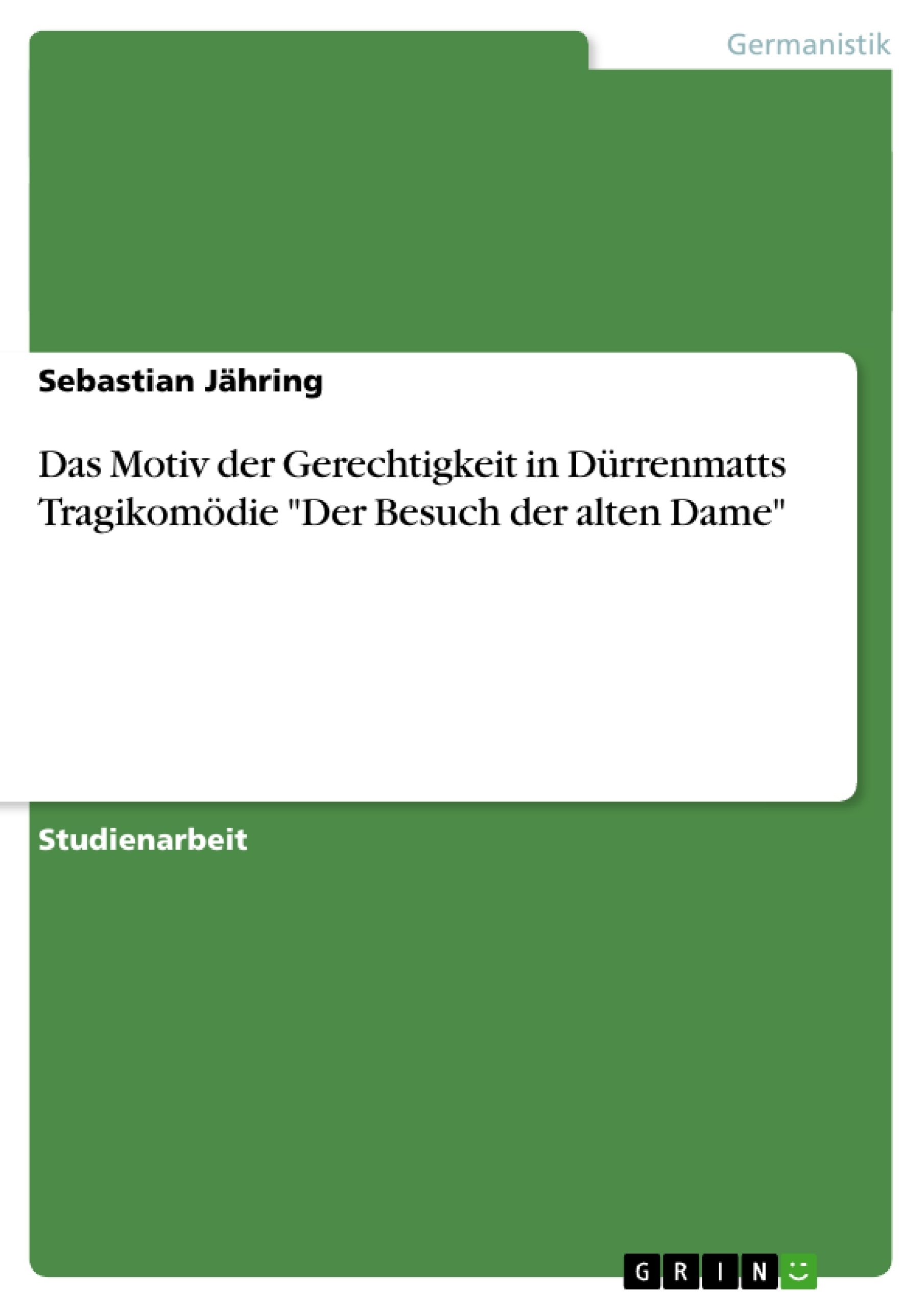Die Tragikomödie „Der Besuch der alten Dame“ verhalf dem Schweizer Autor Friedrich Dürrenmatt zum internationalen Durchbruch. Seit der Uraufführung 1956 hat das Stück an Aktualität nichts verloren und erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit.
Entstanden in der Zeit des Wirtschaftswunders der 50er Jahre, thematisiert das Stück die damit verbundenen Auswüchse in Form des moralischen Verfalls, die Ohnmacht der kulturellen Traditionen vor der neuen „Geldmacht“ und die damit verbundene Korrumpierbarkeit der Gesellschaft.
Dürrenmatt bezeichnet sich selbst als Diagnostiker, nicht als Therapeut. Er hinterlässt ein irritiertes Publikum, ohne letztendlich Lösungsvorschläge auf die aufgezeigten gesellschaftlichen Probleme zu präsentieren. Die Zuschauer selbst sollen damit zum Nachdenken und zur kritischen Reflexion der angeführten Probleme angeregt werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG
- 2. GERECHTIGKEIT NACH ALLGEMEINEM VERSTÄNDNIS
- 3. GERECHTIGKEITSAUFFASSUNGEN IN DER TRAGIKOMÖDIE
- 3.1 Claire Zachanassian
- 3.2 Das Güllener Kollektiv
- 4. DER MYTHOLOGISCHE BEZUG
- 4.1 Die Göttin Medea
- 4.2 Die Moire Klotho
- 4.3 Die Ödipus-Sage
- 4.3.1 Parallelen zu der Frauengestalt der Sphinx
- 4.3.2 Die Entwicklung des Alfred III zum tragischen Helden
- 5. FAZIT
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht das Motiv der Gerechtigkeit in Friedrich Dürrenmatts Tragikomödie „Der Besuch der alten Dame“. Ziel ist es, verschiedene Gerechtigkeitsauffassungen im Stück zu analysieren und diese mit dem allgemeinen Verständnis von Gerechtigkeit zu vergleichen. Die Arbeit beleuchtet auch mythologische Bezüge, die zur Thematik beitragen.
- Das Verständnis von Gerechtigkeit im Allgemeinen
- Die divergierenden Gerechtigkeitsauffassungen der Figuren (Claire Zachanassian, Alfred Ill, das Kollektiv von Güllen)
- Die Rolle der Rache im Kontext von Gerechtigkeit
- Mythologische Parallelen und ihre Bedeutung für die Thematik
- Die Kritik an gesellschaftlichen Strukturen und moralischem Verfall
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt Dürrenmatts „Der Besuch der alten Dame“ als eine Tragikomödie vor, die trotz ihres Entstehens im Wirtschaftswunder der 50er Jahre an Aktualität nichts verloren hat. Das Stück thematisiert den moralischen Verfall und die Korrumpierbarkeit der Gesellschaft durch die „Geldmacht“. Dürrenmatt wird als Diagnostiker beschrieben, der gesellschaftliche Probleme aufzeigt, ohne explizite Lösungsansätze zu bieten. Die Arbeit konzentriert sich auf die Untersuchung des zentralen Motivs von Recht und Gerechtigkeit im Stück.
2. Gerechtigkeit nach allgemeinem Verständnis: Dieses Kapitel beleuchtet den Begriff der Gerechtigkeit aus verschiedenen Perspektiven. Neben der humanistischen Sichtweise, die Gerechtigkeit als Tugend und Achtung des Rechts jedes Einzelnen definiert, werden psychologische Aspekte betrachtet. Die Arbeit bezieht sich auf Platon, der Gerechtigkeit zu den Kardinaltugenden zählte, und auf Erich Fromm, der ein elementares Gerechtigkeitsgefühl im Menschen verortet, das aus einem Gefühl der existenziellen Gleichheit aller Menschen stammt. Der Bezug auf Melvin Lerner unterstreicht das menschliche Bedürfnis nach einer gerechten Welt, in der jeder bekommt, was er verdient. Das Kapitel legt somit ein Fundament für die spätere Analyse der verschiedenen Gerechtigkeitsauffassungen innerhalb des Stücks.
3. Gerechtigkeitsauffassungen in der Tragikomödie: Dieses Kapitel analysiert die unterschiedlichen Perspektiven auf Gerechtigkeit, wie sie von den Hauptfiguren repräsentiert werden. Es werden die Gerechtigkeitsvorstellungen von Claire Zachanassian und dem Kollektiv von Güllen untersucht und miteinander verglichen. Die unterschiedlichen Interpretationen und Instrumentalisierungen des Begriffs „Gerechtigkeit“ werden im Detail beleuchtet, um die Komplexität der Thematik im Stück herauszuarbeiten. Die unterschiedlichen Perspektiven werden analysiert und deren Auswirkungen auf das Geschehen in Güllen diskutiert.
4. Der mythologische Bezug: Dieses Kapitel untersucht die mythologischen Bezüge in Dürrenmatts Stück. Die Göttin Medea, die Moire Klotho und die Ödipus-Sage werden als Parallelen zu den Figuren und der Handlung herangezogen. Die Analyse der Parallelen zwischen der Sphinx und Claire Zachanassian sowie die Entwicklung Alfreds III zum tragischen Helden beleuchten die tiefgründigen und komplexen Themen des Stücks, vor allem die Frage nach Schuld, Verantwortung und Gerechtigkeit im Kontext von Macht und Moral.
Schlüsselwörter
Gerechtigkeit, Rache, Tragikomödie, Friedrich Dürrenmatt, „Der Besuch der alten Dame“, Claire Zachanassian, Güllen, Moral, Gesellschaft, Mythologie, Medea, Ödipus, Schuld, Verantwortung, Geldmacht.
Häufig gestellte Fragen zu Dürrenmatts "Der Besuch der alten Dame"
Was ist der Inhalt dieser Seminararbeit?
Diese Seminararbeit analysiert das Motiv der Gerechtigkeit in Friedrich Dürrenmatts Tragikomödie "Der Besuch der alten Dame". Sie untersucht verschiedene Gerechtigkeitsauffassungen im Stück, vergleicht diese mit dem allgemeinen Verständnis von Gerechtigkeit und beleuchtet mythologische Bezüge, die die Thematik unterstützen. Die Arbeit umfasst eine Einleitung, Kapitel zu Gerechtigkeit im allgemeinen Verständnis, Gerechtigkeitsauffassungen in der Tragikomödie (fokussiert auf Claire Zachanassian und das Kollektiv von Güllen), mythologische Bezüge (Medea, Klotho, Ödipus-Sage), und ein Fazit. Schlüsselwörter umfassen Gerechtigkeit, Rache, Tragikomödie, Dürrenmatt, Claire Zachanassian, Güllen, Moral, Gesellschaft, Mythologie, Medea, Ödipus, Schuld, Verantwortung und Geldmacht.
Welche Gerechtigkeitsauffassungen werden im Stück analysiert?
Die Arbeit analysiert divergierende Gerechtigkeitsauffassungen der Hauptfiguren: Claire Zachanassian, Alfred Ill und das Kollektiv von Güllen. Es wird untersucht, wie der Begriff „Gerechtigkeit“ von diesen Figuren interpretiert und instrumentalisiert wird, um die Komplexität der Thematik zu verdeutlichen. Die unterschiedlichen Perspektiven und deren Auswirkungen auf das Geschehen in Güllen werden im Detail beleuchtet.
Welche Rolle spielt die Mythologie in der Analyse?
Die Arbeit zieht mythologische Parallelen heran, um die Thematik zu vertiefen. Die Göttin Medea, die Moire Klotho und die Ödipus-Sage werden als Parallelen zu den Figuren und der Handlung analysiert. Besonders werden die Parallelen zwischen der Sphinx und Claire Zachanassian sowie die Entwicklung Alfreds III zum tragischen Helden untersucht, um die tiefgründigen Themen Schuld, Verantwortung und Gerechtigkeit im Kontext von Macht und Moral zu beleuchten.
Wie wird Gerechtigkeit im allgemeinen Verständnis definiert?
Das Kapitel über das allgemeine Verständnis von Gerechtigkeit betrachtet den Begriff aus verschiedenen Perspektiven, einschließlich humanistischer Sichtweisen (Gerechtigkeit als Tugend und Achtung des Rechts jedes Einzelnen), psychologischer Aspekte (existenzielle Gleichheit aller Menschen, Bedürfnis nach einer gerechten Welt) und bezieht sich auf Philosophen wie Platon und Erich Fromm sowie auf die Forschung von Melvin Lerner.
Welche Kapitel umfasst die Seminararbeit?
Die Seminararbeit gliedert sich in fünf Kapitel: 1. Einleitung, 2. Gerechtigkeit nach allgemeinem Verständnis, 3. Gerechtigkeitsauffassungen in der Tragikomödie, 4. Der mythologische Bezug und 5. Fazit (letzteres wird in der gegebenen Vorschau nicht explizit zusammengefasst).
Welche Zielsetzung verfolgt die Seminararbeit?
Die Seminararbeit hat zum Ziel, verschiedene Gerechtigkeitsauffassungen in Dürrenmatts "Der Besuch der alten Dame" zu analysieren und diese mit dem allgemeinen Verständnis von Gerechtigkeit zu vergleichen. Sie beleuchtet die Rolle der Rache im Kontext von Gerechtigkeit, mythologische Parallelen und die Kritik an gesellschaftlichen Strukturen und moralischem Verfall.
- Quote paper
- Sebastian Jähring (Author), 2012, Das Motiv der Gerechtigkeit in Dürrenmatts Tragikomödie "Der Besuch der alten Dame", Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/267007