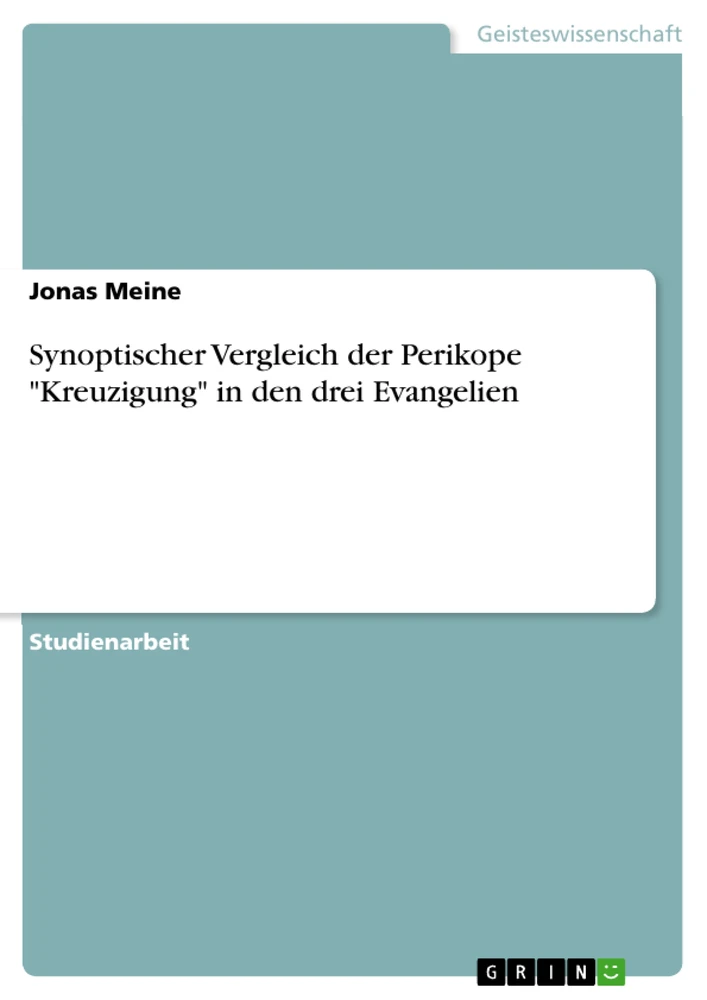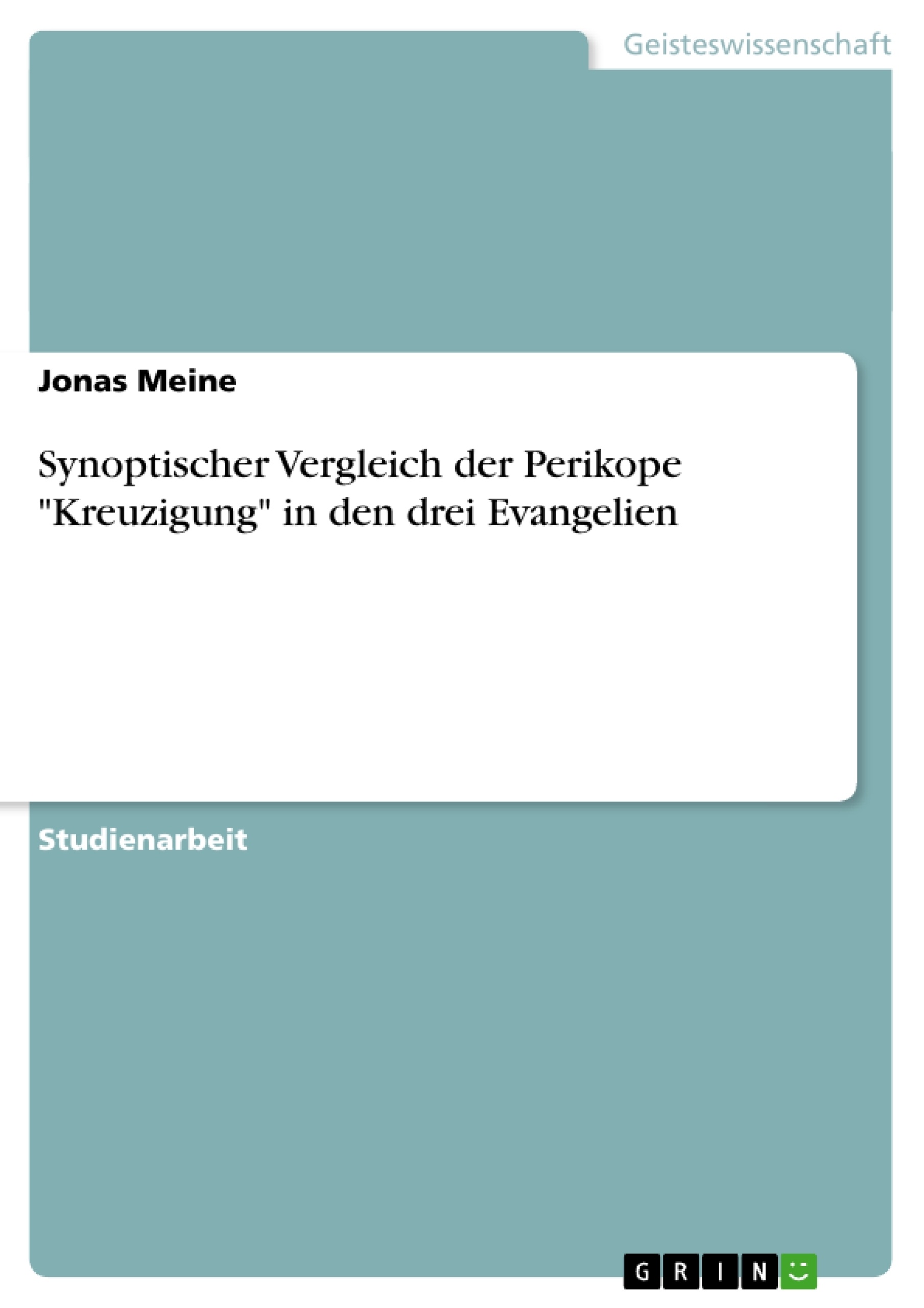Der vorliegende synoptische Vergleich bezieht sich auf die Perikope der Kreuzigung. Diese ist bei den drei Evangelien in der Passionsgeschichte zu verorten. Als Textvorlage dient die Bibel in der Lutherübersetzung von 1984. Das Johannesevangelium wurde in dieser Arbeit nicht berücksichtigt, da es nicht zu den synoptischen Evangelien gehört.
Im Allgemeinen wird davon ausgegangen, dass Markus der erste Evangelist war. Seine Schrift diente, laut Zwei- Quellen Theorie, den Seitenreferenten, neben der gemeinsamen Logienquelle Q und jeweiligen Sondergütern, als Vorlage. Dieser Arbeit liegt die Zwei- Quellen- Theorie zugrunde.
Für eine bessere Übersicht befinden sich im Anhang die Perikopen in den Versionen nach Markus, Matthäus und Lukas in einer dreispaltigen Tabelle. Weiterhin verdeutlicht je eine spezifische Tabelle die Unterschiede der jeweiligen Autoren. Die farblichen Markierungen bzw. Unterlegungen verdeutlichen visuell die Unterschiede der einzelnen Evangelien.
Da dieser Vergleich davon ausgeht, dass Markus der erste Evangelist und erster Verfasser dieser Perikope war, wird ihm ein besonderes Augenmerk zukommen. Es folgt der synoptische Vergleich, die Perikopen werden jeweils getrennt voneinander betrachtet, anschließend folgt eine Skizzierung der Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Aufgrund der besseren Lesbarkeit, wird die männliche Schreibweise verwendet.
Im Anschluss werden die drei parallel verfassten Texte verglichen, der folgende synoptische Vergleich zwischen Matthäus und Lukas soll die Nutzung des Sondergutes der beiden Autoren unterstreichen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Grundlagen / Grundannahmen
- 2.1 Zweiquellentheorie
- 2.3 Tabellarische Übersicht der drei Evangelien
- 3. Kurze Analyse der Markus-Perikope
- 3.1 Exkurs: Kreuzigung
- 3.2 Synoptischer Vergleich der Perikope „Kreuzigung“ zwischen Matthäus (Mt. 27,33-44;48) und Markus (Mk. 15,22-32;36)
- 3.3 Traditionen und Adressaten der beiden Evangelien
- 3.4 Synoptischer Vergleich Markus / Matthäus
- 3.5 Fazit des Vergleichs
- 4. Synoptischer Vergleich zwischen Markus (Mk. 15,22) und Lukas (Lk.23,33-43)
- 4.1 Traditionen und Adressaten des Lukas
- 4.2 Synoptischer Vergleich Markus/ Lukas
- 4.3 Fazit des Vergleichs
- 5. Gemeinsamkeiten der drei Evangelien in der Perikope „Kreuzigung“
- 5.1 Parallelen der drei Evangelien
- 5.2 Sondergut der Seitenreferenten
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit verfolgt das Ziel, einen synoptischen Vergleich der Kreuzigungsperikope in den Evangelien nach Markus, Matthäus und Lukas durchzuführen. Die Analyse konzentriert sich auf die Identifizierung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden im Text, um Rückschlüsse auf die Entstehung und die Intentionen der jeweiligen Evangelisten zu ziehen. Die Zweiquellentheorie bildet die Grundlage der Analyse.
- Synoptischer Vergleich der Kreuzigungsperikope
- Analyse der literarischen Abhängigkeit der Evangelien
- Untersuchung der Traditionen und Adressaten der Evangelien
- Bewertung der Rolle des Sondergutes in Matthäus und Lukas
- Anwendung der Zweiquellentheorie
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Umfang und die Methodik der vorliegenden Arbeit. Der Fokus liegt auf dem synoptischen Vergleich der Kreuzigungsperikope in den Evangelien nach Markus, Matthäus und Lukas, wobei das Johannesevangelium explizit ausgeschlossen wird. Die Arbeit basiert auf der Zweiquellentheorie und nutzt die Lutherbibel von 1984 als Textgrundlage. Der Anhang enthält Tabellen zur besseren Visualisierung der textlichen Unterschiede.
2. Grundlagen / Grundannahmen: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen der Arbeit dar. Es wird die Annahme einer literarischen Abhängigkeit der drei synoptischen Evangelien begründet und die Zweiquellentheorie als methodische Grundlage eingeführt und grafisch veranschaulicht. Die Entstehung und die vermuteten Autoren der einzelnen Evangelien werden kurz skizziert, inklusive der Diskussion um die Logienquelle „Q“ und das „Sondergut“ der jeweiligen Evangelisten.
3. Kurze Analyse der Markus-Perikope: Dieses Kapitel bietet eine detaillierte Analyse der Kreuzigungsperikope im Markusevangelium. Es wird die Struktur des Textes beleuchtet, der Fokus des Autors auf die Reaktion der Umstehenden und die alten Traditionen (Kleiderteilung, Hinrichtungsschrift) hervorgehoben. Die Darstellung Jesu als einsamer Leidender wird betont. Ein Exkurs erläutert die historische Praxis der römischen Kreuzigung und ihren Kontext.
4. Synoptischer Vergleich zwischen Markus (Mk. 15,22) und Lukas (Lk.23,33-43): Hier erfolgt ein detaillierter Vergleich zwischen den Kreuzigungsberichten von Markus und Lukas. Der Vergleich wird systematisch durchgeführt und analysiert die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der beiden Texte. Die jeweiligen Traditionen und Adressaten der Evangelisten werden berücksichtigt. Die Analyse konzentriert sich auf die Nutzung des Sondergutes in Lukas.
5. Gemeinsamkeiten der drei Evangelien in der Perikope „Kreuzigung“: Dieses Kapitel fasst die Gemeinsamkeiten der drei Evangelien in der Darstellung der Kreuzigung zusammen. Es werden Parallelen herausgearbeitet und das Sondergut der einzelnen Evangelisten wird im Kontext der Gemeinsamkeiten diskutiert. Der Fokus liegt auf dem Vergleich der übereinstimmenden Elemente und deren Interpretation im Licht der Zweiquellentheorie.
Schlüsselwörter
Synoptische Evangelien, Markusevangelium, Matthäusevangelium, Lukasevangelium, Zweiquellentheorie, Logienquelle Q, Sondergut, Kreuzigungsperikope, Passionsgeschichte, literarische Abhängigkeit, Textvergleich, Traditionen, Adressaten, Römische Kreuzigung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur synoptischen Analyse der Kreuzigungsperikope
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Kreuzigungsperikope in den synoptischen Evangelien (Markus, Matthäus, Lukas) mittels eines synoptischen Vergleichs. Das Johannesevangelium wird explizit ausgeschlossen. Die Analyse konzentriert sich auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Text, um Rückschlüsse auf die Entstehung und Intentionen der jeweiligen Evangelisten zu ziehen.
Welche Methode wird angewendet?
Die Arbeit basiert auf der Zweiquellentheorie und verwendet die Lutherbibel von 1984 als Textgrundlage. Ein synoptischer Vergleich der Texte bildet die zentrale Methode, um literarische Abhängigkeiten und das sogenannte "Sondergut" der einzelnen Evangelien zu identifizieren und zu interpretieren.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung, Grundlagen/Grundannahmen, Analyse der Markus-Perikope, Synoptischer Vergleich Markus/Lukas, Gemeinsamkeiten der drei Evangelien und Fazit. Jedes Kapitel untersucht einen spezifischen Aspekt der Kreuzigungsperikope und trägt zum Gesamtverständnis bei.
Was wird in den Grundlagen/Grundannahmen behandelt?
Dieses Kapitel erläutert die Zweiquellentheorie und ihre Bedeutung für die Analyse. Es beschreibt die Entstehung der synoptischen Evangelien, die vermuteten Autoren und die Konzepte der Logienquelle "Q" und des "Sondergutes".
Wie wird die Markus-Perikope analysiert?
Die Analyse der Markus-Perikope konzentriert sich auf die Textstruktur, die Reaktion der Umstehenden, alte Traditionen (Kleiderteilung, Hinrichtungsschrift) und die Darstellung Jesu als einsamen Leidenden. Ein Exkurs beleuchtet die historische Praxis der römischen Kreuzigung.
Wie wird der Vergleich zwischen Markus und Lukas durchgeführt?
Der Vergleich zwischen Markus und Lukas analysiert systematisch die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Kreuzigungsberichte. Dabei werden die Traditionen und Adressaten der jeweiligen Evangelisten berücksichtigt, mit besonderem Fokus auf das Sondergut in Lukas.
Welche Gemeinsamkeiten der drei Evangelien werden hervorgehoben?
Dieses Kapitel fasst die übereinstimmenden Elemente in der Darstellung der Kreuzigung zusammen, untersucht Parallelen und diskutiert das Sondergut im Kontext dieser Gemeinsamkeiten. Die Interpretation erfolgt im Licht der Zweiquellentheorie.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Die Arbeit wird durch folgende Schlüsselwörter beschrieben: Synoptische Evangelien, Markusevangelium, Matthäusevangelium, Lukasevangelium, Zweiquellentheorie, Logienquelle Q, Sondergut, Kreuzigungsperikope, Passionsgeschichte, literarische Abhängigkeit, Textvergleich, Traditionen, Adressaten, Römische Kreuzigung.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, einen synoptischen Vergleich der Kreuzigungsperikope durchzuführen, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu identifizieren und Rückschlüsse auf die Entstehung und Intentionen der Evangelisten zu ziehen. Die Anwendung der Zweiquellentheorie ist zentral.
Welche Textgrundlage wird verwendet?
Die Arbeit verwendet die Lutherbibel von 1984 als Textgrundlage für die Analyse.
- Quote paper
- Jonas Meine (Author), 2012, Synoptischer Vergleich der Perikope "Kreuzigung" in den drei Evangelien, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/266737