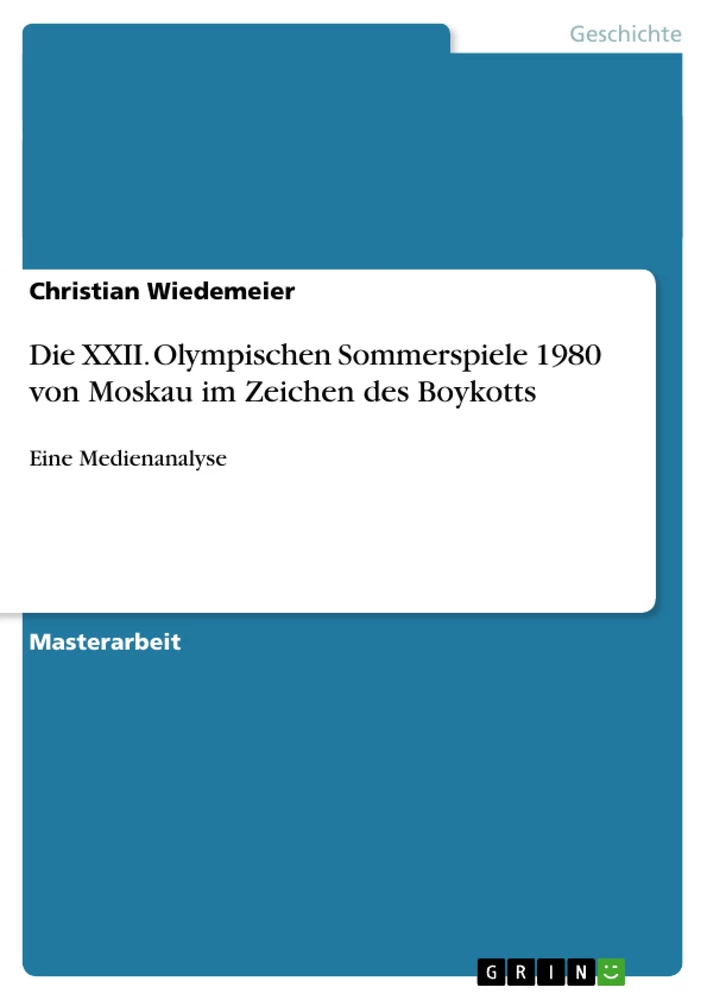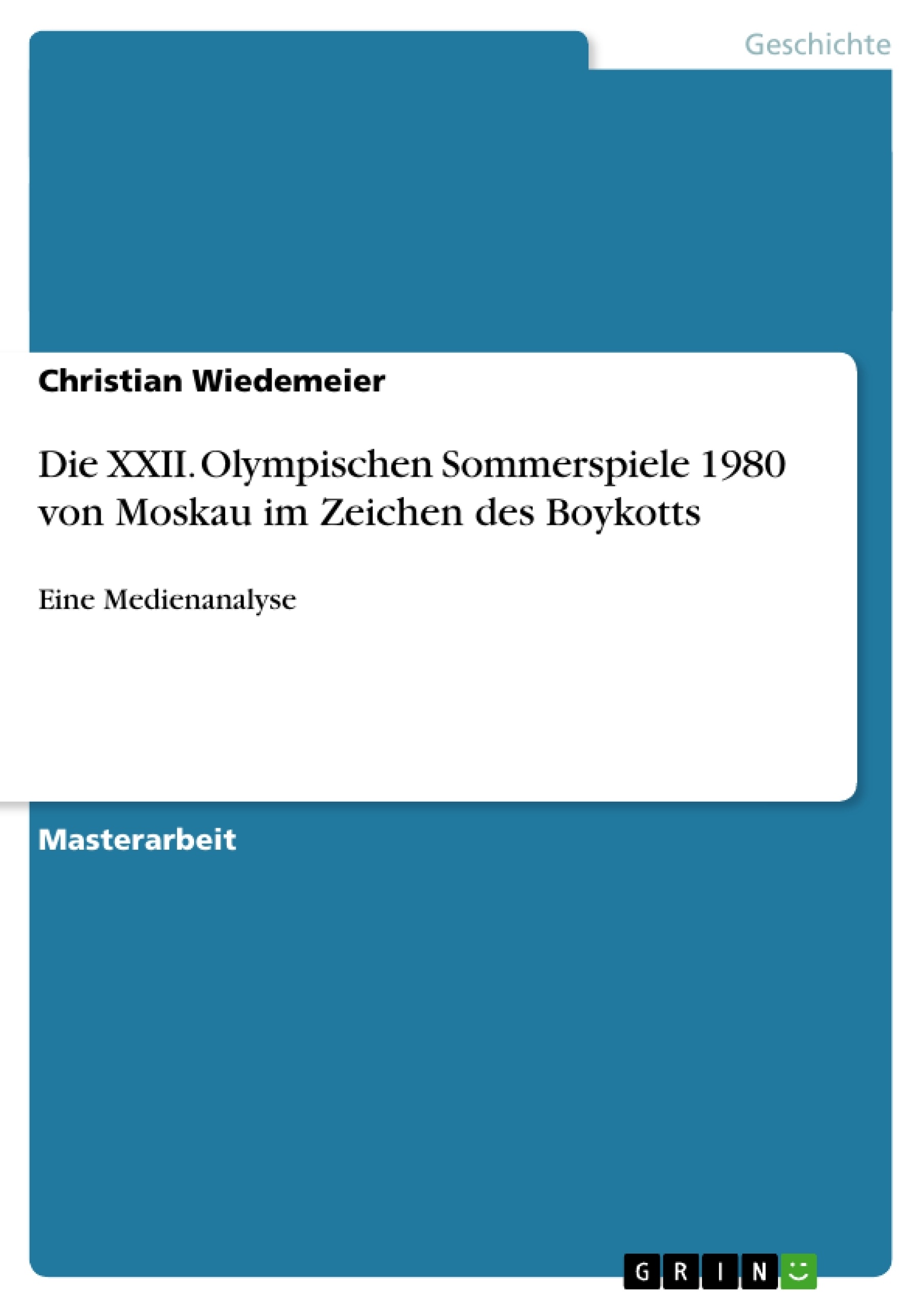„Das Glockenspiel vom Kreml läutete Olympia ein oder das, was davon übrig blieb. Moskau bot eine Ouvertüre von Weihe und Wucht. Gigantisches Marionettenspiel. (...) Von der Zurschaustellung kerniger Jugend nach der Leitbildung der Körperkultur bis zum Paradeschritt, mit dem sie die Olympiaflagge zu Beethovens Hymne an die Freude ins Stadion trugen. (...) Hundert Völker der Sowjetunion in sozialistischer Lebensfreude vereint. Brot und Spiele wie im alten römischen Kaiserreich. Kriegshelden und Gladiatoren werden ähnlich pompös in das Kolosseum eingezogen sein. Ja, sogar ein römischer Feldherrenwagen – welch peinlicher Kitsch – durfte in Moskau nicht fehlen. Fanfaren schmettern, Tauben schwirren auf – offenbar haben sie aber die Friedenspost für Afghanistan liegenlassen. Mixtur aus byzantinischem Pomp und sozialistischem Bombasmus. Gesten des Protests. Die Magier aus dem Kreml ersparten den Fernsehzuschauern im Lande und in aller Welt den Blick auf die störenden Olympiafahnen. Der Kommentator des sowjetischen Fernsehens nannte die Demonstration einen plumpen Komplott, der fehlgeschlagen ist und erklärte, es handele sich um Länder, in denen die Sportler im Konflikt mit ihren Regierungen lebten. Trauer muß Olympia tragen. (…) Als ihn (Breschnew, Anmerkung des Verfassers) der Beifall von den Rängen des Leninstadions erreichte und durch keinen einzigen Pfiff gestört wurde, hob er den rechten Arm, kein Winken – halb Segen, halb imperiale Geste. Im Gänsemarsch folgten die top twenty der sowjetischen Nomenklatur. Im großen Geviert zwischen der Uniformierten-Kette am Rande der Aschenbahn und dem steinernen Baldachin der Führung gruppierte sich die Creme der sowjetischen Gesellschaft. Die Begleiterinnen der Dekorierten schienen bisweilen westlichen Modejournalen entstiegen.“.
So beschrieb die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) am 19. Juli 1980 ihre Eindrücke von der Eröffnungsfeier der XXII. Olympischen Sommerspiele in Moskau. Der fünfte IOC-Präsident Avery Brundage bezeichnete Olympia einst als „die größte soziale Kraft dieser Welt.“ Seine Begründung: „Wo anders kann man Kommunisten, Kapitalisten, Royalisten und Sozialisten vereint marschieren sehen, wenn nicht bei den Olympischen Spielen.“ Doch 1980 in Moskau war es anders, wie die Schilderung der FAZ schon ahnen lässt, wo abfällige Äußerungen über den Sozialismus und Begriffe wie Protest oder Komplott fielen. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Olympische Spiele, Politik und Medien
- Die deutsche Sportberichterstattung der 1980er Jahre
- Methode und Grundlagen der Untersuchung
- Der Boykott von Moskau — Eine Medieninhaltsanalyse
- Die NATO erwägt erstmals einen Boykott der Olympischen Sommerspiele
- Die 82. IOC-Session in Lake Placid
- Das US-amerikanische IOC überlässt Präsident Carter die Teilnahmeentscheidung
- Internationale Sportlerinitiativen fur Olympia
- Die Idee einer „Gegen-Olympiade"
- Britisches NOK entscheidet sich fur eine Teilnahme
- Die Bundesregierung rät dem NOK von einer Olympiateilnahme ab
- Das NOK der Vereinigten Staaten entscheidet gegen eine Olympiateilnahme
- Reaktionen auf den Rat der Bundesregierung
- Der einflussreiche DSB-Präsident Willi Weyer
- Die entscheidende Sitzung des NOKs der Bundesrepublik
- Die Olympiavorbereitungen
- Die 83. IOC-Session in Moskau
- Die XXII. Olympischen Sommerspiele von Moskau
- Die Olympiaberichterstattung in Ost und West
- Abschlussfeier und Fazit der Presse
- Fazit
- Die Bedeutung der Medien in der Boykottdebatte
- Die Standpunkte der Zeitungen
- Bibliographie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Masterarbeit befasst sich mit der medialen Berichterstattung über den Boykott der Olympischen Sommerspiele 1980 in Moskau. Anhand einer Medieninhaltsanalyse von drei deutschen Tageszeitungen, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (BRD), der Frankfurter Rundschau (BRD) und Neues Deutschland (DDR), wird die chronologische Entwicklung der Boykottdebatte im Zeitraum vom 1. Januar bis zum 6. August 1980 untersucht.
- Die Rolle der Politik in der Boykottdebatte
- Die Bedeutung der Medien für die Meinungsbildung in der Boykottfrage
- Der Einfluss von Sportlern auf die Boykottentscheidung
- Die Folgen des Boykotts für die olympische Bewegung
- Die unterschiedlichen Perspektiven der deutschen Presse auf den Boykott
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und den methodischen Ansatz der Arbeit vor. Sie beleuchtet den Zusammenhang zwischen Sport, Politik und Medien und skizziert die deutsche Sportberichterstattung in den 1980er Jahren. Der Schwerpunkt des zweiten Kapitels liegt auf der Analyse der Medienberichterstattung über die Boykottdebatte. Die einzelnen Abschnitte dieses Kapitels beleuchten die chronologische Entwicklung der Boykottdiskussionen, die Reaktionen von Politikern, Sportlern und Medien sowie die Rolle des IOC.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Boykott der Olympischen Sommerspiele 1980 in Moskau, die Rolle der Politik und der Medien in der Boykottdebatte, die Reaktionen von Sportlern und Funktionären sowie die Folgen des Boykotts für die olympische Bewegung. Die Arbeit analysiert die Berichterstattung von drei deutschen Tageszeitungen, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der Frankfurter Rundschau und Neues Deutschland, um die unterschiedlichen Perspektiven auf den Boykott zu beleuchten.
- Quote paper
- B.A. Christian Wiedemeier (Author), 2010, Die XXII. Olympischen Sommerspiele 1980 von Moskau im Zeichen des Boykotts, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/265109