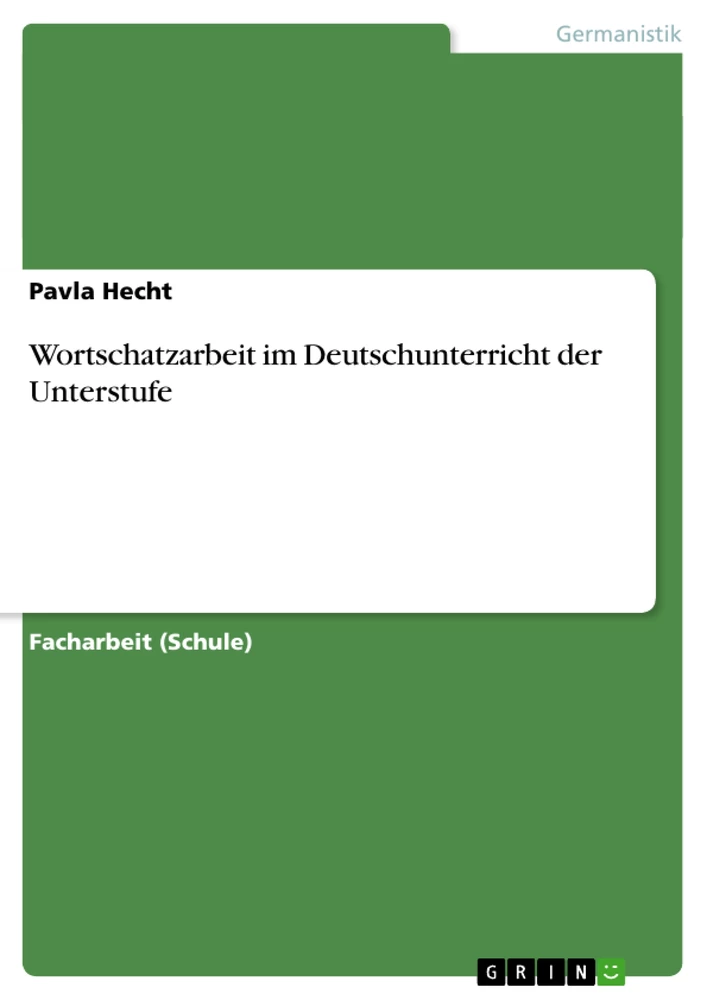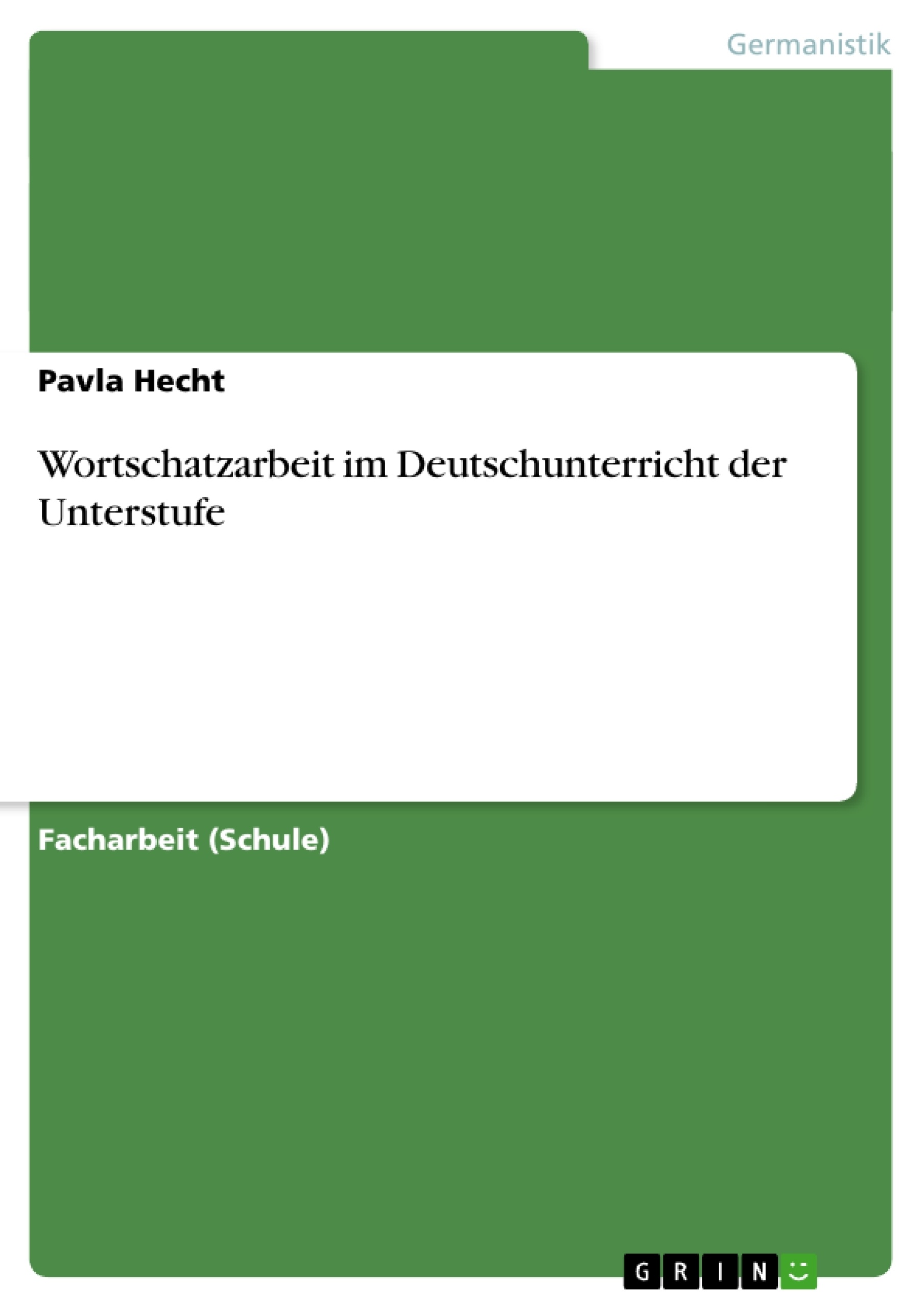„Deutsch kann man nicht lernen.“ Diesen Satz hört irgendwann jede Deutschlehrkraft. Meistens wird er von denjenigen ausgesprochen, die Schwierigkeiten in diesem Fach haben – vor allem im Wortschatzbereich. In ihren Aufsätzen werden Wörter markiert und mit der Korrekturbemerkung „Ausdruck“ versehen. Was es im konkreten Fall bedeutet, verstehen sie nur wenig. Sie merken bloß, dass auch ihre mündlichen Beiträge nicht immer gut bewertet werden, obwohl der Inhalt stimmt – oder sie sind nicht im Stande, ihre Gedanken in korrekte Sätze zu fassen. Diese Fehler wiederholen sich immer wieder und die Schülerinnen und Schüler wissen zu wenig, wie sie sie vermeiden könnten. Der Wortschatzmangel wirkt sich auch in anderen Bereichen aus: die eigene kognitive und kommunikative Kompetenz wird eingeschränkt und es folgen schlechtere Noten auch in anderen Fächern. Daher ist die Förderung von Wortschatzarbeit für alle Fächer zentral.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Notwendigkeit der Wortschatzarbeit im Deutschunterricht
- 2. Überblick über den aktuellen Forschungsstand
- 2.1 Umfang und Dynamik des Wortschatzes
- 2.2 Wortschatzerweiterung und -vertiefung
- 2.3 Zweitspracherwerb
- 2.4 Zusammenhang von Wortschatzerwerb, sozialem Milieu und Schulerfolg
- 2.5 Wortschatzerweiterung im Rahmen des Deutschunterrichts
- 3. Umgang mit den Positionen und Projektplanung
- 3.1 Lernansätze im Bereich Isolieren und Semantisieren
- 3.2 Lernansätze im Bereich Variieren und Vernetzen
- 3.3 Lernansätze im Bereich Reaktivierung und Verwendung
- 3.4 Grundlegende Lernziele
- 3.5 Die konkrete Zielsetzung
- 4. Projektanalyse und Erfahrungsschilderung
- 4.1 Lernbereich: Deutsche Literatur des Mittelalters
- 4.2 Lernbereich: Begründete Stellungnahme
- 4.3 Lernbereich: Balladen und Kurzgeschichten
- 4.4 Lernbereich: Jahrgangsstufentest
- 5. Evaluation und Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Notwendigkeit systematischer Wortschatzarbeit im Deutschunterricht und analysiert den aktuellen Forschungsstand zum Thema Wortschatzerwerb. Ziel ist es, Lernansätze für eine effektive Wortschatzerweiterung und -vertiefung zu präsentieren und anhand eines konkreten Projekts zu evaluieren.
- Notwendigkeit systematischer Wortschatzarbeit im Deutschunterricht
- Aktueller Forschungsstand zum Wortschatzerwerb (Umfang, Dynamik, Erweiterung, Vertiefung)
- Lernansätze zur Wortschatzarbeit (Isolieren, Semantisieren, Variieren, Vernetzen, Reaktivierung)
- Analyse eines konkreten Projekts zur Wortschatzerweiterung
- Evaluation und Resümee der Projekterfahrungen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Notwendigkeit der Wortschatzarbeit im Deutschunterricht: Der einleitende Abschnitt betont die zentrale Bedeutung von Wortschatzkenntnissen für den Schulerfolg und die kognitive sowie kommunikative Kompetenz. Er kritisiert den Mangel an systematischer Wortschatzarbeit im Deutschunterricht, obwohl gerade im Bereich des Wortschatzes Defizite bei vielen Schülern auffallen. Es wird argumentiert, dass der intuitive Wortschatzerwerb nicht ausreicht und ein bewusster Aneignungsprozess notwendig ist, um ein solides semantisches Netzwerk zu schaffen, welches es den Schülern erlaubt, sowohl zu verstehen als auch verstanden zu werden.
2. Überblick über den aktuellen Forschungsstand: Dieses Kapitel beleuchtet den aktuellen Forschungsstand zum Thema Wortschatz. Es definiert den Umfang und die Dynamik des deutschen Wortschatzes, differenziert zwischen aktivem und passivem Wortschatz und beschreibt die Organisation des „mentalen Lexikons“ im Langzeitgedächtnis. Der Prozess der Wortschatzerweiterung und -vertiefung wird detailliert erläutert, wobei die Rolle des Weltwissens und die Bedeutung von Kontextualisierung hervorgehoben werden. Der Unterschied zwischen dem Wortschatzerwerb von Kindern und Erwachsenen wird ebenfalls thematisiert. Die verschiedenen Aspekte des mentalen Lexikons und das Modell der Kernbedeutung werden erläutert.
3. Umgang mit den Positionen und Projektplanung: Dieses Kapitel beschreibt verschiedene Lernansätze für die Wortschatzarbeit. Es gliedert diese Ansätze in die Bereiche Isolieren und Semantisieren, Variieren und Vernetzen sowie Reaktivierung und Verwendung. Die Kapitel beschreiben unterschiedliche Methoden, um die Lernenden an den Wortschatz heranzuführen und die Wörter effektiv zu lernen. Darüber hinaus werden die grundlegenden Lernziele und die konkrete Zielsetzung des dargestellten Projekts definiert. Die methodische Ausrichtung und praktische Umsetzung des Projekts sind hier die zentralen Themen.
4. Projektanalyse und Erfahrungsschilderung: In diesem Kapitel wird ein konkretes Projekt zur Wortschatzarbeit analysiert. Es werden Erfahrungen aus verschiedenen Lernbereichen wie der deutschen Literatur des Mittelalters, der begründeten Stellungnahme, Balladen und Kurzgeschichten sowie dem Jahrgangsstufentest berichtet. Die Beschreibung konzentriert sich auf die praktische Anwendung der in Kapitel 3 beschriebenen Lernansätze und deren Wirkung auf den Wortschatzerwerb der Schüler. Die jeweiligen Lernbereiche geben Einblicke in unterschiedliche literarische Genres und Schreibaufgaben, sowie die Auseinandersetzung mit entsprechenden Wortschatz-Komponenten.
Schlüsselwörter
Wortschatzarbeit, Deutschunterricht, Wortschatzerwerb, mentales Lexikon, Wortschatzerweiterung, Wortschatzvertiefung, Lernansätze, Projektanalyse, Evaluation, kognitive Kompetenz, kommunikative Kompetenz, Semantik, Polysemie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Wortschatzarbeit im Deutschunterricht
Was ist das Thema der vorliegenden Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Notwendigkeit systematischer Wortschatzarbeit im Deutschunterricht und analysiert den aktuellen Forschungsstand zum Thema Wortschatzerwerb. Ziel ist die Präsentation und Evaluation von Lernansätzen für eine effektive Wortschatzerweiterung und -vertiefung anhand eines konkreten Projekts.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: 1. Notwendigkeit der Wortschatzarbeit im Deutschunterricht; 2. Überblick über den aktuellen Forschungsstand; 3. Umgang mit den Positionen und Projektplanung; 4. Projektanalyse und Erfahrungsschilderung; 5. Evaluation und Resümee. Jedes Kapitel behandelt spezifische Aspekte des Themas, beginnend mit der Begründung der Wichtigkeit von Wortschatz bis hin zur praktischen Anwendung und Auswertung eines konkreten Projektes.
Welche Forschungsfragen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit Fragen nach der Notwendigkeit systematischer Wortschatzarbeit, dem aktuellen Forschungsstand zum Wortschatzerwerb (Umfang, Dynamik, Erweiterung, Vertiefung), effektiven Lernansätzen (Isolieren, Semantisieren, Variieren, Vernetzen, Reaktivierung), der Analyse eines konkreten Projekts zur Wortschatzerweiterung und der Evaluation der Projekterfahrungen.
Welche Lernansätze werden in der Arbeit vorgestellt?
Die Arbeit präsentiert verschiedene Lernansätze, die in die Bereiche Isolieren und Semantisieren, Variieren und Vernetzen sowie Reaktivierung und Verwendung eingeteilt werden. Diese Ansätze beschreiben unterschiedliche Methoden, um den Lernenden den Zugang zum Wortschatz zu erleichtern und die Wörter effektiv zu lernen. Die konkrete Umsetzung wird im Rahmen des Projektes im Detail beschrieben.
Wie wird das Projekt zur Wortschatzarbeit beschrieben?
Kapitel 4 analysiert ein konkretes Projekt zur Wortschatzarbeit und berichtet über die Erfahrungen aus verschiedenen Lernbereichen: Deutsche Literatur des Mittelalters, Begründete Stellungnahme, Balladen und Kurzgeschichten sowie Jahrgangsstufentest. Die Beschreibung fokussiert auf die praktische Anwendung der in Kapitel 3 vorgestellten Lernansätze und deren Auswirkungen auf den Wortschatzerwerb der Schüler.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Wortschatzarbeit, Deutschunterricht, Wortschatzerwerb, mentales Lexikon, Wortschatzerweiterung, Wortschatzvertiefung, Lernansätze, Projektanalyse, Evaluation, kognitive Kompetenz, kommunikative Kompetenz, Semantik, Polysemie.
Was ist das Fazit der Arbeit?
Das Resümee (Kapitel 5) fasst die Ergebnisse des Projekts zusammen und bewertet die Wirksamkeit der angewendeten Lernansätze. Es liefert eine abschließende Einschätzung zur Bedeutung systematischer Wortschatzarbeit im Deutschunterricht und gibt möglicherweise Hinweise auf zukünftige Forschungsfragen oder Verbesserungsvorschläge für den Unterricht.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Deutschlehrer, Deutschdidaktiker, Sprachwissenschaftler und alle, die sich mit dem Thema Wortschatzerwerb und effektivem Deutschunterricht befassen. Die Ergebnisse können dazu beitragen, den Deutschunterricht zu verbessern und den Schülern einen effektiveren Wortschatzerwerb zu ermöglichen.
- Quote paper
- Pavla Hecht (Author), 2013, Wortschatzarbeit im Deutschunterricht der Unterstufe, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/264718