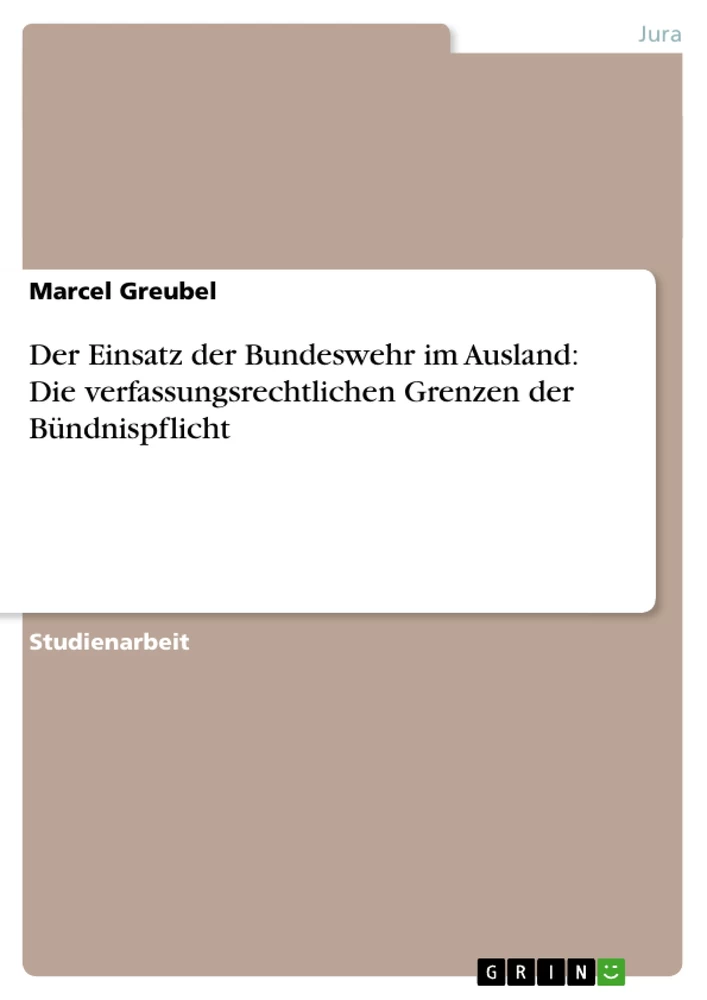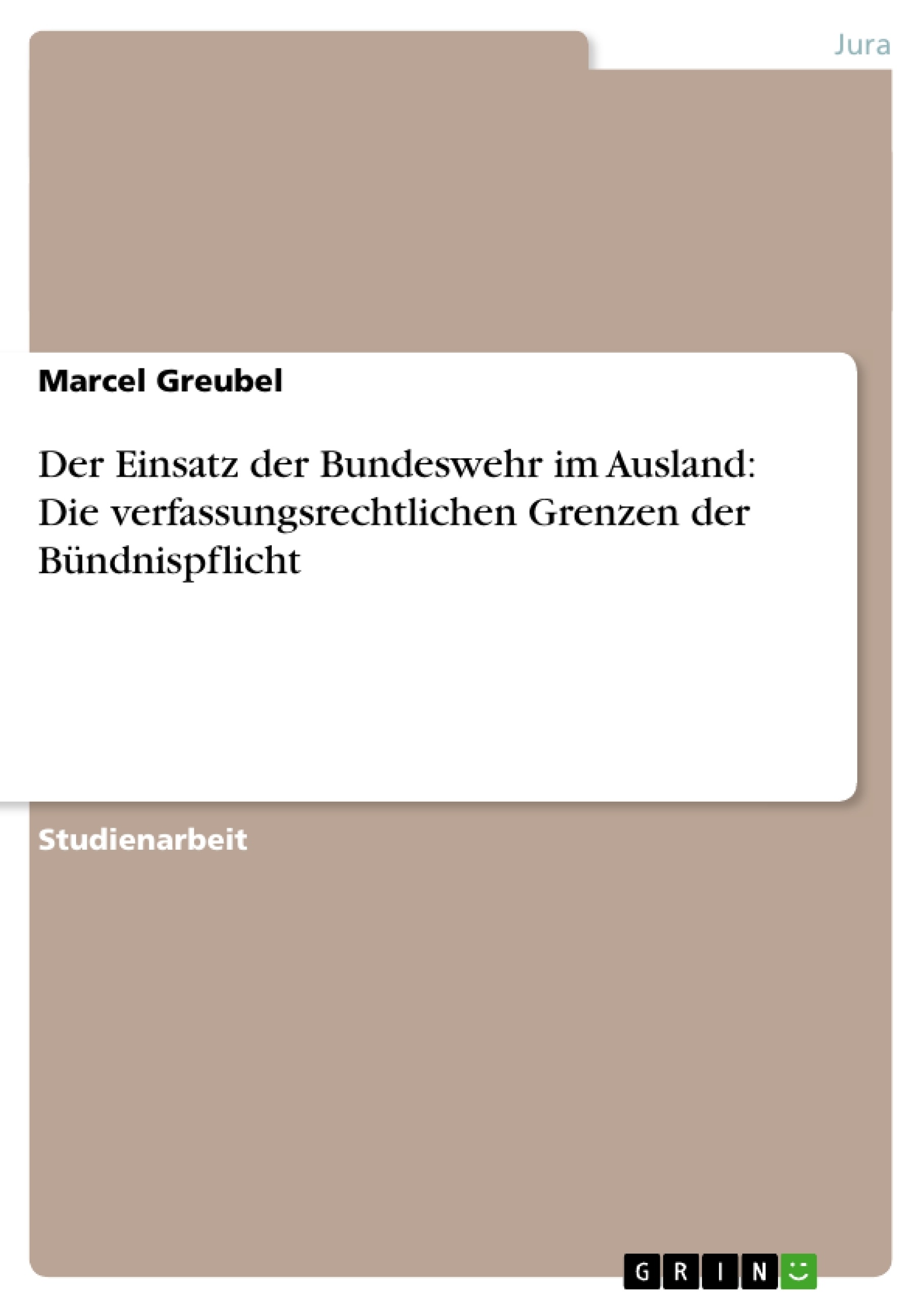I: Geschichtlicher Hintergrund
Nach dem 2. Weltkrieg wurden die deutschen Streitkräfte mit Beschluss vom
20.09.1945 durch die Oberbefehlshaber der Besatzungsstreitkräfte aufgelöst.
1949 wurde das Grundgesetz erlassen. Zumindest ausdrücklich sah es keine
deutschen Streitkräfte vor. Auch nach dem Ende der Besatzung war es zunächst
umstritten, ob Deutschland nun wieder Streitkräfte aufstellen durfte. Erst 1954 wurde
dies per Grundgesetzänderung bejaht. 1956 folgte die Etablierung der Bundeswehr.
Mit Zustimmungsgesetz von 1955 1 ist Deutschland der NATO, mit
Zustimmungsgesetz von 1973 2 der UNO beigetreten.
II: Die Entwicklung bis heute
Im Anbetracht seiner Geschichte hat sich Deutschland lange Zeit militärisch sehr
zurückgehalten. Nicht zuletzt um dem Misstrauen Frankreichs vorzubeugen wurde
die Bundeswehr nach ihrer Etablierung lange nicht aktiv in die internationalen
Bündnisse eingebracht. Deutschland verlegte sich auf politische Präsenz, militärisch
beschränkte es sich jahrzehntelang auf eine passive Rolle, indem es sein Territorium
zur Stationierung westlicher Streitkräfte als Abwehrriegel gegen die
kommunistischen Staaten zur Verfügung stellte.
Seit 1990 änderte sich dies aber nach und nach. So betreuten 1992/93 deutsche
Sanitätssoldaten UN-Truppen in Kambodscha, 1992 bis 1996 waren Marine- und
Luftwaffeneinheiten an der Überwachung des Waffenembargos gegen Jugoslawien
beteiligt, 1993 bis 1995 nahmen deutsche AWACS-Besatzungen an der
Überwachung des Flugverbots über Bosnien teil, 1999 beteiligte sich die deutsche
Luftwaffe am Luftkrieg gegen Jugoslawien, und auch an der KFOR-Truppe im
Kosovo waren deutsche Soldaten beteiligt.3
Auch die internationale Sicherheitslage hat sich in den letzten Jahren drastisch
gewandelt. Während die Bedrohung durch die ehemalige Sowjetunion durch deren
Zerfall und die zunehmende Annährung zwischen den einzelnen resultierenden
Staaten und der westlichen Welt stark an Bedeutung verloren hat, haben andere
Gefahren an Bedeutung zugenommen.
So werden einerseits regionale Konflikte durch die zunehmende Verbreitung von
Massenvernichtungswaffen immer mehr zu einer Gefahr für den Weltfrieden.
Genannt sei beispielhaft der seit Jahrzehnten andauernde Kaschmir-Konflikt
zwischen Indien und Pakistan. [...]
1 BGBl. II 1955, S. 256.
2 BGBl. II 1973, S. 430.
3 Eine Übersicht über sämtliche Einsätze der Bundeswehr seit 1990 findet sich unter:
http://www.einsatz.bundeswehr.de/einsatz_abgeschl/abgeeins.php.
Inhaltsverzeichnis
- A: Einleitung
- I: Geschichtlicher Hintergrund
- II: Die Entwicklung bis heute
- B: Hauptteil
- I: Was ist erlaubt?
- 1. Art. 24 II GG als verfassungsrechtlicher Anknüpfungspunkt
- 2. Auslegung des Art. 24 II GG und Einordnung von UNO und NATO
- 3. Bestimmung der konkreten Einsatzmöglichkeiten im Rahmen von UNO und NATO
- 4. Zusammenfassung der Einsatzmöglichkeiten
- II: Wer hat zu erlauben?
- 1. Notwendigkeit der Feststellung des Verteidigungsfalles gemäß Art. 115a GG
- 2. Notwendigkeit der parlamentarischen Zustimmung
- 3. Ausblick: Das Entsendegesetz nach der FDP-Fraktion
- C: Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der verfassungsrechtlichen Grundlage des Einsatzes der Bundeswehr im Ausland im Rahmen von Bündnissystemen wie der UNO und der NATO. Sie analysiert die Entwicklung der deutschen Streitkräfte nach dem Zweiten Weltkrieg und untersucht, welche Einsätze im Rahmen des Grundgesetzes zulässig sind.
- Die verfassungsrechtliche Grundlage des Einsatzes der Bundeswehr im Ausland
- Die Entwicklung der deutschen Streitkräfte nach dem Zweiten Weltkrieg
- Die Auslegung von Art. 24 II GG und dessen Bedeutung für die Bündnispflicht
- Die konkreten Einsatzmöglichkeiten der Bundeswehr im Rahmen von UNO und NATO
- Die Rolle des Parlaments und der Notwendigkeit der Zustimmung zur Entsendung von Bundeswehrsoldaten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung bietet einen historischen Überblick über die Entwicklung der deutschen Streitkräfte nach dem Zweiten Weltkrieg und beleuchtet die Diskussionen um die Wiederbewaffnung und den Beitritt zu internationalen Bündnissen. Die Kapitel des Hauptteils befassen sich mit den verfassungsrechtlichen Grundlagen des Einsatzes der Bundeswehr im Ausland und analysieren die Möglichkeiten und Grenzen der deutschen Bündnispflicht im Rahmen von UNO und NATO.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die verfassungsrechtliche Auslegung des Grundgesetzes, insbesondere auf Art. 24 II GG, sowie auf die Bedeutung des Einsatzes von Streitkräften im Rahmen von Bündnissystemen wie der UNO und der NATO. Weitere zentrale Begriffe sind die Bündnispflicht, der Verteidigungsfall, die parlamentarische Zustimmung und die Entwicklung der deutschen Streitkräfte seit 1949.
- Quote paper
- Marcel Greubel (Author), 2003, Der Einsatz der Bundeswehr im Ausland: Die verfassungsrechtlichen Grenzen der Bündnispflicht, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/26394