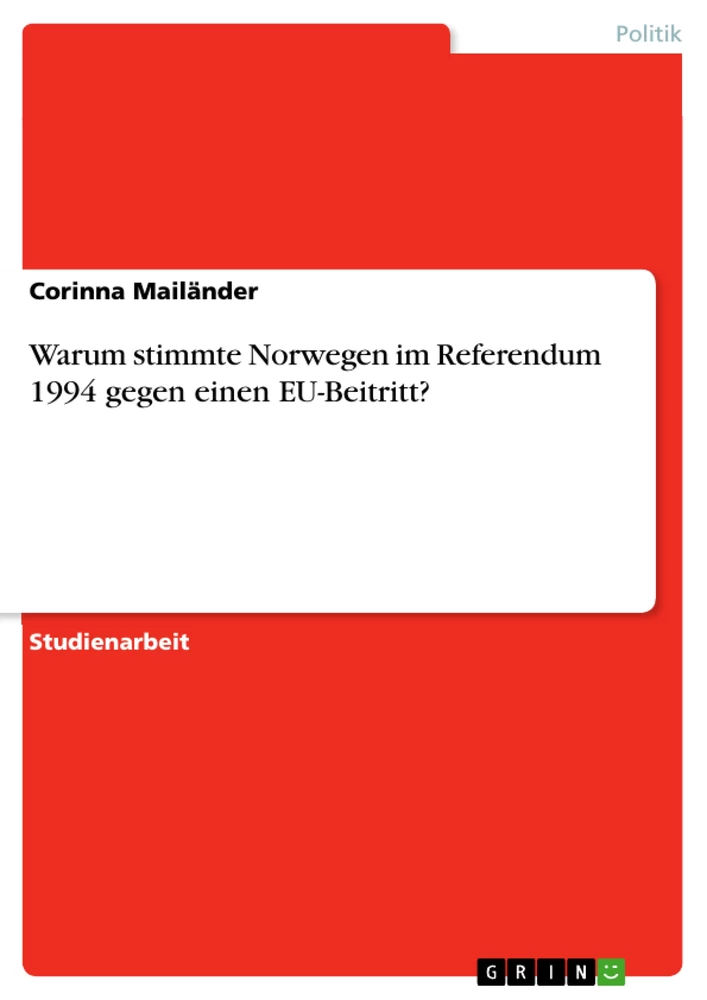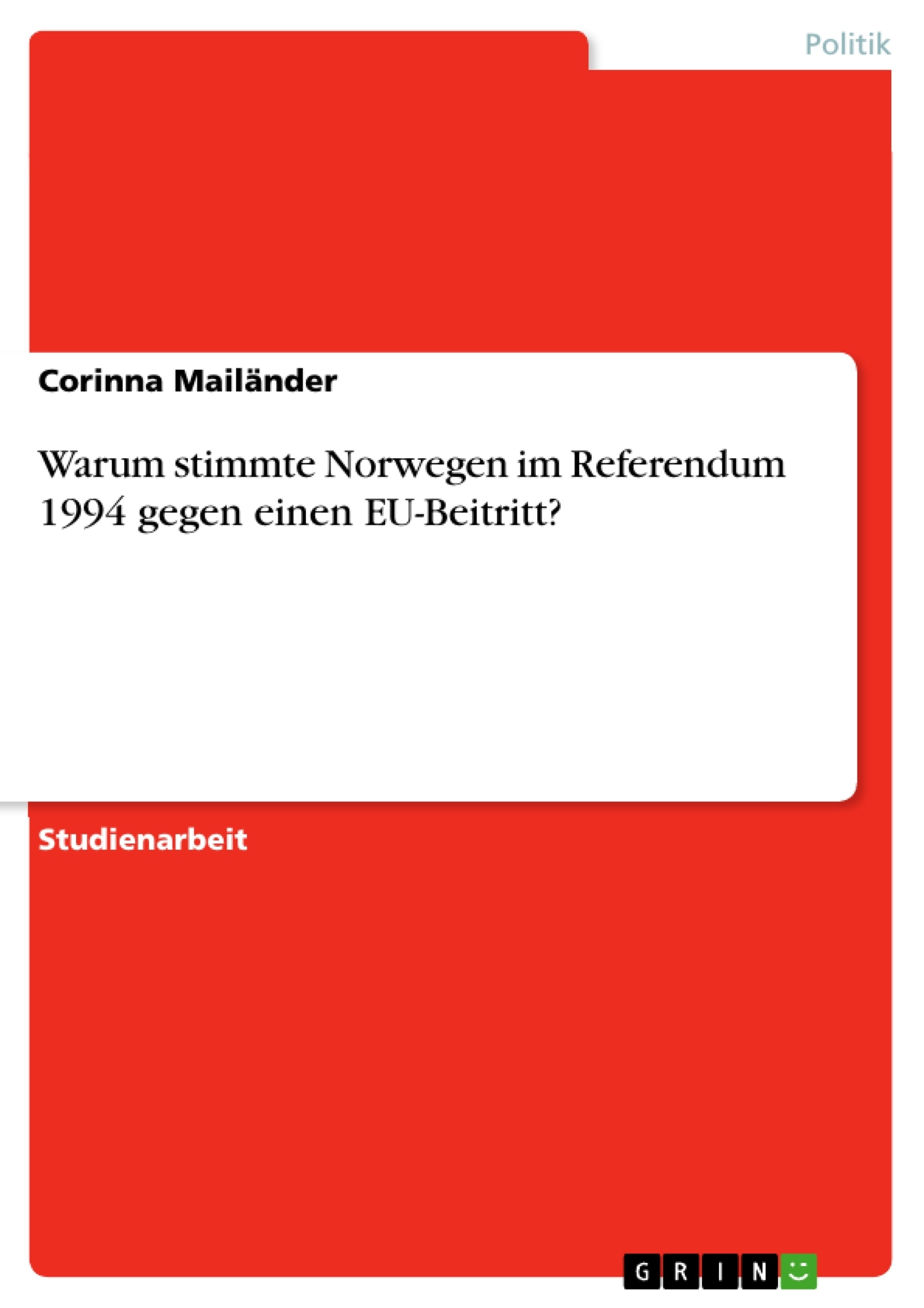Warum hat sich die Bevölkerung von Norwegen 1994 gegen einen Beitritt in die Europäische Union entschieden? Dieser Frage geht die Hausarbeit investigativ nach.
Seit inzwischen schon mehreren Jahrzehnten wird die europäische Integration vorangetrieben. Dies zeigt sich sowohl in Beitritten von immer mehr Ländern als auch in vertiefenden Maßnahmen wie der Einführung des Euro als gemeinsame Währung. Norwegen bildet hier eine Ausnahme, denn entgegen dem starken Willen der meisten Nicht-EU-Länder hat Norwegen als bisher erstes und einziges Land eine Mitgliedschaft abgelehnt.
Wie kommt es, dass ein Land, das so eng mit seinen skandinavischen Nachbarn Dänemark, Schweden und Finnland verbunden ist, sich doch in diesem wichtigen Punkt von ihnen unterscheidet? Warum die Bevölkerung ein zweites Mal gegen eine Mitgliedschaft votierte, war zunächst nicht ganz nachzuvollziehen. Zum einen bestanden bereits mehrere Kooperationsabkommen Norwegens mit der EU. Zum anderen war es nicht unwahrscheinlich, dass sich zusätzliche wirtschaftliche und politische Vorteile aus einem Beitritt ergeben. Darüber hinaus gelten weite Teile der Bevölkerung als grundsätzlich proeuropäisch. Die Gründe können auf nicht nur einer Überlegung fußen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theorie
- 2.1 Gründe und Einfluss der Bevölkerung in peripheren Gebieten
- 2.2 Dominanz der wirtschaftlichen Gründe
- 2.3 Souveränitätsverlust
- 3. Methoden
- 4. Fragen für die durchzuführenden Interviews
- 5. Wirtschaft und Politik
- 5.1 Gegensatz Zentrum – Peripherie
- 5.2 Import und Export
- 5.3 Agrarpolitik
- 5.4 Außen- und Sicherheitspolitik
- 6. Souveränität
- 7. Sonstige Einflussfaktoren
- 8. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Gründe, die zum Nein-Votum Norwegens im Referendum 1994 über einen EU-Beitritt geführt haben. Sie analysiert die politischen und wirtschaftlichen Faktoren sowie die Rolle der Bevölkerung in der Entscheidungsfindung.
- Einfluss der Bevölkerung in peripheren Gebieten, insbesondere von Fischern und Landwirten
- Bedeutung der wirtschaftlichen Interessen und des möglichen Souveränitätsverlusts
- Rolle der politischen und wirtschaftlichen Beziehungen zu den skandinavischen Nachbarn
- Relevanz der Agrarpolitik und der Fischereipolitik
- Analyse des öffentlichen Diskurses und der politischen Debatte zum Thema EU-Beitritt
Zusammenfassung der Kapitel
- **Einleitung:** Die Einleitung führt in das Thema des EU-Beitritts und die spezielle Situation Norwegens ein. Sie beleuchtet die historischen Hintergründe der beiden Referenden in 1972 und 1994 und zeigt die Bedeutung dieser Entscheidungen für das Land auf.
- **Theorie:** Dieses Kapitel präsentiert die theoretischen Rahmenbedingungen für die Analyse des norwegischen Nein-Votums. Es untersucht die Rolle der Bevölkerung in peripheren Gebieten, den Einfluss wirtschaftlicher Interessen sowie die Bedeutung des Souveränitätskonzepts.
- **Wirtschaft und Politik:** Dieses Kapitel befasst sich mit den wirtschaftlichen und politischen Aspekten des EU-Beitritts. Es analysiert den Gegensatz zwischen Zentrum und Peripherie in Norwegen, die Bedeutung von Import und Export sowie die Rolle der Agrar- und Außenpolitik.
- **Souveränität:** Dieses Kapitel befasst sich mit dem Thema der Souveränität und dessen Relevanz für die EU-Mitgliedschaft. Es analysiert die Befürchtungen der norwegischen Bevölkerung in Bezug auf einen möglichen Verlust der Selbstbestimmung.
Schlüsselwörter
Norwegen, EU-Beitritt, Referendum, Peripherie, Wirtschaft, Politik, Souveränität, Fischerei, Landwirtschaft, Agrarpolitik, Außenpolitik, Skandinavien, Dänemark, Schweden, Finnland, Europäische Freihandelszone (EFTA), Eurojust, Europol.
- Quote paper
- Corinna Mailänder (Author), 2008, Warum stimmte Norwegen im Referendum 1994 gegen einen EU-Beitritt?, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/262916