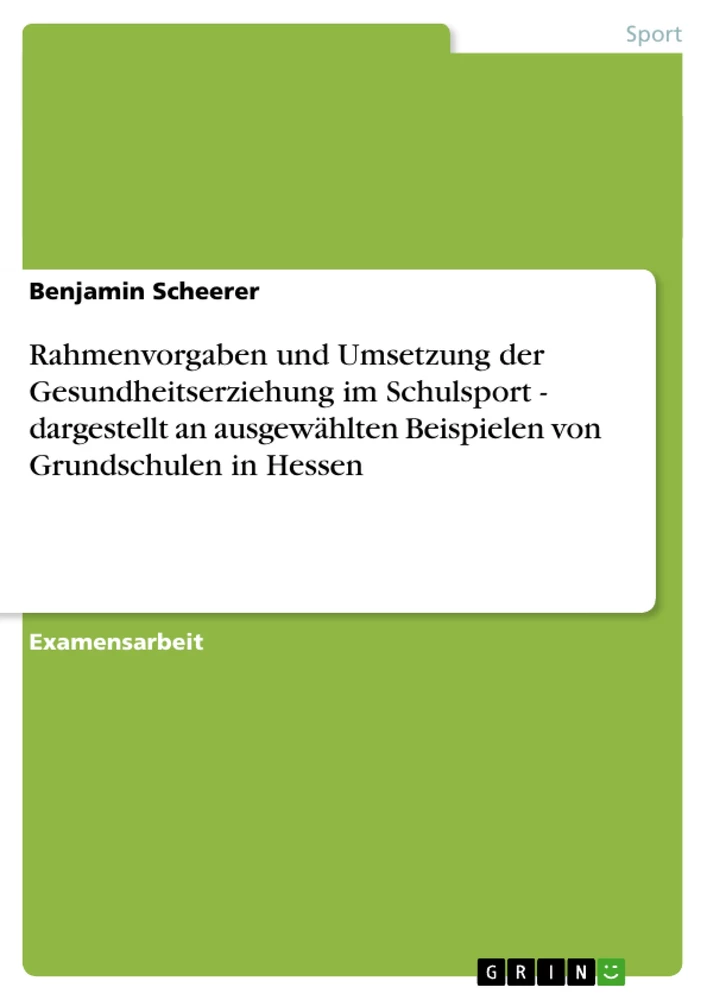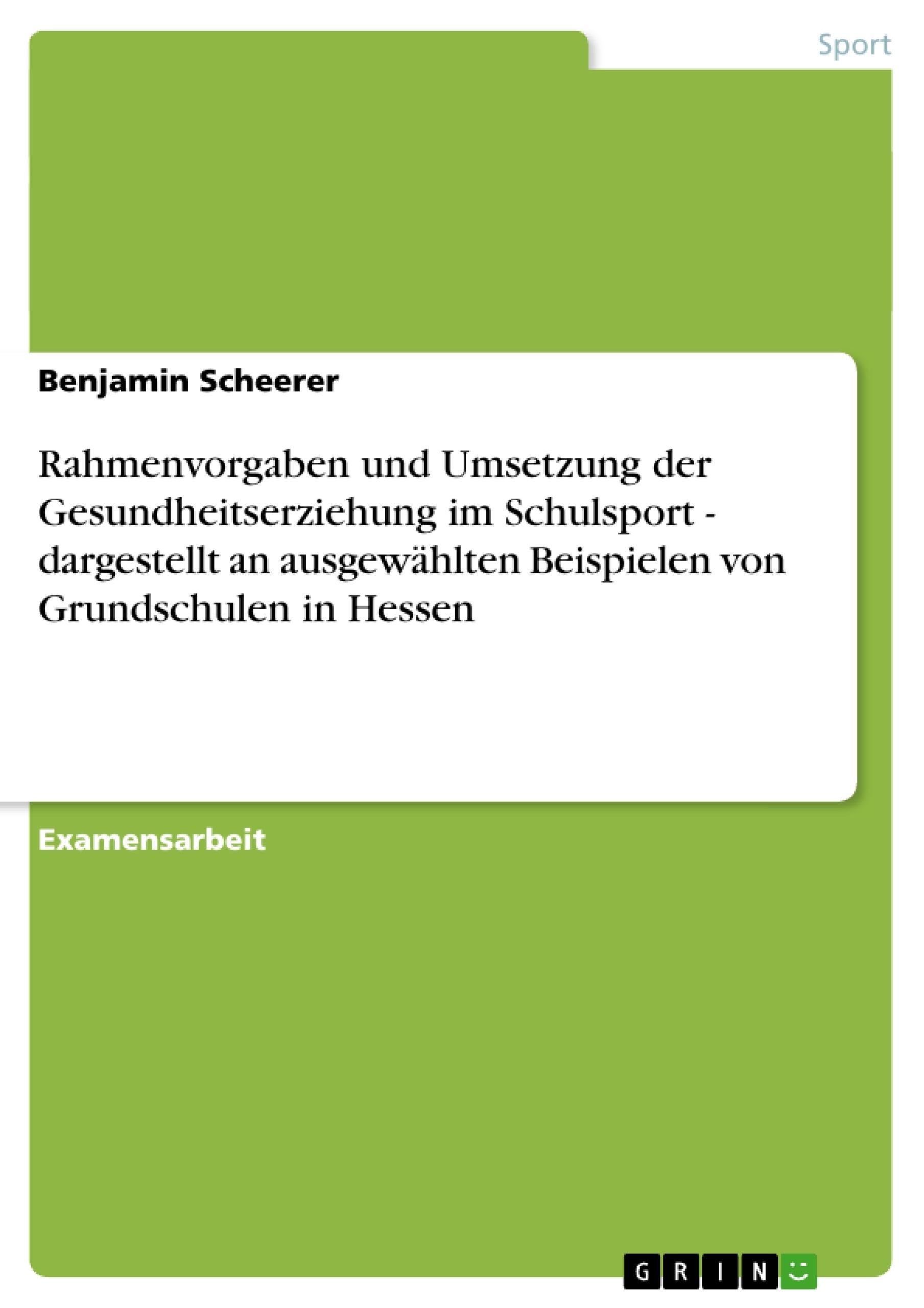Wer sich in der heutigen Zeit ein Bild über den gesundheitlichen Zustand von Kindern und Jugendlichen macht, wird feststellen, dass in Deutschland jedes fünfte Kind und jeder dritte Jugendliche übergewichtig ist: sieben bis acht Prozent sogar stark übergewichtig bzw. adipös. Der Hauptgrund dafür liegt in einem veränderten Ernährungs- und Bewegungsverhalten (Bonk, 2003, o. S.). Trotz des natürlichen Bewegungsdranges unserer Kinder nimmt die kindliche Bewegungsarmut zu – oft in der Folge von fehlenden Bewegungsmöglichkeiten oder von willkürlicher Behinderung von Bewegung: beispielsweise durch zugeparkte Bürgersteige, viel befahrene Straßen, vielfältige Verbote sich auf öffentlichen Flächen auszutoben oder Schließung von Abenteuerspielplätzen aus kommunaler Geldnot. Umso mehr muss das organisierte Sportangebot erhalten und ausgebaut werden. Die Prävention von Wohlstandserkrankungen, auch durch den Breitensport, ist eine politische Aufgabe, aber auch die Aufgabe der Eltern und der Schule. Der Begriff ´Prävention´ wird deswegen verwendet, weil einer gesunden und bewegungsreichen Lebensführung nicht erst im Krankheitsstadium, sondern schon von vorneherein möglichst früh nachgekommen werden sollte.
Diese Tatsache erfordert eine fortwährende Gesundheitserziehung, die bereits von Kindesbeinen an greift, um möglichst frühzeitig die Bedeutung von Bewegung für die Gesundheit und somit für die Lebensqualität zu vermitteln. In dem Zusammenhang einer frühzeitigen Gesundheitserziehung wird auch dem Schulsport die zentrale Rolle zugeschrieben, zum Erhalt der Gesundheit der Schüler beizutragen und diese zu einem lebenslangen Sporttreiben zu animieren. Wie steht es aber nun tatsächlich um die gesundheitserzieherische Aufgabe des Schulsports? Wie ist diese in den Rahmenrichtlinien der einzelnen Bundesländer verankert? Welche gesundheitserzieherischen und -förderlichen Initiativen gibt es in Deutschland, und wie wird Gesundheitsförderung im Bundesland Hessen umgesetzt? Diese Fragen sollen im Rahmen der vorliegenden Arbeit geklärt werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Zum Verständnis
- 2.1 Definition des Begriffs 'Gesundheit'
- 2.2 Die salutogenetische Denkweise
- 2.2.1 Das Salutogenese-Modell
- 2.2.2 Risikofaktoren beziehungsweise 'Stressoren'
- 2.2.3 Generalisierte Widerstandsressourcen
- 2.2.4 Das Kohärenzgefühl
- 2.3 Das Programm der WHO zur Gesundheitsförderung
- 2.4 Gesundheitserziehung und Gesundheitsförderung
- 2.5 Zusammenfassung
- 3. Zur aktuellen Situation der Gesundheitserziehung
- 3.1 Gesundheitserziehung als eine Aufgabe des Schulsports
- 3.2 Ziele der Gesundheitserziehung
- 3.2.1 Ebenen gesundheitsbezogener Kompetenzen im Sport
- 3.2.1.1 Die personale Ebene
- 3.2.1.2 Die soziale Ebene
- 3.2.1.3 Die ökologische Ebene
- 3.2.1 Ebenen gesundheitsbezogener Kompetenzen im Sport
- 3.3 Lehrkräfte und Familie als Vorbilder
- 3.4 Neuere fachdidaktische Positionen
- 3.4.1 Objektivierende Positionen zur Gesundheitserziehung
- 3.4.2 Subjektivierende Positionen zur Gesundheitserziehung
- 3.5 Zum Konzept 'Gesundheitserziehung in der Schule durch Sport'
- 3.6 Zusammenfassung
- 4. Initiativen zur Gesundheitsförderung
- 4.1 Das Europäische Netzwerk Gesundheitsfördernde Schulen
- 4.2 Ziele der 'Gesundheitsfördernden Schule'
- 4.3 Das Netzwerk Gesundheitsfördernde Schulen' in Deutschland (1993-1997)
- 4.4 OPUS (1997-2000)
- 4.5 Gesundheitsfördernde Initiativen der Bundesländer
- 4.5.1 Initiativen des Landes Baden-Württemberg
- 4.5.1.1 'Sport macht Freunde'
- 4.5.1.2 'Sport- und bewegungsfreundlicher Schulhof'
- 4.5.1.3 'Grundschulen mit sport- und bewegungserzieherischem Schwerpunkt'
- 4.5.1.4 'Sport-Horte'
- 4.5.2 Initiativen des Landes Rheinland-Pfalz
- 4.5.2.1 'Netzwerk Schule für Gesundheit 21'
- 4.5.2.2 'Klasse 2000'
- 4.5.3 Initiativen des Landes Niedersachsen
- 4.5.3.1 OPUS-Struktur in Niedersachsen
- 4.5.3.2 'Praxisbüro Gesunde Schule'
- 4.5.3.3 'Bewegte Schule online'-Die Fridtjof-Nansen-Schule
- 4.5.1 Initiativen des Landes Baden-Württemberg
- 4.6 Rahmenpläne für die Grundschule der Bundesländer
- 4.6.1 Gesundheitserzieherische und -förderliche Aufgaben des Schulsports
- 4.6.1.1 Mehrdimensionale Ziele und Aufgaben des Sportunterrichts
- 4.6.1.2 Gesundheit als pädagogische Perspektive des Schulsports im Rahmenplan des Landes Nordrhein-Westfalen
- 4.6.1.3 Gesundheit als Thema in Lernfeldern und Projektbereichen im Rahmenplan des Landes Hamburg
- 4.6.1 Gesundheitserzieherische und -förderliche Aufgaben des Schulsports
- 4.7 Zusammenfassung
- 5. Gesundheitsförderung in Hessen
- 5.1 Initiativen zur Gesundheitsförderung in Hessen
- 5.1.1 Hessisches Netzwerk 'Schule und Gesundheit'
- 5.1.2 Ziele und Aufgaben von 'Schule und Gesundheit'
- 5.1.3 Hessische Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitserziehung (HAGE)
- 5.1.3.1 Ziele und Aufgaben
- 5.1.3.2 Ausbildungsmöglichkeiten im Bereich der Gesundheitserziehung
- 5.1.3.3 Konkrete Unterrichtshilfen zur Gesundheitserziehung und -förderung
- 5.2 Gesundheitserziehung und -förderung in den hessischen Rahmenrichtlinien für die Grundschule
- 5.2.1 Gesundheitserziehung als fächerübergreifende Aufgabe der Schule
- 5.2.2 Gesundheitserziehung als Aufgabenbereich des Faches Sport
- 5.3 Konkrete Umsetzung von Gesundheitserziehung an Grundschulen in Hessen
- 5.3.1 Die Schillerschule in Dreieich
- 5.3.1.1 Das Projekt und seine Hintergründe
- 5.3.1.2 Ziele des Projekts
- 5.3.1.3 Die Umsetzung des Projekts
- 5.3.1.4 Kooperationspartner
- 5.3.2 Die Friedrich-Ebert-Schule in Bad Homburg
- 5.3.2.1 Entstehung und Ziele des Projekts 'Die tägliche Sportstunde'
- 5.3.2.2 Zur Organisation
- 5.3.2.3 Die Durchführung des Sportunterrichts
- 5.3.2.4 Die Ergebnisse des Projekts
- 5.3.2.5 Erreichte gesundheitserzieherische und -förderliche Ziele
- 5.3.1 Die Schillerschule in Dreieich
- 5.4 Zusammenfassung
- 5.1 Initiativen zur Gesundheitsförderung in Hessen
- 6. Lehrerinnen-Interview: Zur Situation der Gesundheitserziehung im Schulsport in der Grundschule
- 6.1 Ziele der Befragung
- 6.2 Vorstellung der Interviewstruktur
- 6.3 Darstellung des Interview-Leitfadens
- 6.4 Vorstellung der befragten Schulen und Personen
- 6.4.1 Die Astrid-Lindgren-Schule
- 6.4.2 Die Auefeldschule
- 6.4.3 Die Grundschule Frommershausen
- 6.5 Darstellung der Ergebnisse
- 6.6 Auswertung der Ergebnisse
- 6.7 Zusammenfassende Interpretation der Befragungsergebnisse
- 7. Resümee und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Rolle der Gesundheitserziehung im Schulsport, insbesondere in der Grundschule. Sie analysiert die aktuelle Situation, bewertet verschiedene Initiativen zur Gesundheitsförderung und beleuchtet die Umsetzung in Hessen anhand konkreter Beispiele. Die Studie zielt darauf ab, die Bedeutung von Gesundheitserziehung im Schulsport hervorzuheben und Verbesserungsvorschläge zu formulieren.
- Gesundheitserziehung im Schulsport
- Initiativen zur Gesundheitsförderung in Deutschland
- Umsetzung von Gesundheitsförderung in Hessen
- Analyse von Rahmenrichtlinien und Lehrplänen
- Praxisbeispiele aus hessischen Grundschulen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beleuchtet die steigende Zahl übergewichtiger Kinder und Jugendlicher in Deutschland und begründet die Notwendigkeit einer frühzeitigen und umfassenden Gesundheitserziehung. Sie hebt die zentrale Rolle des Schulsportes bei der Gesundheitsförderung hervor und betont die Wichtigkeit eines fächerübergreifenden Ansatzes sowie die Bedeutung des Austausches zwischen Schulen und Institutionen.
2. Zum Verständnis: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen der Arbeit dar. Es definiert den Begriff "Gesundheit", beschreibt die salutogenetische Denkweise und das Salutogenese-Modell, erläutert Risikofaktoren und Ressourcen sowie das Kohärenzgefühl. Weiterhin werden das WHO-Programm zur Gesundheitsförderung und die Bedeutung von Gesundheitserziehung und -förderung im Detail behandelt. Der Abschnitt bietet ein fundiertes Verständnis der theoretischen Konzepte, die im weiteren Verlauf der Arbeit Anwendung finden.
3. Zur aktuellen Situation der Gesundheitserziehung: Dieses Kapitel analysiert die aktuelle Situation der Gesundheitserziehung im Schulsport. Es untersucht die Ziele der Gesundheitserziehung auf verschiedenen Ebenen (personal, sozial, ökologisch) und beleuchtet die Rolle von Lehrkräften und Familien als Vorbilder. Es werden unterschiedliche fachdidaktische Positionen (objektivierend und subjektivierend) gegenübergestellt und das Konzept "Gesundheitserziehung in der Schule durch Sport" ausführlich diskutiert. Der Fokus liegt auf der kritischen Auseinandersetzung mit dem Status Quo der Gesundheitserziehung im deutschen Schulsystem.
4. Initiativen zur Gesundheitsförderung: Dieses Kapitel stellt verschiedene Initiativen zur Gesundheitsförderung auf nationaler und Landesebene vor. Es beschreibt das Europäische Netzwerk Gesundheitsfördernde Schulen, analysiert Initiativen in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Niedersachsen und untersucht die Einbindung gesundheitserzieherischer Aspekte in die Rahmenpläne der Grundschulen verschiedener Bundesländer. Der Überblick zeigt die Vielfalt und den Umfang der bestehenden Programme, um die Gesundheitsförderung an Schulen zu verbessern.
5. Gesundheitsförderung in Hessen: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Umsetzung von Gesundheitsförderung im Bundesland Hessen. Es präsentiert das hessische Netzwerk "Schule und Gesundheit", die Hessische Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitserziehung (HAGE) und deren Aktivitäten. Es beschreibt detailliert die Integration von Gesundheitserziehung in die hessischen Rahmenrichtlinien für die Grundschule und analysiert zwei konkrete Praxisbeispiele aus hessischen Grundschulen, um die praktische Umsetzung der Gesundheitsförderung zu verdeutlichen. Die Kapitel analysiert die Besonderheiten und Herausforderungen der Gesundheitsförderung im hessischen Kontext.
Schlüsselwörter
Gesundheitserziehung, Schulsport, Gesundheitsförderung, Salutogenese, Kohärenzgefühl, WHO, Rahmenrichtlinien, Initiativen, Hessen, Grundschule, Prävention, Bewegung, Lebensqualität.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Gesundheitserziehung im Schulsport der Grundschule in Hessen
Was ist der Hauptfokus dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Rolle der Gesundheitserziehung im Schulsport der Grundschule, insbesondere in Hessen. Sie analysiert die aktuelle Situation, bewertet Initiativen zur Gesundheitsförderung und zeigt konkrete Umsetzungen anhand von Beispielen aus hessischen Grundschulen.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit behandelt die theoretischen Grundlagen der Gesundheitserziehung (Salutogenese, Kohärenzgefühl, WHO-Programm), die aktuelle Situation der Gesundheitserziehung im Schulsport, verschiedene Initiativen zur Gesundheitsförderung (national und auf Landesebene, besonders in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Niedersachsen), die Umsetzung von Gesundheitsförderung in Hessen (inkl. des hessischen Netzwerks "Schule und Gesundheit" und der HAGE), sowie konkrete Praxisbeispiele aus hessischen Grundschulen (z.B. Schillerschule Dreieich, Friedrich-Ebert-Schule Bad Homburg). Die Einbindung gesundheitserzieherischer Aspekte in Rahmenrichtlinien verschiedener Bundesländer wird ebenfalls untersucht. Ein Lehrerinnen-Interview liefert zusätzliche Einblicke in die Praxis.
Welche theoretischen Konzepte werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf das Salutogenese-Modell, den Begriff des Kohärenzgefühls und das WHO-Programm zur Gesundheitsförderung. Es werden verschiedene fachdidaktische Positionen (objektivierend und subjektivierend) zur Gesundheitserziehung diskutiert.
Welche Initiativen zur Gesundheitsförderung werden vorgestellt?
Die Arbeit präsentiert das Europäische Netzwerk Gesundheitsfördernde Schulen und analysiert Initiativen in verschiedenen Bundesländern, darunter Baden-Württemberg (z.B. "Sport macht Freunde", "Sport- und bewegungsfreundlicher Schulhof"), Rheinland-Pfalz (z.B. "Netzwerk Schule für Gesundheit 21", "Klasse 2000") und Niedersachsen (z.B. OPUS-Struktur, "Praxisbüro Gesunde Schule", "Bewegte Schule online"). Der Fokus liegt auf den Initiativen in Hessen, insbesondere dem hessischen Netzwerk "Schule und Gesundheit" und der HAGE (Hessische Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitserziehung).
Welche Praxisbeispiele aus hessischen Grundschulen werden analysiert?
Die Arbeit analysiert zwei konkrete Praxisbeispiele: Die Schillerschule in Dreieich mit einem detaillierten Projekt und die Friedrich-Ebert-Schule in Bad Homburg mit dem Projekt "Die tägliche Sportstunde". Die Analyse umfasst die Hintergründe, Ziele, Umsetzung, Kooperationspartner und erzielten Ergebnisse der Projekte.
Wie werden die Ergebnisse der Arbeit gewonnen?
Neben der Literaturrecherche und Analyse bestehender Programme umfasst die Arbeit ein Lehrerinnen-Interview, um Einblicke in die praktische Umsetzung der Gesundheitserziehung im Schulsport zu erhalten. Die Ergebnisse der Interviews werden detailliert dargestellt und ausgewertet.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Gesundheitserziehung, Schulsport, Gesundheitsförderung, Salutogenese, Kohärenzgefühl, WHO, Rahmenrichtlinien, Initiativen, Hessen, Grundschule, Prävention, Bewegung, Lebensqualität.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit zieht Schlussfolgerungen zur Bedeutung der Gesundheitserziehung im Schulsport und formuliert Verbesserungsvorschläge. Die genauen Schlussfolgerungen und Vorschläge sind im Resümee und Ausblick des Dokuments dargestellt.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Lehrkräfte, Schulverwaltung, Entscheidungsträger im Bildungsbereich, Wissenschaftler, die sich mit Gesundheitserziehung und Schulsport befassen, sowie alle, die sich für Gesundheitsförderung an Schulen interessieren.
Wo finde ich die detaillierten Kapitelübersichten?
Die Zusammenfassung der Kapitel findet sich im HTML-Dokument selbst. Diese Zusammenfassung bietet eine detaillierte Übersicht über den Inhalt jedes Kapitels.
- Quote paper
- Benjamin Scheerer (Author), 2003, Rahmenvorgaben und Umsetzung der Gesundheitserziehung im Schulsport - dargestellt an ausgewählten Beispielen von Grundschulen in Hessen, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/26231