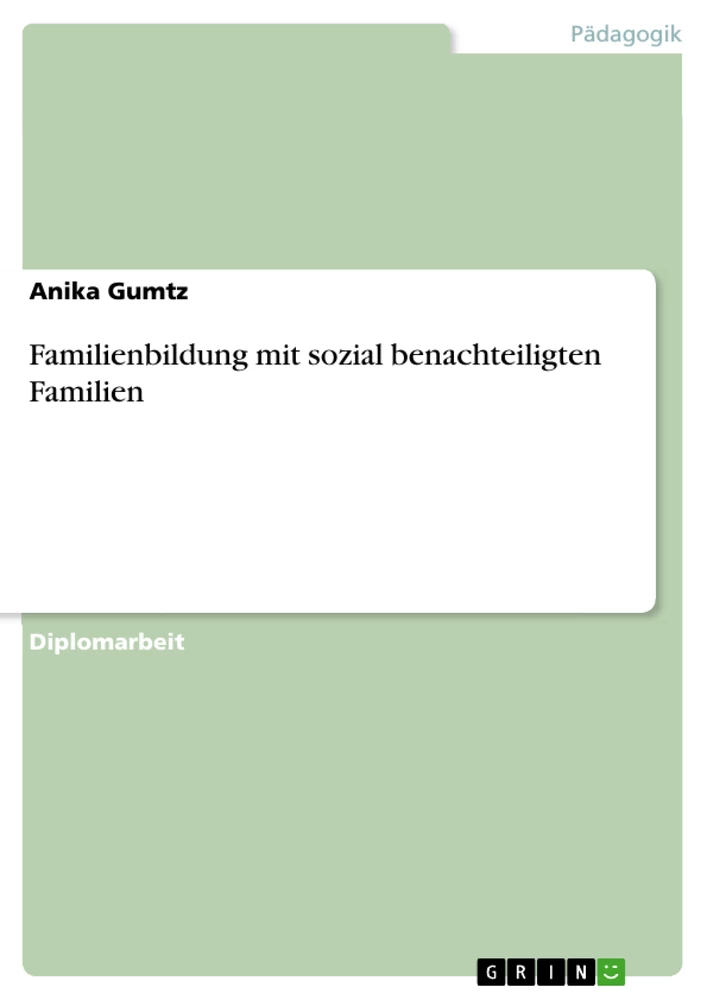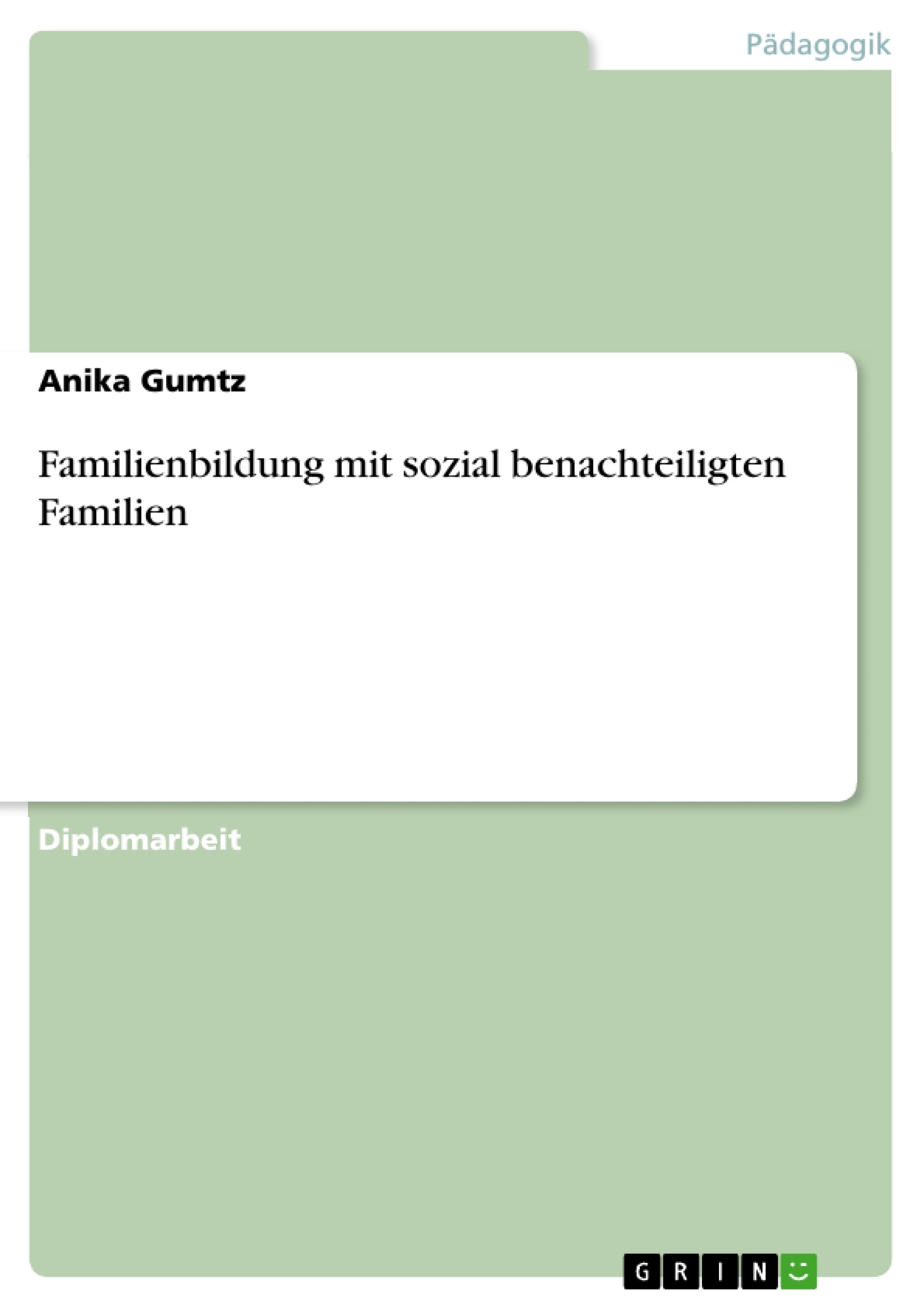Familienbildung stellt einen politisch und öffentlich breit diskutierten Themenbereich
dar. Dabei ist der Gedanke, Eltern in Erziehungsfragen anhand von Bildung zu
unterstützen, keine Erfindung der Neuzeit. Bereits vor mehreren hundert Jahren
gaben Autoren in ihren Schriften interessierten und „unfähigen“ Eltern Anregungen
rund um die Erziehung und Versorgung ihrer Kinder (vgl. Konrad, F.-M. 2004, S.
10ff). Gegenwärtig erhält Familienbildung im Zusammenhang mit Benachteiligung
unter den Bezeichnungen „Infantilisierung“ „Soziale Vererbung“ und „Familialisierung“
Einzug in die Öffentlichkeit. Auslöser hierfür stellen im Wesentlichen zwei
bedeutsame gesellschaftliche Entwicklungen dar: Zum Einen die Vererbung von
Bildungsbiografien, zum Anderen das konstant ansteigende Armutsrisiko
insbesondere von Kindern und Jugendlichen. Beide Aspekte weisen auf Ungleichheit
und soziale Benachteiligung hin. Die Forderung, „vermehrt benachteiligte und
bildungsferne Elterngruppen zu erreichen“, nimmt auf dem Hintergrund dieser
gesellschaftlichen Entwicklung in der aktuellen Diskussion um Familienbildung einen
zentralen Stellenwert ein (Mengel, M. 2007, S. 51).
Doch welche Personengruppen und Haushalte gelten in der aktuellen Gesellschaft
als benachteiligt und weshalb? Wie beeinflusst Deprivation das Leben von
Betroffenen? Welche unterschiedlichen Dimensionen von Benachteiligung gibt es
und wie hängen diese miteinander zusammen? Gibt es staatliche Bemühungen im
Sinne von Familienbildung, die Auswirkungen von Deprivation auf die einzelnen
Lebensbereiche der Betroffenen möglichst gering zu halten? Kommen diese
Bemühungen bei den Betroffenen an und werden sie von ihnen entsprechend
wahrgenommen?
Diesen Fragen möchte ich in der vorliegenden Arbeit nachgehen.
Hierfür werde ich mich zunächst dem Phänomen der Benachteiligung widmen.
Neben einer Definition und einer Beschreibung der Risikogruppen, sollen die unterschiedlichen Dimensionen auf denen Benachteiligung stattfinden kann sowie
deren Auswirkungen auf das Leben von Familien erläutert werden.
Im zweiten Kapitel werde ich mich ausführlich mit Familienbildung beschäftigen. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Benachteiligung
- 2.1 Der Versuch einer Definition von Benachteiligung
- 2.2 Benachteiligte Personengruppen in Deutschland
- 2.3 Die verschiedenen Dimensionen von Benachteiligung
- 2.3.1 Materielle Dimension und Benachteiligung
- 2.3.2 Kulturelle Dimension und Bildung
- 2.3.3 Physische und psychische Dimension
- 2.3.4 Familiale Dimension
- 2.3.5 Regionale Dimension
- 2.3.6 Soziale Integration
- 2.3.7 Zusammenfassung
- 3 Familienbildung: Allgemeine Darstellung unter besonderer Berücksichtigung benachteiligter Familien
- 3.1 Historische Entwicklung und gesellschaftliche Bezüge der Familienbildung
- 3.1.1 Die Anfänge von Familienbildung
- 3.1.2 Von der Mütterschule zur Familienbildungsstätte
- 3.1.3 Familienbildung in der DDR
- 3.1.4 Familienbildung in der BRD
- 3.1.5 Familienbildung zur Zeit der Wiedervereinigung
- 3.2 Familienbildung im 21. Jahrhundert
- 3.2.1 Das aktuelle Erscheinungsbild von Familie
- 3.2.1.1 Veränderungen in der äußeren Familienform
- 3.2.1.2 Veränderungen im Lebensverlauf von Familien
- 3.2.1.3 Veränderungen in der Arbeitsteilung und den sozialen Rollen von Familien
- 3.2.1.4 Zusammenfassende Bewertung
- 3.2.2 Die aktuelle Aufgabe von Familienbildung und ihre strukturellen Besonderheiten
- 3.2.2.1 Die rechtliche Beauftragung der Familienbildung
- 3.2.2.2 Ansatzpunkte und Aufgaben von Familienbildung
- 3.2.2.3 Familienbildung: fürsorgliche Aufgabe oder bildende Funktion?
- 3.2.2.4 Familienbildung zwischen Jugendhilfe und Erwachsenenbildung
- 3.2.2.5 Zusammenfassung
- 3.2.1 Das aktuelle Erscheinungsbild von Familie
- 3.3 Institutionelle Realität
- 3.3.1 Trägerlandschaft und Formen
- 3.3.2 Angebote und Themen der Familienbildung
- 3.3.3 Nutzung von Angeboten der Familienbildung
- 3.3.3.1 Nutzung von Angeboten der Familienbildung nach Angaben der Institutionen
- 3.3.3.2 Nutzung von Angeboten der Familienbildung nach Angaben der Familien
- 3.3.4 Familienbildung aus Sicht von Eltern
- 3.3.4.1 Ansprechpartner bei Fragen zur Erziehung
- 3.3.4.2 Gewünschte und bevorzugte Angebote und Themen
- 3.3.4.3 Die gewünschte Art der Vermittlung von Information
- 3.3.4.4 Gewünschte Form und Wege der Vermittlung von Informationen
- 3.4 Zusammenfassende Bewertung
- 3.1 Historische Entwicklung und gesellschaftliche Bezüge der Familienbildung
- 4 Lern- und Bildungskonzepte für eine Familienbildung mit Familien in benachteiligten Lebenslagen
- 4.1 Bedeutsame Aspekte für eine Familienbildung mit benachteiligten Familien
- 4.1.1 Aufgaben des Staates, des Landes oder der Kommune
- 4.1.2 Aufgaben der Institutionen/Anbieter der Familienbildung
- 4.1.3 Aufgaben der Dozenten, Familienbildner oder Kursführer
- 4.2 Das FuN-Programm
- 4.2.1 Das FuN-Konzept
- 4.2.2 Neue Wege zur Erreichung benachteiligter und bildungsferner Familien
- 4.2.3 Die FuN-Ziele
- 4.2.4 Das FuN-Programm in seinem Ablauf
- 4.2.5 FuN-Wirkung und Evaluation
- 4.1 Bedeutsame Aspekte für eine Familienbildung mit benachteiligten Familien
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen Familienbildung und sozialer Benachteiligung. Ziel ist es, die verschiedenen Dimensionen von Benachteiligung zu beleuchten und den Bedarf an spezifischen Familienbildungsangeboten für betroffene Familien zu analysieren. Dabei wird die historische Entwicklung der Familienbildung ebenso betrachtet wie aktuelle Herausforderungen und Lösungsansätze.
- Definition und Dimensionen sozialer Benachteiligung
- Historische Entwicklung und aktuelle Herausforderungen der Familienbildung
- Bedarfsanalyse an Familienbildung für benachteiligte Familien
- Konzepte und Programme zur erfolgreichen Familienbildung mit benachteiligten Familien
- Analyse der institutionellen Rahmenbedingungen
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Familienbildung im Kontext sozialer Benachteiligung ein und skizziert die Forschungsfragen der Arbeit. Sie hebt die gesellschaftliche Relevanz des Themas hervor, insbesondere im Hinblick auf die Vererbung von Bildungsbiografien und das steigende Armutsrisiko von Kindern. Die Autorin kündigt ihre Vorgehensweise an, die sich auf die Analyse von Benachteiligung und die darauf ausgerichtete Familienbildung konzentriert.
2 Benachteiligung: Dieses Kapitel liefert eine Definition von Benachteiligung und beschreibt verschiedene Personengruppen und Haushalte, die als benachteiligt gelten. Es analysiert die multidimensionalen Aspekte von Benachteiligung, indem es materielle, kulturelle, physische, psychische, familiale, regionale und soziale Dimensionen detailliert untersucht und deren Zusammenhänge aufzeigt. Das Kapitel legt damit die Grundlage für das Verständnis der Herausforderungen, denen benachteiligte Familien gegenüberstehen.
3 Familienbildung: Allgemeine Darstellung unter besonderer Berücksichtigung benachteiligter Familien: Dieses Kapitel beschreibt die historische Entwicklung der Familienbildung von den Anfängen bis ins 21. Jahrhundert, inklusive der Entwicklung in der DDR und BRD. Es analysiert die Veränderungen im Familienbild und die daraus resultierenden Aufgaben der Familienbildung. Es beleuchtet die rechtlichen Rahmenbedingungen, Ansatzpunkte und verschiedene Aufgaben der Familienbildung, untersucht die institutionelle Realität (Trägerlandschaft, Angebote) und geht auf die Nutzung der Angebote aus Sicht der Institutionen und Familien ein. Abschließend wird die Familienbildung aus Elternsicht beleuchtet.
4 Lern- und Bildungskonzepte für eine Familienbildung mit Familien in benachteiligten Lebenslagen: Dieses Kapitel konzentriert sich auf Lern- und Bildungskonzepte, die speziell für die Bedürfnisse benachteiligter Familien entwickelt wurden. Es beschreibt die Aufgaben von Staat, Institutionen und Dozenten/Familienbildnern und stellt ein konkretes Programm (FuN-Programm) mit seinen Zielen, seinem Ablauf und seiner Evaluation vor. Der Fokus liegt darauf, wie benachteiligte und bildungsferne Familien erreicht und unterstützt werden können.
Schlüsselwörter
Familienbildung, soziale Benachteiligung, Deprivation, Bildungsgerechtigkeit, Armut, Risikofaktoren, Familienstrukturen, Bildungskonzepte, FuN-Programm, institutionelle Rahmenbedingungen, Elternbildung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Familienbildung und Soziale Benachteiligung
Was ist der Gegenstand der vorliegenden Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen Familienbildung und sozialer Benachteiligung. Sie analysiert die verschiedenen Dimensionen von Benachteiligung und den Bedarf an spezifischen Familienbildungsangeboten für betroffene Familien. Dabei werden die historische Entwicklung der Familienbildung, aktuelle Herausforderungen und Lösungsansätze betrachtet.
Welche Dimensionen sozialer Benachteiligung werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die multidimensionalen Aspekte von Benachteiligung, darunter die materielle, kulturelle, physische, psychische, familiale, regionale und soziale Dimension. Es wird der Zusammenhang zwischen diesen Dimensionen und deren Auswirkungen auf Familien analysiert.
Wie wird Benachteiligung in der Arbeit definiert?
Die Arbeit liefert eine explizite Definition von Benachteiligung und beschreibt verschiedene Personengruppen und Haushalte, die als benachteiligt gelten. Diese Definition bildet die Grundlage für die weitere Analyse.
Welche historische Entwicklung der Familienbildung wird dargestellt?
Die Arbeit beschreibt die historische Entwicklung der Familienbildung von den Anfängen bis ins 21. Jahrhundert, einschließlich der Entwicklung in der DDR und BRD. Es werden wichtige Meilensteine und Veränderungen im Laufe der Zeit aufgezeigt.
Welche aktuellen Herausforderungen der Familienbildung werden angesprochen?
Die Arbeit analysiert die Veränderungen im Familienbild und die daraus resultierenden Aufgaben der Familienbildung im 21. Jahrhundert. Sie beleuchtet die rechtlichen Rahmenbedingungen und die verschiedenen Aufgaben der Familienbildung, untersucht die institutionelle Realität (Trägerlandschaft, Angebote) und die Nutzung der Angebote aus Sicht der Institutionen und Familien. Die Sichtweise der Eltern spielt dabei eine wichtige Rolle.
Welche institutionellen Rahmenbedingungen werden betrachtet?
Die Arbeit untersucht die institutionelle Realität der Familienbildung, einschließlich der Trägerlandschaft, der angebotenen Themen und die Nutzung der Angebote durch Familien. Es wird analysiert, wie die Angebote von Institutionen und Familien wahrgenommen werden.
Welche konkreten Programme oder Konzepte zur Familienbildung mit benachteiligten Familien werden vorgestellt?
Die Arbeit stellt das FuN-Programm als konkretes Beispiel für ein Programm zur Familienbildung mit benachteiligten Familien vor. Es werden dessen Ziele, Ablauf und Evaluation detailliert beschrieben.
Welche Aufgaben haben Staat, Institutionen und Dozenten/Familienbildner in der Familienbildung mit benachteiligten Familien?
Die Arbeit beschreibt die Aufgaben des Staates, der Institutionen und der Dozenten/Familienbildner bei der Arbeit mit benachteiligten Familien. Es wird aufgezeigt, welche Rolle jeder Akteur spielt und wie sie gemeinsam zum Erfolg beitragen können.
Wie können benachteiligte und bildungsferne Familien erreicht werden?
Die Arbeit beleuchtet Strategien und Ansätze, um benachteiligte und bildungsferne Familien zu erreichen und effektiv zu unterstützen. Das FuN-Programm dient als Beispiel für erfolgreiche Maßnahmen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Familienbildung, soziale Benachteiligung, Deprivation, Bildungsgerechtigkeit, Armut, Risikofaktoren, Familienstrukturen, Bildungskonzepte, FuN-Programm, institutionelle Rahmenbedingungen, Elternbildung.
- Quote paper
- Anika Gumtz (Author), 2011, Familienbildung mit sozial benachteiligten Familien, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/262187