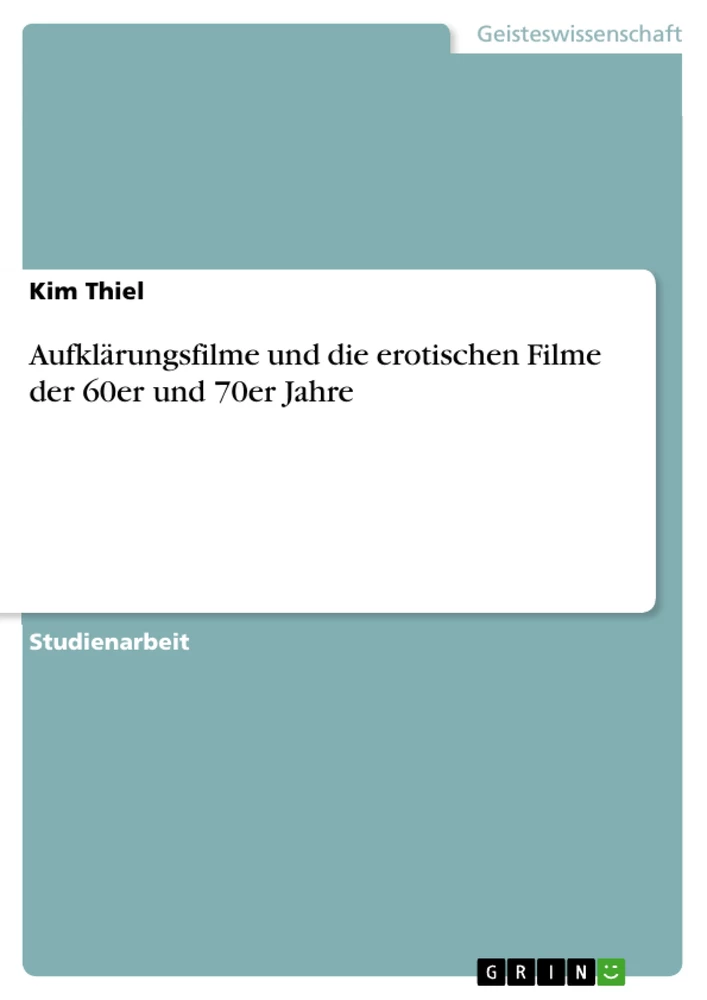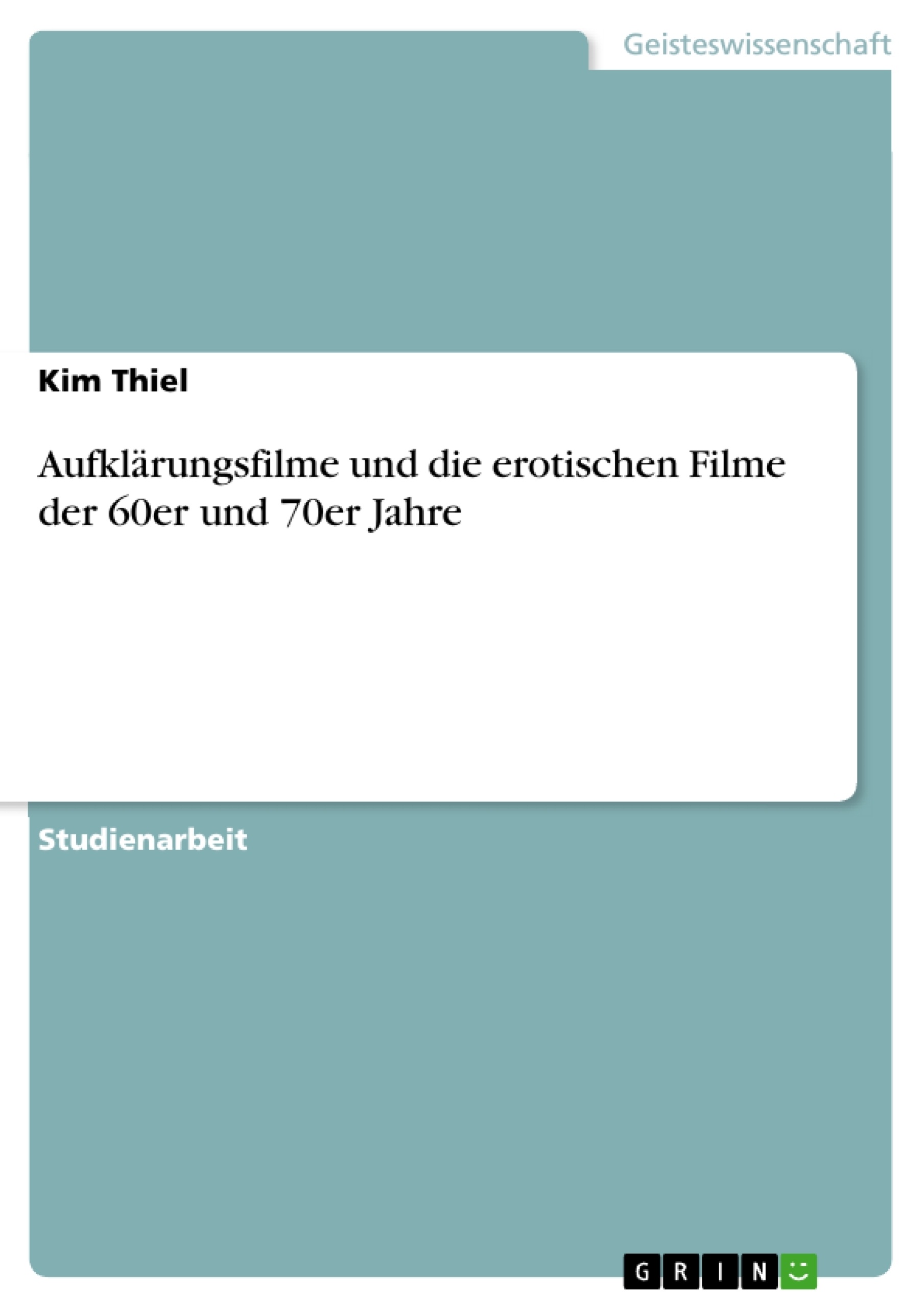Mit diesen Worten beginnt Georg Seeßlen seinen Beitrag zum Thema ’Sex’ in dem von ihm Mitte der Siebziger herausgegebenen ’Unterhaltungs-Lexikon’. Dass es einen solchen Artikel in einem Buch über Unterhaltungs-Kultur überhaupt gibt erscheint uns heute wenig verwunderlich. Die jüngere Generation ist mit den Aufklärungsserien und den Fragen an das ’Dr. Sommer- Team’ der BRAVO aufgewachsen, jeden Nachmittag kann man in den diversen Talkshows die sexuellen Vorlieben der dortigen Teilnehmer erfahren und dann, später am Abend werden die meisten genervt die Werbung einer der unzähligen ’0190er Nummern’ wegschalten.
Erotik ist aus unserem Fernsehalltag und dem Kino kaum mehr wegzudenken. Doch wie kam es, dass eine Sache, welche bei den meisten Bundesbürgern immer noch hinter verschlossenen Türen in abgedunkelten Schlafzimmern stattfindet, in der Öffentlichkeit heute so präsent ist? Auf der Suche nach den Ursprüngen stößt man schnell auf das Genre ’Aufklärungsfilm’ und kann feststellen, dass schon seit Beginn der Filmkunst die Sexualität auf der Leinwand eine äußerst wichtige Rolle spielte. Thema dieser Arbeit ist nun, wie sich der Aufklärungsfilm im Laufe des Jahrhunderts entwickelt hat, wie er in die jeweilige politische und gesellschaftliche Situation eingefügt wurde und welchen möglichen Zwängen er damit unterworfen war. Die Darstellung von Sexualität und Geschlechtlichkeit in den jeweiligen Filmen ist besonders deswegen wichtig, weil diese sehr deutlich die Veränderungen innerhalb der Aufklärungsfilme aufzeigt. Das Buch „Sex verklärt - Der deutsche Aufklärungsfilm“ von Rolf Thissen, basierend auf den Recherchen zu einer Sendung über die Geschichte des Aufklärungsfilms, die am 7. Juni 1993 im ZDF ausgestrahlt wurde, ist das wohl umfassendste Werk zu diesem Thema und bildet eine der Hauptgrundlagen der vorliegenden Arbeit.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- 1. Der Aufklärungsfilm
- 2. 1910-20 Die 'Sittenfilme'
- 2.1 „Deutsche Gesellschaft zur Bekämpfung von Geschlechtskrankheiten“
- 2.2 Richard Oswald und sein „Sozialhygienisches Filmwerk“
- 2.3 Sexualität und Geschlechtlichkeit
- 3. 1920-30
- 3.1 Aufklärungsfilme dieser Zeit
- 3.2 Der 'Kulturfilm'
- 3.3 Sexualität und Geschlechtlichkeit
- 4. Nationalsozialismus
- 4.1 „Opfer der Vergangenheit“
- 4.2 Sexualität und Geschlechtlichkeit
- 5. Nachkriegszeit
- 5.1 Aufklärungsfilme
- 5.2 Sexualität und Geschlechtlichkeit
- 6. Die 60er Jahre
- 6.1 Die „Helga“ – Reihe
- 6.2 Oswald Kolle
- 6.3 Sexualität und Geschlechtlichkeit
- 7. Die 70er Jahre – „Die Sex- (Report-) welle“
- 7.1 Die „Schulmädchen Report“ – Reihe
- 7.2 Sexualität und Geschlechtlichkeit
- 8. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung des deutschen Aufklärungsfilms im 20. Jahrhundert. Sie analysiert den Einfluss politischer und gesellschaftlicher Faktoren auf die Darstellung von Sexualität und Geschlechtlichkeit in diesen Filmen und zeigt auf, wie sich die Filme an die jeweiligen gesellschaftlichen Veränderungen angepasst haben. Der Fokus liegt auf der Veränderung der Darstellungsweise von Sexualität über die Jahrzehnte hinweg.
- Entwicklung des Aufklärungsfilms im 20. Jahrhundert
- Der Einfluss gesellschaftlicher und politischer Bedingungen auf die Filmdarstellung
- Veränderung der Darstellung von Sexualität und Geschlechtlichkeit in Aufklärungsfilmen
- Die Rolle des Aufklärungsfilms in der öffentlichen Diskussion über Sexualität
- Der Vergleich verschiedener Filmemacher und -serien
Zusammenfassung der Kapitel
1. Der Aufklärungsfilm: Der einführende Abschnitt definiert den Begriff "Aufklärungsfilm" und betont seine anfängliche Vielseitigkeit, im Gegensatz zu seiner heutigen, fast ausschließlichen Assoziation mit Filmen über Sexualität. Es wird deutlich gemacht, dass die Verwendung sexueller Inhalte, die sonst zensiert worden wären, eine früh erkannte und genutzte Strategie darstellte. Die Arbeit betont die Notwendigkeit, Aufklärungsfilme im gesellschaftlichen Kontext ihrer Entstehungszeit zu betrachten.
2. 1910-20 Die 'Sittenfilme': Dieses Kapitel beleuchtet die Rolle der "Deutschen Gesellschaft zur Bekämpfung von Geschlechtskrankheiten" in der Produktion von Aufklärungsfilmen in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Die Filme, oft als "Volksbelehrungsfilme" bezeichnet, fokussierten sachlich auf Geschlechtskrankheiten wie Gonorrhöe und Syphilis, fanden aber wenig Anklang beim Publikum. Nach dem Ersten Weltkrieg blieben die Themen bestehen, die filmische Umsetzung veränderte sich jedoch.
2.2 Richard Oswald und sein „Sozialhygienisches Filmwerk“: Der Abschnitt konzentriert sich auf den Regisseur Richard Oswald und seine Filme, die sich mit den Gefahren von Syphilis, Abtreibung, Prostitution und Homosexualität auseinandersetzten. Oswalds Filme, obwohl im Kontext der "Gesellschaft zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten" entstanden, zeichneten sich durch eine melodramatische Erzählweise aus. Sein Werk wird als Spiegel seiner Zeit interpretiert, geprägt von demokratischen Strömungen.
5. Nachkriegszeit: Dieses Kapitel behandelt die Entwicklung der Aufklärungsfilme nach dem Zweiten Weltkrieg. Es analysiert die Veränderungen in der Darstellung der Sexualität und Geschlechtlichkeit in diesem Kontext und wie die Filme auf die gesellschaftlichen und kulturellen Umwälzungen reagierten. Ohne nähere Einzelheiten zu den spezifischen Filmen zu geben, wird der allgemeine Wandel in der filmischen Darstellung beschrieben.
6. Die 60er Jahre: Der Abschnitt beschreibt die Entwicklung des Aufklärungsfilms in den 60er Jahren, indem er auf die "Helga"-Reihe und die Arbeiten von Oswald Kolle eingeht. Es wird der Wandel in der Darstellung von Sexualität analysiert, der mit den gesellschaftlichen Veränderungen der Zeit einherging. Der Fokus liegt auf dem Übergang zu offeneren und expliziteren Darstellungen.
7. Die 70er Jahre – „Die Sex- (Report-) welle“: Dieses Kapitel beschreibt die "Sex-Welle" der 70er Jahre, unter anderem repräsentiert durch die "Schulmädchen Report"-Reihe. Die Analyse konzentriert sich auf die veränderte Darstellung von Sexualität in den Filmen und die Reaktion darauf in der Gesellschaft. Der Einfluss der gesellschaftlichen Liberalisierung wird hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Aufklärungsfilm, Sexualität, Geschlechtlichkeit, Sittenfilm, Richard Oswald, Volksbelehrungsfilm, Nationalsozialismus, Nachkriegszeit, 60er Jahre, 70er Jahre, Zensur, Gesellschaftliche Veränderungen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum deutschen Aufklärungsfilm im 20. Jahrhundert
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung des deutschen Aufklärungsfilms im 20. Jahrhundert. Sie analysiert den Einfluss politischer und gesellschaftlicher Faktoren auf die Darstellung von Sexualität und Geschlechtlichkeit in diesen Filmen und zeigt auf, wie sich die Filme an die jeweiligen gesellschaftlichen Veränderungen angepasst haben. Der Fokus liegt auf der Veränderung der Darstellungsweise von Sexualität über die Jahrzehnte hinweg.
Welche Zeiträume werden behandelt?
Die Arbeit umfasst die Entwicklung des Aufklärungsfilms von den Anfängen um 1910 bis in die 1970er Jahre. Einzelne Kapitel befassen sich mit den „Sittenfilmen“ der 1910er und 1920er Jahre, der Zeit des Nationalsozialismus, der Nachkriegszeit, den 1960er und den 1970er Jahren ("Sex-Welle").
Welche Themenschwerpunkte werden untersucht?
Die Arbeit untersucht die Entwicklung des Aufklärungsfilms, den Einfluss gesellschaftlicher und politischer Bedingungen auf die Filmdarstellung, die Veränderung der Darstellung von Sexualität und Geschlechtlichkeit, die Rolle des Aufklärungsfilms in der öffentlichen Diskussion über Sexualität und vergleicht verschiedene Filmemacher und -serien.
Welche Filmemacher werden genannt?
Ein besonderer Fokus liegt auf Richard Oswald und seinem „Sozialhygienischen Filmwerk“, sowie auf der „Helga“-Reihe der 60er und der „Schulmädchen Report“-Reihe der 70er Jahre.
Wie wird die Sexualität in den Filmen dargestellt?
Die Arbeit beschreibt die Veränderung der Darstellung von Sexualität über die Jahrzehnte hinweg. Sie zeigt, wie die Darstellung von Sexualität und Geschlechtlichkeit von sachlichen und moralischen Appellen hin zu offeneren und expliziteren Darstellungen überging, dies stets im Kontext der jeweiligen gesellschaftlichen und politischen Bedingungen.
Welche Rolle spielte die Zensur?
Die Arbeit impliziert die Rolle der Zensur, da die Nutzung von sexuellen Inhalten, die sonst zensiert worden wären, als eine früh erkannte und genutzte Strategie im Aufklärungsfilm hervorgehoben wird. Die konkrete Auswirkung der Zensur auf die Filmproduktion wird jedoch nicht explizit detailliert.
Welche Institutionen werden erwähnt?
Die „Deutsche Gesellschaft zur Bekämpfung von Geschlechtskrankheiten“ wird als wichtiger Akteur in der Produktion von Aufklärungsfilmen in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg genannt.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Schlüsselbegriffe sind: Aufklärungsfilm, Sexualität, Geschlechtlichkeit, Sittenfilm, Richard Oswald, Volksbelehrungsfilm, Nationalsozialismus, Nachkriegszeit, 60er Jahre, 70er Jahre, Zensur, Gesellschaftliche Veränderungen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in Kapitel unterteilt, die jeweils einen spezifischen Zeitraum oder Aspekt des deutschen Aufklärungsfilms behandeln. Sie enthält ein Vorwort, ein Inhaltsverzeichnis, eine Zielsetzung mit Themenschwerpunkten, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und eine Liste der Schlüsselwörter.
- Quote paper
- Kim Thiel (Author), 2004, Aufklärungsfilme und die erotischen Filme der 60er und 70er Jahre, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/25920