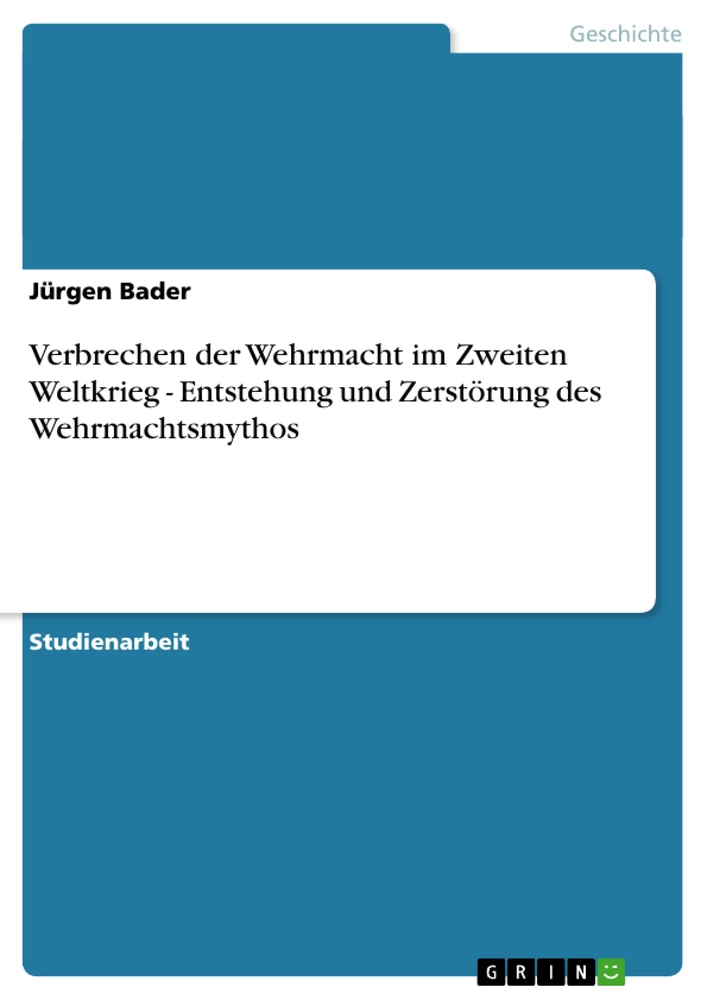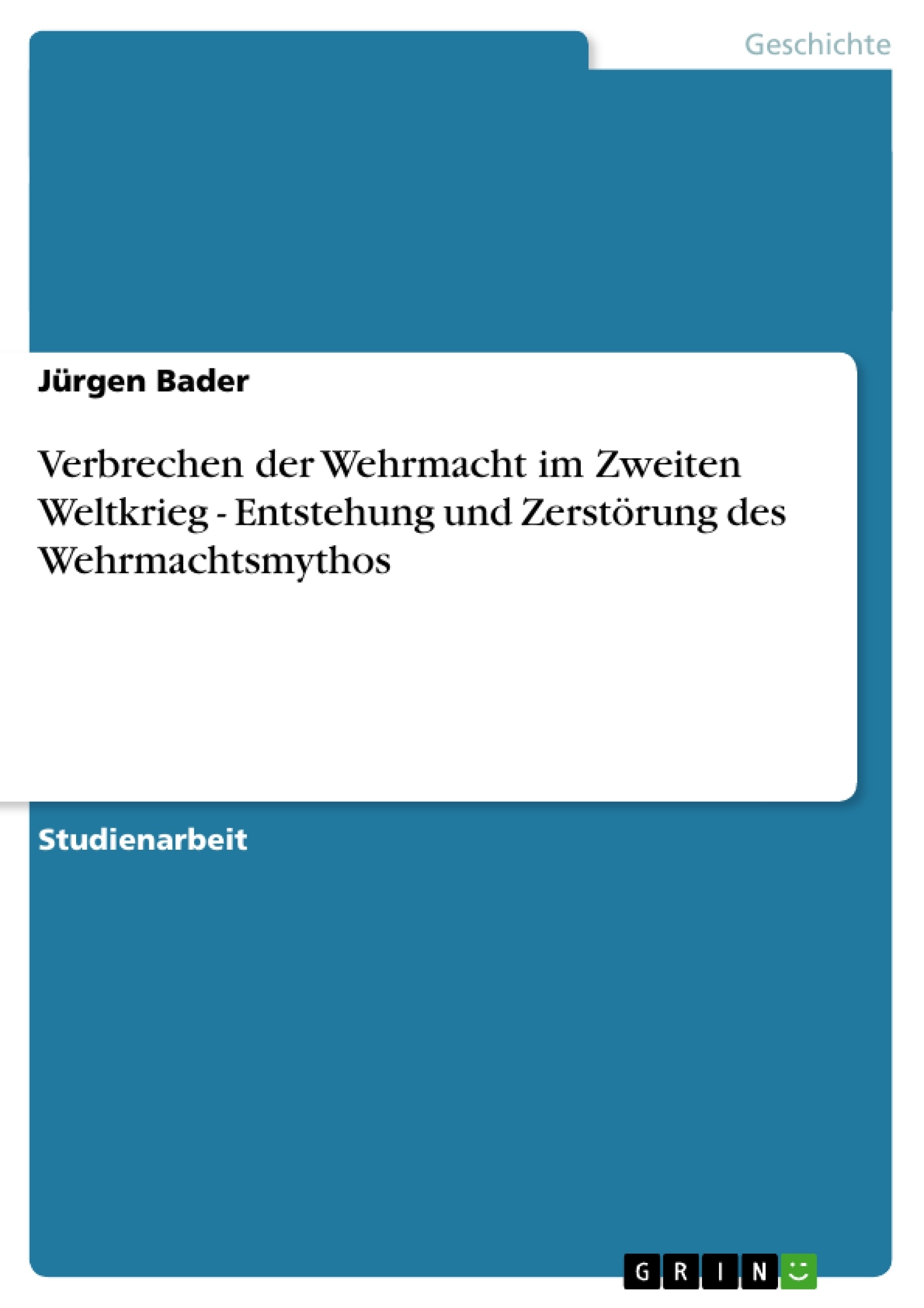Als die Ausstellung „Vernichtungskrieg, Verbrechen der Wehrmacht 1941 bis 1944“ 1995 durch das Hamburger Institut für Sozialforschung zusammengestellt wurde und auf Reise durch die Bundesrepublik ging, entbrannte eine hitzige Debatte in der Gesellschaft ob und auf welche Weise Angehörige der deutschen Wehrmacht an Verbrechen während des Zweiten Weltkriegs beteiligt waren. Zum ersten Mal in der Geschichte der BRD gerieten einfache Angehörige der Wehrmacht – die „Landser“ – in den Verdacht, nicht nur an den verschiedenen Fronten gekämpft zu haben, sondern auch an Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung und sonstigen Gräueltaten beteiligt gewesen zu sein oder doch zumindest davon gewusst zu haben. Der Mythos vom tapferen deutschen Soldaten, der mit einer „weißen Weste“ aus dem Krieg nach Hause kam, war zerstört.
Dass diese Ausstellung solch emotionale Debatten in Politik und Gesellschaft auslöste, gar zu Demonstrationen in den einzelnen Ausstellungsstädten führte, verwundert aber nicht. Nicht die Schuld oder Unschuld einzelner NS-Größen, sondern die Schuldfrage von rund 20 Millionen Angehörigen der Wehrmacht wurde gestellt. Über 50 Jahre nach der bedingungslosen Kapitulation Hitlerdeutschlands stellte sich nun die Frage, welchen Anteil die Großvätergeneration an den verbrecherischen Taten, die im Namen Hitlers begannen wurden, hatte. Dieses Mal befanden sich nicht die Angehörigen der SS oder anderen NS-Organisationen auf der Anklagebank, sondern jene Großväter, die als Soldaten der Wehrmacht in den Krieg ziehen mussten. Auf diese Weise war so praktisch jede Familie von der Diskussion betroffen. Die Erzählungen des eigenen Vaters oder Großvaters wurden urplötzlich, nach so langer Zeit, in Frage gestellt.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Die Wehrmacht
- Struktur und Einsatz der Wehrmacht
- Verbrechen der Wehrmacht im Osten
- Verbrechen in anderen besetzten Gebieten
- Die Wehrmacht in Serbien
- Die Wehrmacht in Griechenland
- Verbrechen in anderen besetzten Gebieten
- Umgang mit der Wehrmacht, deren Angehörigen und NS-Verbrechen nach 1945
- Gerichtsverhandlungen
- Allierte und ausländische Gerichte
- Deutsche Gerichte
- Prozess gegen Angehörige der Wehrmacht – der „OKW-Prozess“
- Die Stimmung innerhalb der Gesellschaft und der Umgang mit Schuld
- Gerichtsverhandlungen
- Wehrmachtsmythos und Diskussion im Zuge der Wehrmachtsausstellung
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text analysiert die Geschichte der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg, die Rolle ihrer Angehörigen in den NS-Verbrechen und die Entstehung und Zerstörung des Wehrmachtsmythos. Er untersucht die Debatten um die Schuldfrage in der Nachkriegszeit und beleuchtet die Auswirkungen der Wehrmachtsausstellung auf die öffentliche Meinung.
- Struktur und Einsatz der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg
- Verbrechen der Wehrmacht gegen die Zivilbevölkerung in besetzten Gebieten
- Die Rolle der Wehrmacht in der NS-Ideologie und im Rassenwahn
- Die Debatte um die Schuldfrage in der Nachkriegszeit
- Die Entstehung und Zerstörung des Wehrmachtsmythos
Zusammenfassung der Kapitel
Vorwort
Das Vorwort schildert die Entstehung der Wehrmachtsausstellung und die heftigen Reaktionen in der deutschen Gesellschaft. Es stellt die zentrale Frage nach der Schuld von Angehörigen der Wehrmacht an den Verbrechen des Zweiten Weltkriegs.
Die Wehrmacht
Struktur und Einsatz der Wehrmacht
Dieser Abschnitt beschreibt die Struktur der Wehrmacht, ihre Entwicklung und ihren Einsatz in verschiedenen Kriegsschauplätzen. Er beleuchtet die Rolle des Oberkommandos der Wehrmacht und die verschiedenen Waffengattungen.
Verbrechen der Wehrmacht im Osten
Dieser Abschnitt untersucht die Verbrechen der Wehrmacht in den besetzten Gebieten des Ostens. Er beleuchtet die systematischen Gräueltaten, die an der Zivilbevölkerung verübt wurden.
Umgang mit der Wehrmacht, deren Angehörigen und NS-Verbrechen nach 1945
Gerichtsverhandlungen
Dieser Abschnitt befasst sich mit den Gerichtsverhandlungen gegen Angehörige der Wehrmacht nach dem Zweiten Weltkrieg. Er analysiert die Verhandlungsergebnisse und die verschiedenen Gerichtsbarkeiten.
Prozess gegen Angehörige der Wehrmacht – der „OKW-Prozess“
Dieser Abschnitt konzentriert sich auf den Prozess gegen die höchste Führungsebene der Wehrmacht, den sogenannten „OKW-Prozess".
Die Stimmung innerhalb der Gesellschaft und der Umgang mit Schuld
Dieser Abschnitt schildert die Stimmung in der deutschen Gesellschaft nach dem Zweiten Weltkrieg und beleuchtet den Umgang mit der Schuldfrage.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe des Textes sind: Wehrmacht, Zweiter Weltkrieg, NS-Verbrechen, Wehrmachtsmythos, Schuldfrage, Vergangenheitsbewältigung, Entnazifizierung, Wehrmachtsausstellung, Blitzkrieg, Einsatzgruppen.
- Quote paper
- Jürgen Bader (Author), 2003, Verbrechen der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg - Entstehung und Zerstörung des Wehrmachtsmythos, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/25485