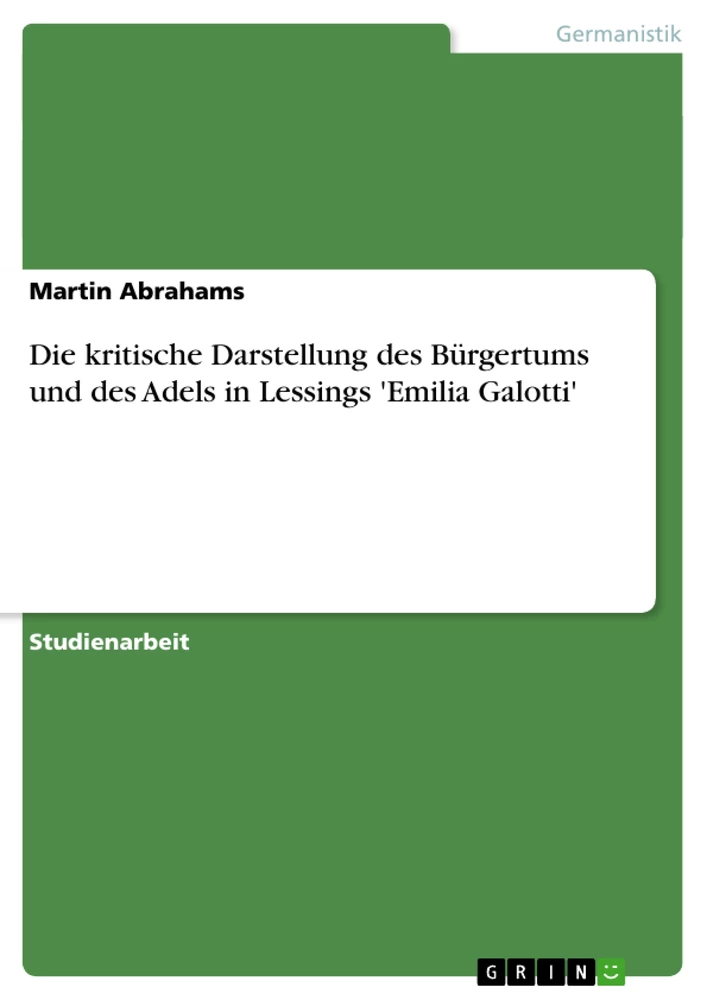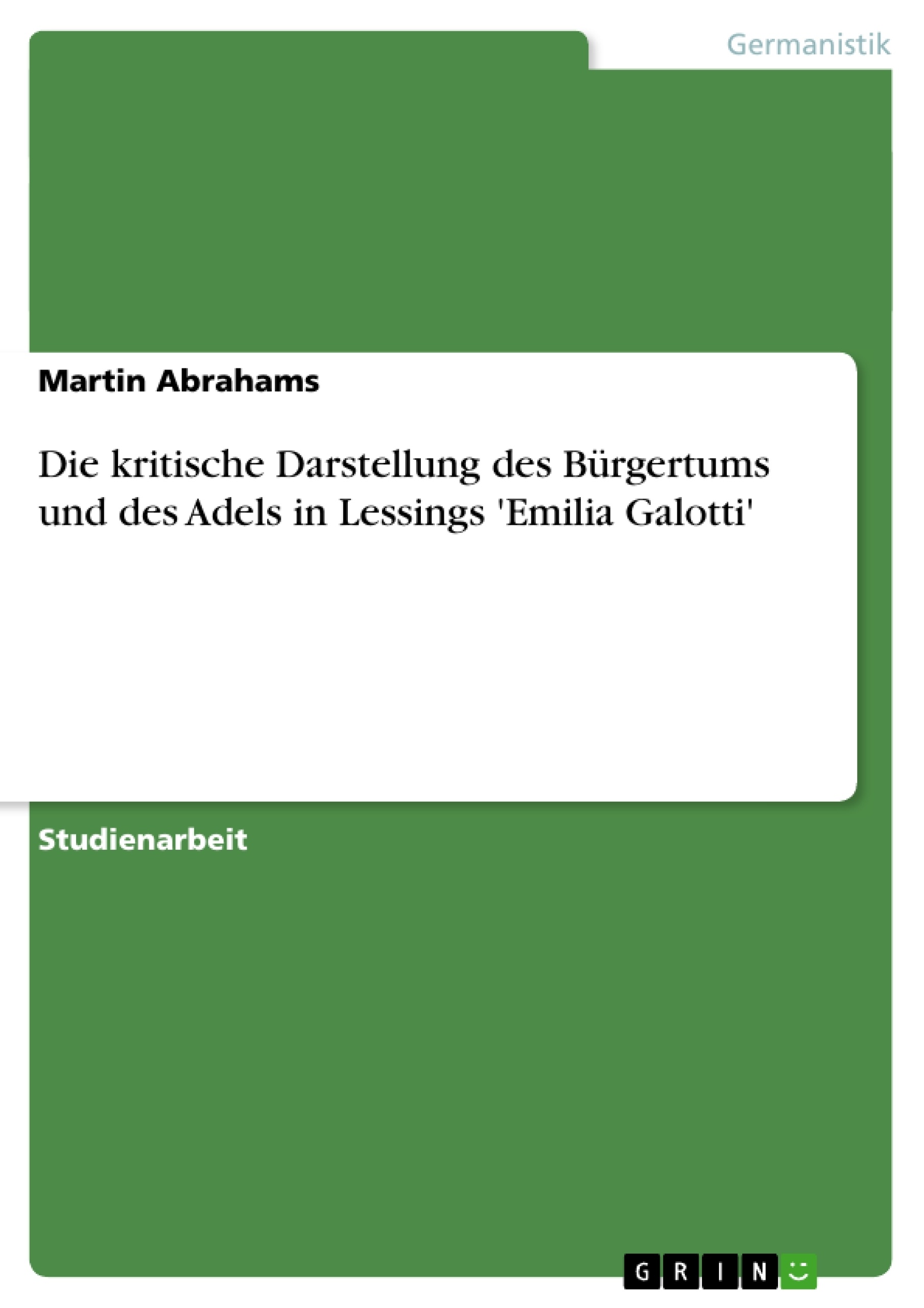Die heroische Tragödie bezog ihre Stoffe aus Geschichte und Mythos. Könige und Helden repräsentierten den Menschen gleich welche n Standes und das Unglück das sie befiel, war das durch Menschenkraft Unabwendbare, Absolute. Die zentrale Thematik war in der Regel das Verhältnis des Menschen zum Übermenschlichen. Das Auftreten des bürgerlichen Trauerspiels um 1755 bringt einen grundlegenden Wandel des Tragischen mit sich. Nicht mehr Märtyrertum und Welthaltigkeit stehen nun im Vordergrund, sondern das Moralische, Private und der Mensch in seiner Bindung an die Gemeinschaft. Darüber hinaus soll ihn nicht länger ein durch das Jenseits determiniertes Schicksal ereilen: ein grausames, undurchschaubares Verhängnis kann nicht mehr Tragik begründen. Die Verursachung des Tragischen wird in den Menschen und in dessen Welt verlegt. Entsprechend verknüpft das bürgerliche Trauerspiel Unglück, Schuld und Charakter; man legt Wert auf Kausalität und lückenlose Motivation. Religiöse Fragen spielen noch eine Rolle, das Metaphysische ist jedoch nicht mehr der Gehalt des Tragischen, denn maßgebend ist das Diesseits. Ein Bezug zur Säkularisation kann hergestellt werden: „Ihr Träger ist das Bürgertum, das seine humanitäre Ideologie im Widerspruch gegen die transzendenten Deutungen der institutionalisierten Religion ausbildet“ (Guthke 1994, S. 19). Eine bürgerliche und nicht-bürgerliche Gesinnung ist im bürgerlichen Trauerspiel allerdings nicht an Standesgegensätze gebunden.
Mit Emilia Galotti (1772) finden Konflikte zwischen den Ständen und gesellschaftskritische Elemente Einzug in das bürgerliche Trauerspiel. In erster Linie richtet sich die darin enthaltene Gesellschaftskritik an die Aristokratie, das Bürgertum wird allerdings ebenfalls einer kritischen Prüfung unterzogen. Auch hier werden also moralische Gegensätze nicht verschiedenen Ständen zugeordnet, vielmehr ist vermeintliches Fehlverhalten durch standestypische Verhaltensweisen bedingt (vgl. Guthke 1994, S. 75). [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kritik am herrschenden Adel
- Fürstliche Macht und Willkür
- Die Unvereinbarkeit von fürstlicher Macht und Empfindsamkeit
- Hinterfragung des Bürgertums
- Familiäre Disharmonien
- Kritik an bürgerlichen Tugend- und Moralprinzipien
- Zur Mehrdeutigkeit der Kritik in Emilia Galotti
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit analysiert Lessings „Emilia Galotti“ mit dem Fokus auf die kritische Darstellung von Adel und Bürgertum. Ziel ist es, die im Stück präsentierten Gesellschaftsstrukturen und -konflikte zu untersuchen und die Rolle von Macht, Moral und Empfindsamkeit in diesem Kontext zu beleuchten.
- Kritik am fürstlichen Absolutismus und dessen Einfluss auf die Bürgerlichen
- Hinterfragung bürgerlicher Tugenden und Moralvorstellungen
- Die Rolle von Macht und Empfindsamkeit in den Beziehungen zwischen Adel und Bürgertum
- Die Mehrdeutigkeit der Kritik in Lessings Werk und die Frage nach dem Verhältnis von individueller Freiheit und gesellschaftlicher Ordnung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Diese Einleitung beleuchtet den Wandel der Tragödie vom heroischen zum bürgerlichen Trauerspiel und stellt die zentralen Merkmale dieser neuen Gattung vor. Sie betont die Verlagerung des Fokus vom Übermenschlichen auf das Moralische, Private und den Menschen in seiner Bindung an die Gemeinschaft.
1. Kritik am herrschenden Adel
1.1 Fürstliche Macht und Willkür
Das Kapitel analysiert die Darstellung der fürstlichen Macht im Stück und zeigt, wie der Prinz als Vertreter des Absolutismus als unberechenbar, willkürlich und teilweise sogar menschenverachtend dargestellt wird. Sein Einfluss auf die Bürgerlichen wird als einschränkend und dominant beschrieben.
1.2 Die Unvereinbarkeit von fürstlicher Macht und Empfindsamkeit
Dieser Teil befasst sich mit dem Konflikt zwischen der Funktion des Prinzen als Herrscher und seiner emotionalen Verstrickung in die Liebe zu Emilia. Seine Rolle als Liebender wird als auffälliger Kontrast zu seiner Rolle als Regent dargestellt.
2. Hinterfragung des Bürgertums
2.1 Familiäre Disharmonien
(Zusammenfassendes Kapitel zu den familiären Disharmonien im Bürgertum – Inhalt und Kernaussagen hier kurz und prägnant darstellen)
2.2 Kritik an bürgerlichen Tugend- und Moralprinzipien
(Zusammenfassendes Kapitel zu den moralischen Problemen innerhalb des Bürgertums – Inhalt und Kernaussagen hier kurz und prägnant darstellen)
Schlüsselwörter
Schlüsselwörter der Seminararbeit sind: Bürgerliches Trauerspiel, Lessing, Emilia Galotti, Adel, Bürgertum, Macht, Willkür, Empfindsamkeit, Moral, Tugend, Gesellschaft, Kritik, Konflikte, Individuum, Freiheit, Ordnung.
- Quote paper
- Martin Abrahams (Author), 2003, Die kritische Darstellung des Bürgertums und des Adels in Lessings 'Emilia Galotti', Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/25334