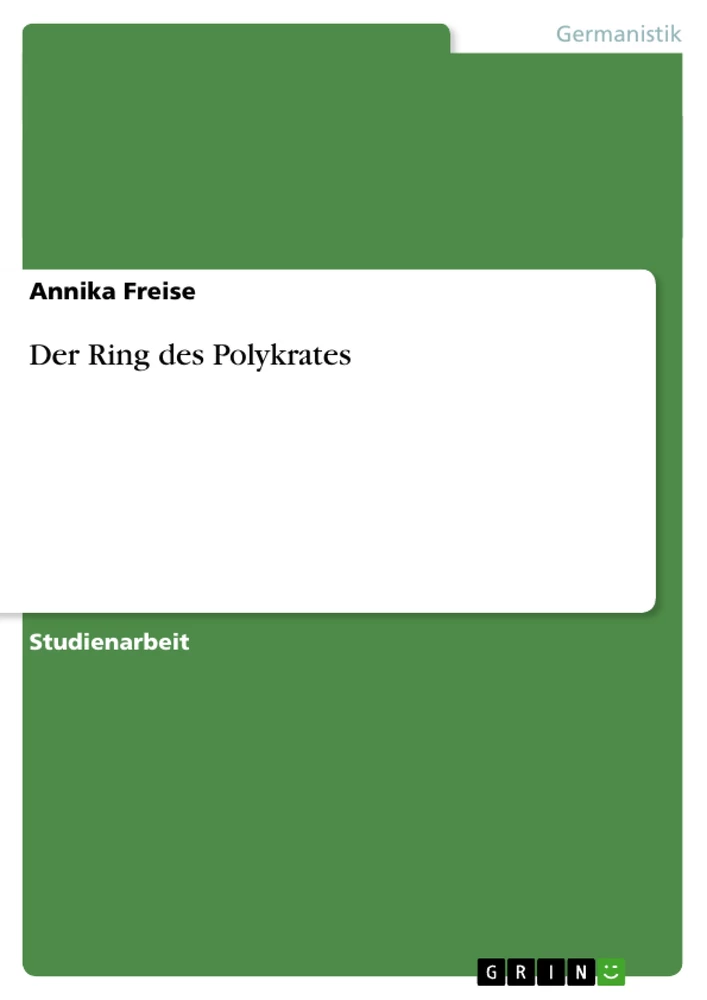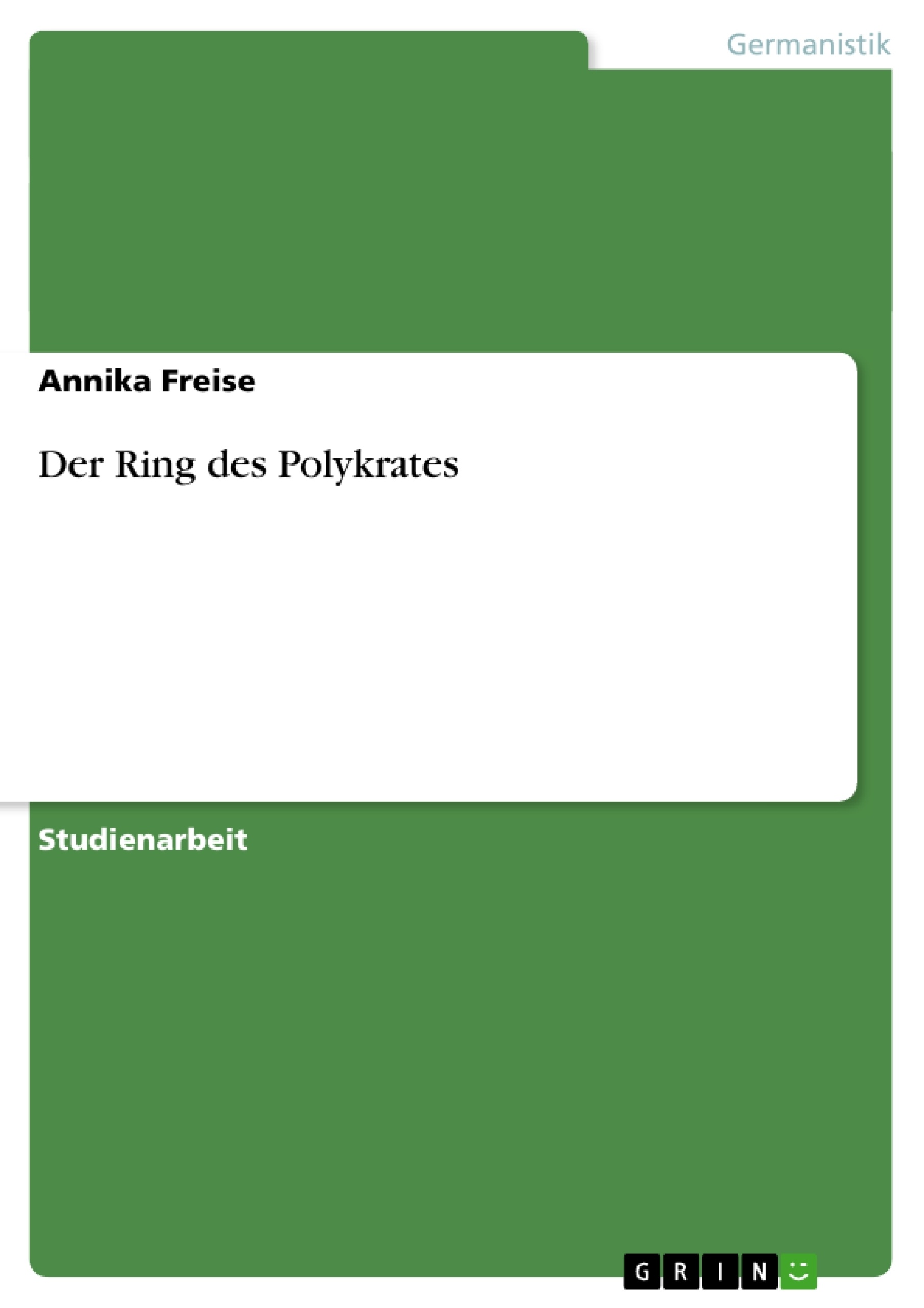Die Balladenproduktion der Klassik beschränkt sich auf die Arbeiten Goethes (1749-1832) und die Schillers (1759-1805). Die beiden Literaten verband seit 1794 eine äußerst produktive Freundschaft, aus der 1797 (sog. Balladenjahr) und 1798 eine Reihe von Balladen resultierte, die in den „Musenalmanach für das Jahr 1798“ und „Musenalmanach für das Jahr 1799 veröffentlicht wurden“.1 Gemeinsam entwickelten sie eine neue Gattung der Kunstballade, die Ideenballade. Mit dieser Art Ballade wollten Goethe und Schiller ihr idealistisches Kunstverständnis volkstümlich vermitteln: Historische Gestalten und Ereignisse werden zu Repräsentanten einer tragenden Idee. In jener Ballade wird ein allgemeiner Gedanke, eine Idee exemplifiziert. Sie ist im Grunde nicht historisch, denn das Herausstellen bestimmter Werte und Eigenschaften ist eigentlich der Anlass und das Ziel der Stoffverarbeitung. 2 Trotz des gemeinsamen Grundgedankens finden sich Unterschiede in den Balladen Goethes und denen Schillers.
Goethe stellt den Menschen in magische und mythische Bezüge, während Schiller anstelle des Allegorischen das Parabolische stellt.3 Die beiden orientierten sich während ihres Schaffens in der Klassik an der griechischen Antike. Ihre Vorstellungen kreisten um Begriffe wie Maß, Harmonie, Humanität und Geschlossenheit. So ist es nicht verwunderlich, dass Schiller als Vorlage für seine Ideenballade „Der Ring des Polykrates“ eine Erzählung aus der griechischen Antike diente. Der Bericht über die Geschichte des Polykrates befindet sich in dem von Herodot geschriebenen Buch Kapitel III 39-44. Polykrates ist eine historische Figur. Er war der Tyrann (= Herr) von Samos etwa 538-522 v. Chr. Auf dem Höhepunkt seiner Macht wurde er von einem persischen „Freund“ in einen Hinterhalt gelockt und ermordet.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Entstehungskontext zu der Ballade „Der Ring des Polykrates“
- 2. Änderungen in Schillers Ballade
- 3. Aufbau
- 4. Formale Aspekte
- 4.1 Reimschema und Metrum
- 4.2 Sprache und Stil
- 5. Interpretationsansätze
- 5.1 Nähe zur griechischen Antike
- 5.2 „Der Ring des Polykrates“ als Ballade des rechten Maßes
- 5.3 „Der Ring des Polykrates“ als Parabel
- 6. Balladencharakter
- 7. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert Friedrich Schillers Ballade „Der Ring des Polykrates“, indem sie den Entstehungskontext, die Änderungen gegenüber der Herodotschen Vorlage, den Aufbau, die formalen Aspekte und verschiedene Interpretationsansätze beleuchtet. Der Fokus liegt auf der Untersuchung der Ballade als exemplarische Darstellung von Ideen der Klassik und ihrer literarischen Gestaltung.
- Entstehungskontext und Bezug zur griechischen Antike
- Schillers Änderungen gegenüber Herodots Erzählung
- Formaler Aufbau und stilistische Mittel der Ballade
- Interpretationsansätze: Ballade des rechten Maßes und Parabel
- Der Balladencharakter und seine Wirkung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Entstehungskontext zu der Ballade „Der Ring des Polykrates“: Dieses Kapitel beschreibt den literarischen Kontext der Ballade innerhalb der Klassik, insbesondere die Zusammenarbeit zwischen Goethe und Schiller und die Entstehung der „Ideenballade“ als neue Gattung. Es wird der gemeinsame Wunsch der beiden Autoren hervorgehoben, idealistische Kunstvorstellungen volkstümlich zu vermitteln, indem historische Ereignisse als Repräsentanten einer tragenden Idee genutzt werden. Die Unterschiede in den Balladen Goethes und Schillers werden angedeutet, wobei Goethes Fokus auf magischen und mythischen Bezügen und Schillers auf dem Parabolischen liegt. Der Bezug zu der griechischen Antike und den damit verbundenen Vorstellungen von Maß, Harmonie, Humanität und Geschlossenheit wird als Grundlage für Schillers Werk hervorgehoben, wobei die Geschichte des Polykrates aus Herodot als Vorlage dient. Der historische Polykrates, Tyrann von Samos, wird als Person vorgestellt und sein tragischer Tod wird kurz umrissen.
2. Änderungen in Schillers Ballade: Dieses Kapitel vergleicht Schillers Ballade mit der Vorlage Herodots. Schiller konzentriert die Handlung auf zwei Tage, im Gegensatz zu Herodots längerer Erzählung. Er verändert die Kommunikation zwischen Amasis und Polykrates von schriftlich zu einem direkten Gespräch. Das Glücksgeschehen wird in einer dreistufigen Steigerung dargestellt (Festigung der Macht, wachsender Reichtum, Kriegsglück). Schiller fügt den Hinweis auf den Tod des "treuen Erben" hinzu und gestaltet die Opferung des Rings und dessen Wiederkehr impulsiver und dramatischer als bei Herodot. Insgesamt wird deutlich, wie Schiller die Erzählung Herodots dramatisiert und die Handlung verdichtet, um eine stärkere Wirkung zu erzielen. Die anschauliche Ausgestaltung von Macht, Reichtum und Kriegsglück durch Schiller wird besonders hervorgehoben.
3. Aufbau: Die Struktur der Ballade wird detailliert erläutert. Die Ballade gliedert sich, abgesehen von der Exposition und dem Schluss, in zwei gleich große Teile. Die Strophen II bis VIII bilden ein „Vorspiel“, in dem die dreistufige Glücksverwirklichung im Gespräch zwischen Amasis und Polykrates dargestellt wird. Die Strophen IX bis XV enthalten die eigentliche Probe (Ringopfer) und das Ergebnis. Die einzelnen Strophen werden in ihren Funktionen innerhalb des Gesamtkontexts der Ballade erklärt.
Schlüsselwörter
Friedrich Schiller, Ballade, „Der Ring des Polykrates“, Herodot, Ideenballade, Klassik, griechische Antike, Glücksbegriff, Schicksal, Parabel, Aufbau, Formale Aspekte, Interpretationsansätze.
Häufig gestellte Fragen zu Schillers Ballade "Der Ring des Polykrates"
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Friedrich Schillers Ballade "Der Ring des Polykrates" umfassend. Sie untersucht den Entstehungskontext, die Unterschiede zur Herodotschen Vorlage, den Aufbau, die formalen Aspekte (Reimschema, Metrum, Sprache, Stil) und verschiedene Interpretationsansätze. Der Fokus liegt auf der Ballade als exemplarische Darstellung von Ideen der Klassik und ihrer literarischen Gestaltung.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Entstehungskontext und Bezug zur griechischen Antike, Schillers Änderungen gegenüber Herodots Erzählung, formaler Aufbau und stilistische Mittel der Ballade, Interpretationsansätze (Ballade des rechten Maßes und Parabel), sowie den Balladencharakter und seine Wirkung.
Wie ist die Ballade aufgebaut?
Die Ballade gliedert sich, abgesehen von Exposition und Schluss, in zwei gleich große Teile. Strophen II bis VIII bilden ein "Vorspiel", das die dreistufige Glücksverwirklichung darstellt. Strophen IX bis XV zeigen die eigentliche Probe (Ringopfer) und das Ergebnis. Die Funktion jeder Strophe im Gesamtkontext wird erklärt.
Welche Änderungen hat Schiller gegenüber Herodots Erzählung vorgenommen?
Schiller konzentriert die Handlung auf zwei Tage, im Gegensatz zu Herodots längerer Erzählung. Er verändert die Kommunikation von schriftlich zu einem direkten Gespräch. Das Glücksgeschehen wird dreistufig dargestellt. Schiller fügt den Tod des "treuen Erben" hinzu und gestaltet die Opferung des Rings dramatischer. Insgesamt verdichtet und dramatisierte Schiller die Erzählung für eine stärkere Wirkung.
Welche Interpretationsansätze werden betrachtet?
Die Arbeit untersucht verschiedene Interpretationsansätze, darunter die Betrachtung der Ballade als Darstellung des rechten Maßes und als Parabel. Die Nähe zur griechischen Antike und die damit verbundenen Vorstellungen von Maß, Harmonie, Humanität und Geschlossenheit werden als Grundlage für Schillers Werk hervorgehoben.
Wie ist der Entstehungskontext der Ballade?
Das Kapitel zum Entstehungskontext beschreibt den literarischen Kontext innerhalb der Klassik, die Zusammenarbeit zwischen Goethe und Schiller und die Entstehung der "Ideenballade". Es wird der Wunsch nach volkstümlicher Vermittlung idealistischer Kunstvorstellungen durch historische Ereignisse hervorgehoben. Die Unterschiede zwischen Goethes und Schillers Balladen werden angedeutet, wobei der Bezug zur griechischen Antike und die Geschichte des Polykrates aus Herodot als Vorlage dienen.
Welche formalen Aspekte werden analysiert?
Die Analyse der formalen Aspekte umfasst das Reimschema und Metrum sowie die Sprache und den Stil der Ballade. Diese Aspekte werden im Kontext der Gesamtinterpretation betrachtet und auf ihre Wirkung hin untersucht.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Friedrich Schiller, Ballade, "Der Ring des Polykrates", Herodot, Ideenballade, Klassik, griechische Antike, Glücksbegriff, Schicksal, Parabel, Aufbau, Formale Aspekte, Interpretationsansätze.
- Quote paper
- Annika Freise (Author), 2004, Der Ring des Polykrates, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/25077