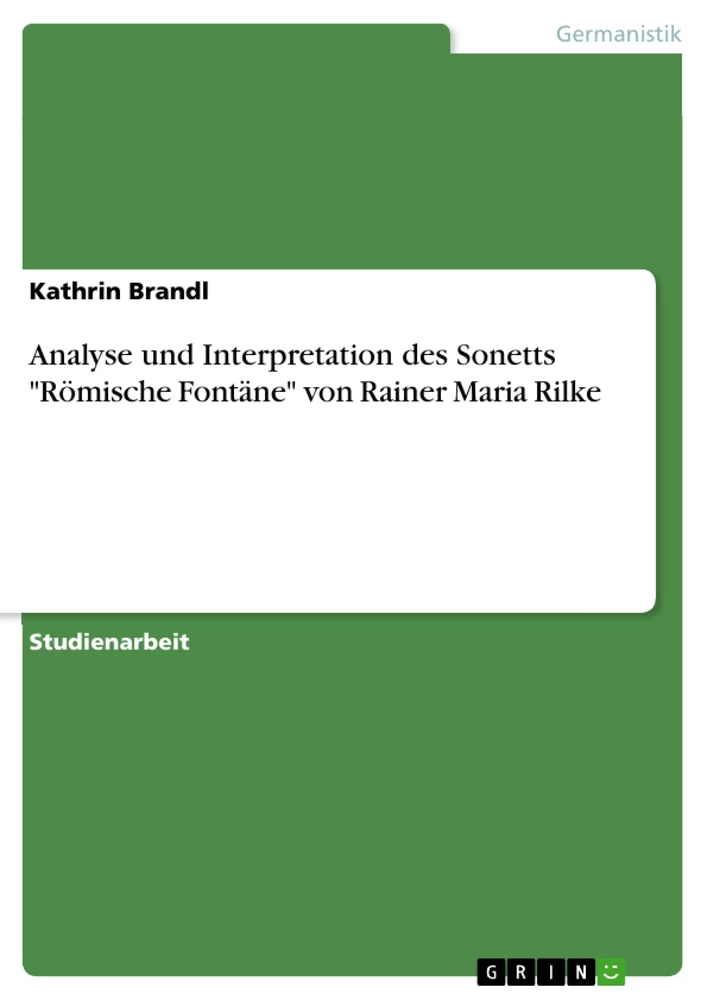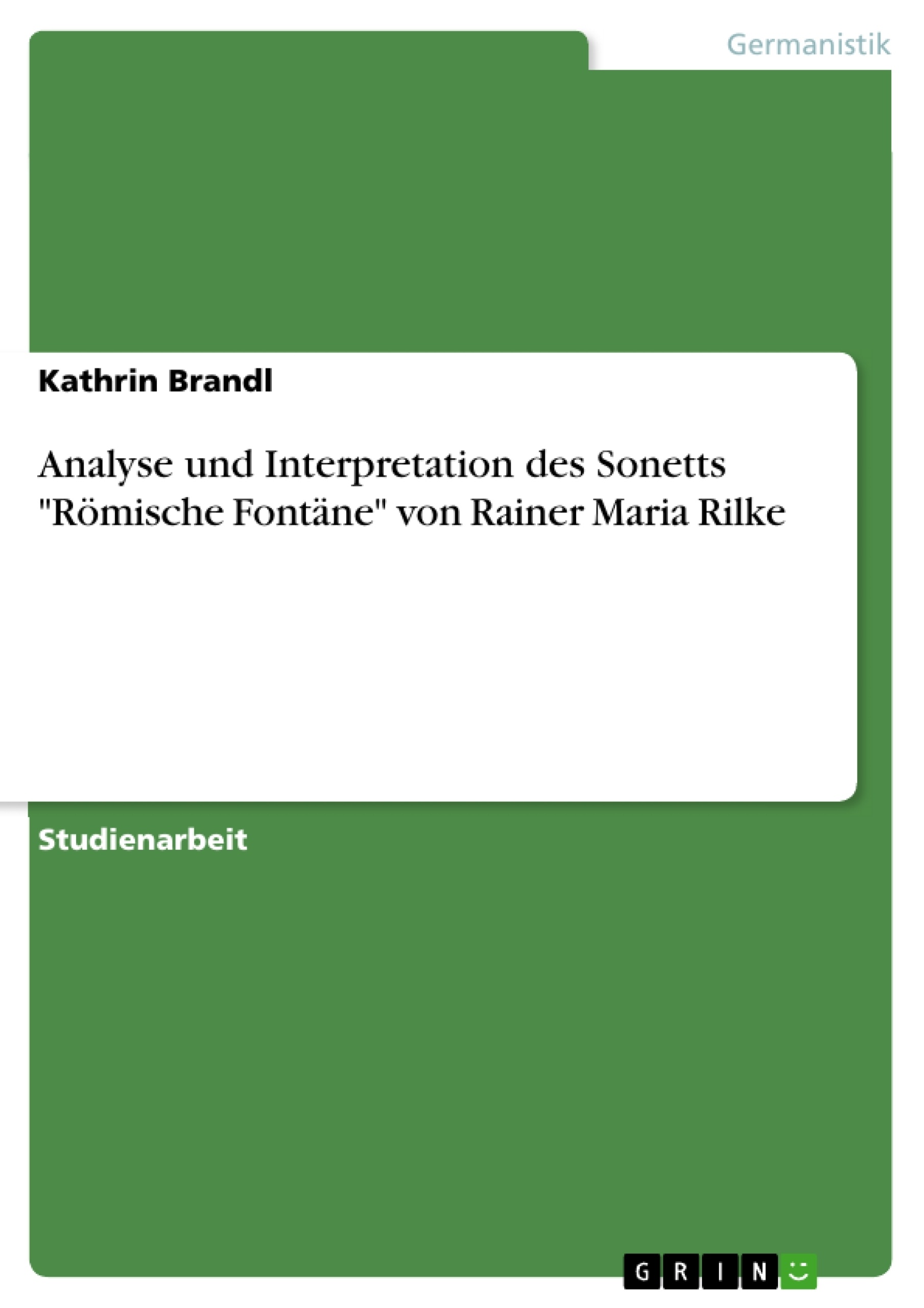Rainer Maria Rilke zählt wohl auch heute noch zu den bekanntesten und bedeutendsten deutschsprachigen Lyrikern.
Am 04. Dezember 1875 unter dem Namen René Karl Wilhelm Johann Josef Maria Rilke als Sohn eines Beamten einer Eisenbahngesellschaft und dessen Ehefrau, der Tochter eines Kaufmannes und Kaiserlichen Rates, in Prag geboren, waren seine Kinder- und Jugendjahre von drei wesentlichen Konflikten geprägt:
Zum Ersten erlebt der junge Rilke seine ersten zehn Lebensjahre in einer formal zwar geführten, in Wirklichkeit aber gescheiterten Ehe seiner Eltern, glaubt seine Mutter Sophie doch unter ihrem Stande verheiratet zu sein. Aus diesem Grund verlässt Sophie Rilke 1885 ihren Mann, wodurch in ihrem Sohn René das Gefühl tiefer Heimatlosigkeit erwachst. Eine weitere Problematik stellt die Schulzeit Rilkes dar. Nachdem er seine ersten vier Schuljahre auf einer vornehmen und streng christlichen Grundschule in Prag verbracht hat, schickt ihn sein Vater auf eine Militärschule in Österreich, da er für seinen Sohn eine Offizierslaufbahn vorgesehen hat. In den theoretischen Fächer zwar sehr gut abschneidend, empfindet der junge Rilke diesen Lebensabschnitt jedoch zunehmend als Grauen, da die körperlichen Anstrengungen und der raue Umgang der Mitschüler für den sensiblen Jungen eine wachsende Belastung darstellen. Daher bricht Rilke diese Ausbildung 1890 ab und kehrt 1892 nach einem einjährigen Aufenthalt an der Handelsschule Linz für Privatstudien nach Prag zurück, wo er 1895 die Reifeprüfung ablegt und „mit Auszeichnung“ besteht.
In diese Zeit fällt auch die erste Gedichtveröffentlichung Rilkes in einer Zeitung und die ständig zunehmende Fixierung des jungen Lyrikers auf die Literatur. Dies ist auch der Grund, warum Rilke nach zwei Semestern an der Universität Prag 1896 schließlich als Student der Philosophie nach München, einem damals kosmopoliten Zentrum, wechselt, empfindet er doch das Prager Deutsch als varia ntenarm und sich somit in seiner Tätigkeit als Schriftsteller eingeschränkt.
In München lernt René Rilke schließlich die schriftstellerisch tätige Lou Andreas-Salomé kennen. Die Geliebte, mütterliche Freundin und intellektuelle Lehrerin vermittelt Rilke Nietzsches Gedankenwelt und begeistert ihn für ihre Heimat, Russland; unter ihrem Einfluss ändert Rilke sogar seinen Vornamen von René zu Rainer. Gemeinsam mit dem Ehepaar Salomé bereist Rilke dann 1899 erstmals Russalnd, 1900 zum zweiten Mal mit Lou alleine.
Inhaltsverzeichnis
- 0. Kurzer Abriss über Leben und Werk Rilkes
- 1. Äußerer Aufbau und inhaltliche Gliederung
- 1.1. Der Titel
- 1.2. Die Strophenanordnung
- 1.3. Das Reimschema
- 1.4. Das Metrum
- 1.5. Die inhaltliche Gliederung
- 2. Syntax
- 2.1. Die Satzstruktur
- 2.2. Die Wortwahl
- 3. Bildliche und klangliche Gestaltung
- 3.1. Erste Strophe
- 3.2. Zweite Strophe
- 3.3. Dritte Strophe
- 3.4. Vierte Strophe
- 4. Deutungsversuche
- 4.1. Die Bildhaftigkeit
- 4.2. Die Dialektik
- 5. Römische Fontäne - Ein typisches Ding-Gedicht
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert und interpretiert Rainer Maria Rilkes Sonett „Römische Fontäne“. Ziel ist es, den Aufbau, die sprachliche Gestaltung und die möglichen Deutungen des Gedichts im Detail zu untersuchen und seine Stellung innerhalb des Gesamtwerks Rilkes, insbesondere im Kontext seiner Dinggedichte, zu beleuchten.
- Analyse des äußeren Aufbaus des Sonetts (Strophen, Reim, Metrum)
- Untersuchung der sprachlichen Mittel (Syntax, Wortwahl, Bildsprache)
- Interpretation der Bildhaftigkeit und der möglichen Deutungen
- Einordnung des Gedichts in den Kontext von Rilkes Werk und der Dingdichtung
- Bezugnahme auf Rilkes Biographie und Einflüsse
Zusammenfassung der Kapitel
0. Kurzer Abriss über Leben und Werk Rilkes: Dieser Abschnitt bietet einen knappen Überblick über das Leben und Schaffen Rainer Maria Rilkes. Er hebt wichtige biographische Stationen hervor, die Rilkes literarische Entwicklung beeinflussten, wie seine schwierige Kindheit, geprägt von den Konflikten seiner Eltern und seiner Zeit an der Militärschule. Der Einfluss von Lou Andreas-Salomé und Auguste Rodin auf Rilkes Werk wird ebenfalls beleuchtet, ebenso wie die Auswirkungen des Ersten Weltkriegs auf seine Produktivität. Der Abschnitt betont die Bedeutung der Dinggedichte in Rilkes Gesamtwerk und führt zur Analyse des Sonetts „Römische Fontäne“ als ein Beispiel dieser Gattung.
1. Äußerer Aufbau und inhaltliche Gliederung: Dieser Abschnitt zerlegt den äußeren Aufbau des Sonetts „Römische Fontäne“. Es wird der Titel analysiert, wobei sowohl die Bedeutung von „Römische“ als Hinweis auf den Ort als auch „Fontäne“ als Beschreibung des Themas untersucht werden. Die Strophenanordnung als Sonett mit zwei Quartetten und zwei Terzetten wird erläutert, ebenso wie die Variationen in der Verslänge. Die inhaltliche Gliederung des Gedichts wird im Hinblick auf die Entwicklung der Thematik untersucht.
2. Syntax: Die Syntax des Rilke-Sonetts wird hier im Detail untersucht. Die Analyse konzentriert sich auf die Satzstruktur, sowohl in Bezug auf die Länge und Komplexität der Sätze als auch auf die Art und Weise, wie die Sätze miteinander verbunden sind. Darüber hinaus wird die Wortwahl analysiert. Die Untersuchung beleuchtet die Bedeutung der verwendeten Wörter, insbesondere im Hinblick auf ihre stilistische Funktion und ihre Wirkung auf den Leser. Die Analyse verbindet die Syntax mit dem Gesamtverständnis des Gedichts und seinen bildlichen und klanglichen Gestaltungselementen.
3. Bildliche und klangliche Gestaltung: Die Analyse fokussiert auf die bildliche und klangliche Gestaltung des Sonetts, wobei jede Strophe einzeln betrachtet wird. Hier werden die verwendeten Metaphern, Symbole und Bilder im Detail analysiert und ihre Bedeutung im Kontext des gesamten Gedichts interpretiert. Gleichzeitig wird auf die klanglichen Aspekte wie den Rhythmus und den Klang der Wörter eingegangen und deren Wirkung auf den Gesamteindruck untersucht. Die Analyse zeigt auf, wie Rilke durch Bildsprache und Klang die Stimmung und Atmosphäre des Gedichts erzeugt.
4. Deutungsversuche: Dieser Abschnitt präsentiert unterschiedliche Deutungsansätze des Sonetts. Die Analyse konzentriert sich auf die Bildhaftigkeit des Gedichts und versucht, die darin enthaltenen Symbole und Metaphern zu deuten. Die Dialektik im Gedicht, die sich etwa in der Gegenüberstellung von Bewegung und Stille oder Leben und Tod zeigen könnte, wird ebenfalls beleuchtet und die verschiedenen Interpretationsmöglichkeiten werden diskutiert. Der Abschnitt zeigt, wie vielschichtig und offen das Verständnis des Gedichts sein kann.
5. Römische Fontäne - Ein typisches Ding-Gedicht: Dieser Kapitelteil ordnet das Sonett „Römische Fontäne“ in den Kontext von Rilkes Dinggedichten ein. Es untersucht, inwiefern das Gedicht die Merkmale dieser Gattung aufweist und welche spezifischen Aspekte es in Bezug auf die Darstellung des „Dings“ und seine Bedeutung aufweist. Die Analyse stellt den Bezug zum Gesamtwerk Rilkes her und veranschaulicht, wie dieses spezifische Gedicht die Themen und Anliegen seiner Dinggedichte repräsentiert.
Schlüsselwörter
Rainer Maria Rilke, Römische Fontäne, Sonett, Dinggedicht, Lyrik, Jahrhundertwende, Bildsprache, Syntax, Deutung, Form, Inhalt, Symbol, Metapher.
Häufig gestellte Fragen zu Rilkes "Römische Fontäne"
Was ist der Inhalt der vorliegenden Arbeit?
Die Arbeit analysiert und interpretiert Rainer Maria Rilkes Sonett "Römische Fontäne". Sie untersucht detailliert den Aufbau, die sprachliche Gestaltung und die möglichen Deutungen des Gedichts und beleuchtet seine Stellung innerhalb von Rilkes Gesamtwerk, insbesondere im Kontext seiner Dinggedichte.
Welche Aspekte des Gedichts werden analysiert?
Die Analyse umfasst den äußeren Aufbau (Strophen, Reim, Metrum), die sprachlichen Mittel (Syntax, Wortwahl, Bildsprache), die Bildhaftigkeit und mögliche Deutungen, die Einordnung in Rilkes Werk und die Dingdichtung, sowie Bezugnahmen auf Rilkes Biographie und Einflüsse.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: 1. Ein kurzer Abriss über Leben und Werk Rilkes; 2. Äußerer Aufbau und inhaltliche Gliederung des Sonetts; 3. Syntax und Wortwahl; 4. Bildliche und klangliche Gestaltung; 5. Deutungsversuche und Einordnung als Dinggedicht. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt des Gedichts.
Was wird im Kapitel "Äußerer Aufbau und inhaltliche Gliederung" behandelt?
Dieses Kapitel analysiert den Titel, die Strophenanordnung (Sonettform), das Reimschema, das Metrum und die inhaltliche Gliederung des Gedichts, um den äußeren Rahmen und die strukturelle Entwicklung der Thematik zu verstehen.
Was ist der Schwerpunkt des Kapitels zur Syntax?
Hier wird die Satzstruktur, die Länge und Komplexität der Sätze, ihre Verknüpfung und die Wortwahl detailliert untersucht. Die Analyse beleuchtet die stilistische Funktion der verwendeten Wörter und deren Wirkung auf den Leser im Kontext des Gesamtgedichts.
Wie wird die Bildsprache und der Klang im Gedicht analysiert?
Das Kapitel zur Bildsprache und klanglichen Gestaltung analysiert jede Strophe einzeln. Es werden Metaphern, Symbole und Bilder im Detail interpretiert und die klanglichen Aspekte wie Rhythmus und Klangwirkung untersucht, um die von Rilke erzeugte Stimmung und Atmosphäre zu beleuchten.
Welche Deutungsansätze werden im Kapitel "Deutungsversuche" präsentiert?
Dieses Kapitel präsentiert verschiedene Interpretationen des Sonetts. Es konzentriert sich auf die Bildhaftigkeit, deutet Symbole und Metaphern und beleuchtet die Dialektik im Gedicht (z.B. Bewegung/Stille, Leben/Tod). Es zeigt die Vielschichtigkeit des Gedichts und die Offenheit für verschiedene Lesarten.
Wie wird das Gedicht im Kontext von Rilkes Dinggedichten eingeordnet?
Das letzte Kapitel ordnet "Römische Fontäne" in den Kontext von Rilkes Dinggedichten ein. Es untersucht, welche Merkmale des Dinggedichts im Sonett erkennbar sind und wie es die Themen und Anliegen dieser Gattung repräsentiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Rainer Maria Rilke, Römische Fontäne, Sonett, Dinggedicht, Lyrik, Jahrhundertwende, Bildsprache, Syntax, Deutung, Form, Inhalt, Symbol, Metapher.
Gibt es einen kurzen Abriss über Rilkes Leben und Werk?
Ja, das erste Kapitel bietet einen knappen Überblick über Rilkes Leben und Werk, hebt wichtige biographische Stationen und Einflüsse (Lou Andreas-Salomé, Auguste Rodin, Erster Weltkrieg) hervor und betont die Bedeutung der Dinggedichte in seinem Gesamtwerk.
- Quote paper
- Kathrin Brandl (Author), 2002, Analyse und Interpretation des Sonetts "Römische Fontäne" von Rainer Maria Rilke, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/24427