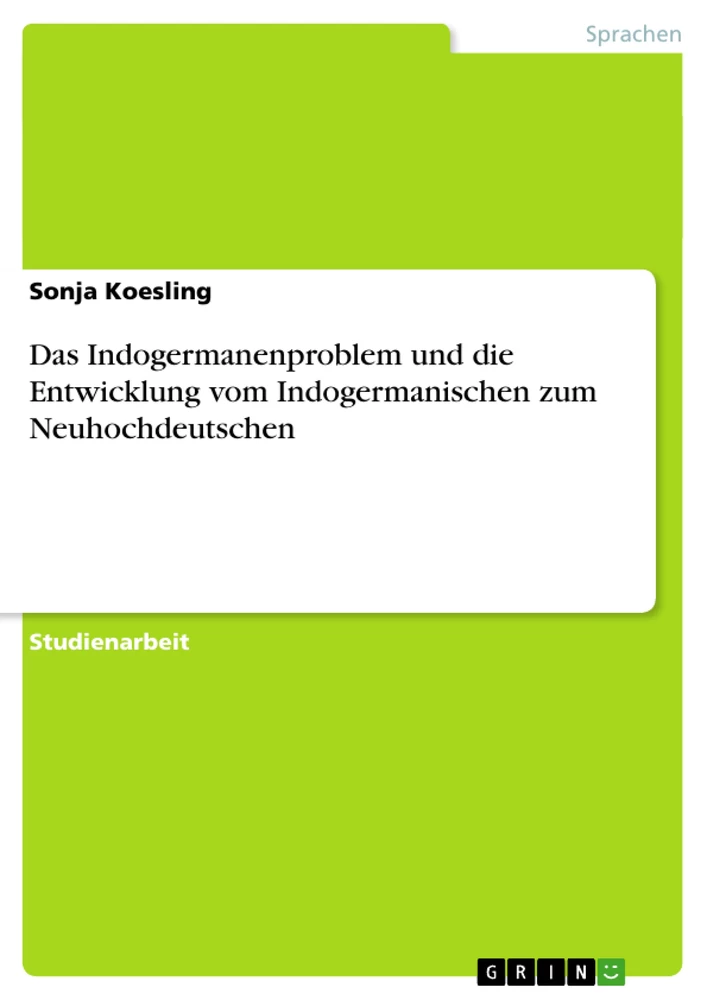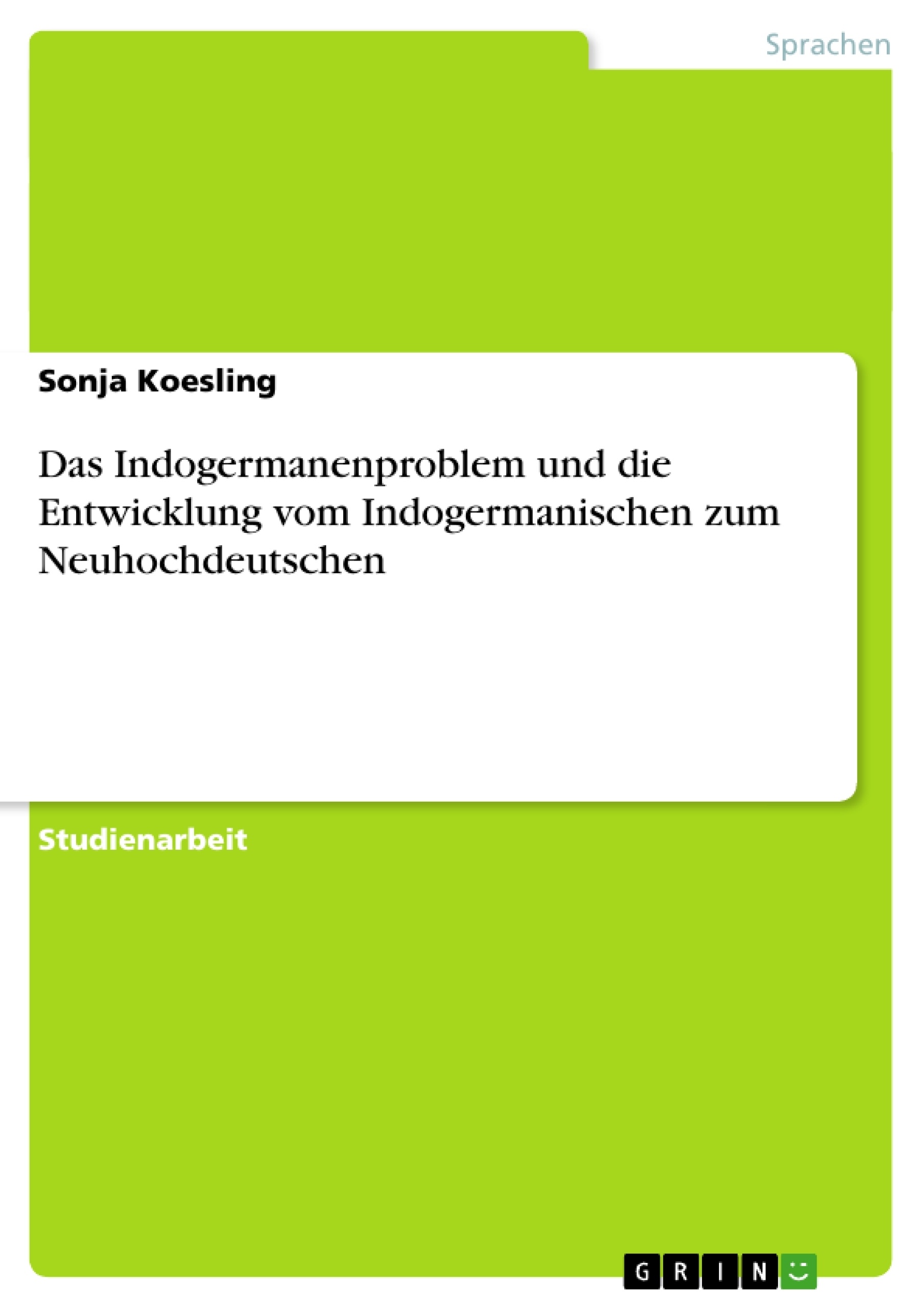Die Sprache der Indogermanen stellt eine eigene Wissenschaft dar. Sprachwissenschaftler
möchten durch sie die Entstehung der heutigen Sprachen klären. Eine sehr große
Gewichtung zur Lösung dieser Aufgabe erfährt die Frage nach der Urheimat. Doch die
Meinungen über sie gehen auseinander. Ursprünglich wollte ich in dieser Arbeit lediglich die
Entwicklung zum Neuhochdeutschen analysieren, stellte allerdings bei der Erarbeitung des
Themas fest, dass auch hier die Frage nach der indogermanischen Urheimat akzentuiert
werden muss. Zu diesem Zweck ist meine Arbeit in zwei Teile gegliedert. Im ersten Teil habe
ich die verschiedenen Thesen einander gegenübergestellt und versucht das Problem der
genauen Datierung darzulegen. Der zweite Teil beschreibt die Entwicklung vom
Indogermanischen zur neuhochdeutschen Sprache unter dem Aspekt der beiden
Lautverschiebungen. Diese Arbeit soll einen Gesamtüberblick über dieses doch komplexe
Thema geben. Aufgrund des vorgegebenen Umfangs ist es allerdings nicht möglich auf alle
Details einzugehen. Daher habe ich im zweiten Teil auf die Entwicklung des Vokalismus
verzichtet. Erst Ende des 16. Jahrhunderts, im Jahre 1597, entdeckte Bonaventura Vulcanus erstmals
einige Zusammengehörigkeiten verschiedener Sprachen indogermanischem Ursprungs.
Diese Entdeckung löste eine Welle von Untersuchungen aus. Ihm folgten G. W. Leibnitz,
Lorenzo Hervas, Coeurdoux (1767), William Jones (1786), Friedrich von Schlegel (1808) und
Franz Bopp (1816), welcher zum eigentlichen Begründer der indogermanischen
Sprachwissenschaft wurde.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- Erster Teil
- 2. Die Entdecker
- 3. Kentum- und Satemsprache
- 4. Die Ursprache
- 5. Das Indogermanenproblem
- 5.1. Die Frage nach der Urheimat
- 5.2. Die Forschung zur Frage des indogermanischen Ursprungs anhand der Linguistik
- 5.3. Die Westthese
- 5.4. Die Ostthese
- 5.5. Die Nordpontische These
- 5.6. Beziehungen zu Fremdsprachen
- 5.7. Eigennamenforschung und die alteuropäische Hydronymie
- 5.8. Die Zeit der Ursprache
- 5.9. Stellungnahme
- 6. Neue Forschungsergebnisse
- Zweiter Teil
- 7. Die Entwicklung der indogermanischen Sprache zum Neuhochdeutschen
- 8. Grundsätzliches zur Lautentwicklung
- 9. Der indogermanische Ablaut
- 10. Die Entwicklung des Konsonantismus
- 10.1. Vom Indogermanischen zum Germanischen
- 10.2. Vom Germanischen zum Westgermanischen
- 10.3. Vom Westgermanischen zum Althochdeutschen
- 10.4. Vom Althochdeutschen zum Mittelhochdeutschen
- 10.5. Vom Mittelhochdeutschen zum Neuhochdeutschen
- 11. Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung der indogermanischen Sprachen bis hin zum Neuhochdeutschen. Das zentrale Problem der indogermanischen Forschung, die Frage nach der Urheimat, wird beleuchtet und verschiedene Thesen dazu gegenübergestellt. Die Arbeit analysiert auch die Lautentwicklung, insbesondere den Konsonantismus, in den verschiedenen Phasen dieser Entwicklung.
- Die Frage nach der indogermanischen Urheimat
- Die Entwicklung des indogermanischen Konsonantismus
- Die verschiedenen Theorien zur Herkunft der indogermanischen Sprachen
- Die Unterscheidung zwischen Kentum- und Satemsprachen
- Die Entwicklung vom Indogermanischen zum Neuhochdeutschen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt das übergeordnete Ziel der Arbeit: die Erforschung der Entwicklung vom Indogermanischen zum Neuhochdeutschen. Die Autorin hebt die Komplexität des Themas hervor und begründet die Zweiteilung der Arbeit, die sich einerseits mit den verschiedenen Thesen zur Urheimat und andererseits mit der Lautentwicklung befasst. Aufgrund des Umfangs verzichtet die Autorin auf eine detaillierte Analyse des Vokalismus im zweiten Teil.
2. Die Entdecker: Dieses Kapitel beschreibt die Geschichte der Indogermanistik und benennt die wichtigsten Wissenschaftler, die zur Entdeckung der Verwandtschaft indogermanischer Sprachen beigetragen haben, beginnend mit Bonaventura Vulcanus (1597) und endend mit Franz Bopp (1816), der als Begründer der Indogermanistik gilt. Es unterstreicht die progressive Entwicklung der Forschung im Laufe der Zeit.
3. Kentum- und Satemsprache: Dieses Kapitel klassifiziert die indogermanischen Sprachen anhand der Entwicklung des palatalen K-Lautes in zwei Gruppen: Kentum- und Satemsprachen. Es beschreibt die phonetischen Unterschiede, zählt die Sprachen der jeweiligen Gruppen auf und veranschaulicht ihre geographische Verbreitung. Das Kapitel hebt die Bedeutung dieser Klassifizierung für das Verständnis der indogermanischen Sprachentwicklung hervor.
5. Das Indogermanenproblem: Dieses Kapitel befasst sich mit der Kernfrage der indogermanischen Forschung: der Lokalisierung der Urheimat. Es präsentiert verschiedene Thesen (West-, Ost-, und Nordpontische These), analysiert die linguistischen Methoden der Forschung und diskutiert die Herausforderungen der Datierung der Ursprache. Es integriert die Analyse von Eigennamen und Hydronymie als weitere Quellen der Forschung.
6. Neue Forschungsergebnisse: Dieses Kapitel (ohne detaillierten Inhalt im gegebenen Text) vermutlich präsentiert aktuelle Erkenntnisse und Fortschritte in der Indogermanistik, die sich auf die bereits diskutierten Thesen und Fragen beziehen. Es stellt einen direkten Bezug zu vorherigen Kapiteln her und ergänzt das Wissen.
7. Die Entwicklung der indogermanischen Sprache zum Neuhochdeutschen: Dieses Kapitel beginnt den zweiten Teil der Arbeit und legt den Fokus auf den Sprachwandel. Es wird vermutlich die verschiedenen Phasen dieser Entwicklung beschreiben und die damit verbundenen Veränderungen der Sprache detailliert darstellen.
8. Grundsätzliches zur Lautentwicklung: Dieses Kapitel (ohne detaillierten Inhalt im gegebenen Text) legt die Grundlagen für die detaillierte Analyse der Lautentwicklung in den folgenden Kapiteln. Es bietet wahrscheinlich einen theoretischen Rahmen und grundlegende Konzepte für das Verständnis der folgenden Kapitel.
9. Der indogermanische Ablaut: Dieses Kapitel (ohne detaillierten Inhalt im gegebenen Text) behandelt vermutlich die Entwicklung des Ablautsystems, eines wichtigen Merkmals der indogermanischen Sprachen, und dessen Veränderungen im Laufe der Entwicklung zum Neuhochdeutschen.
10. Die Entwicklung des Konsonantismus: Dieses Kapitel analysiert die Entwicklung des Konsonantismus, eingeteilt in die Phasen vom Indogermanischen zum Germanischen, vom Germanischen zum Westgermanischen, vom Westgermanischen zum Althochdeutschen, vom Althochdeutschen zum Mittelhochdeutschen und schliesslich vom Mittelhochdeutschen zum Neuhochdeutschen. Es beschreibt die jeweiligen Lautverschiebungen und deren Auswirkungen auf die Sprache.
Schlüsselwörter
Indogermanisch, Neuhochdeutsch, Urheimat, Kentumsprachen, Satemsprachen, Lautentwicklung, Konsonantismus, Sprachgeschichte, Sprachwissenschaft, Linguistik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Indogermanische Sprachentwicklung bis zum Neuhochdeutschen
Was ist der Hauptfokus dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht umfassend die Entwicklung der indogermanischen Sprachen bis hin zum Neuhochdeutschen. Sie konzentriert sich dabei auf zwei zentrale Aspekte: die Frage nach der indogermanischen Urheimat und die detaillierte Analyse der Lautentwicklung, insbesondere des Konsonantismus.
Welche Themen werden im ersten Teil der Arbeit behandelt?
Der erste Teil befasst sich mit der Geschichte der Indogermanistik, der Klassifizierung der indogermanischen Sprachen in Kentum- und Satemsprachen, der Frage nach der indogermanischen Ursprache und vor allem mit verschiedenen Thesen zur Lokalisierung der Urheimat (West-, Ost- und Nordpontische These). Dabei werden linguistische Forschungsmethoden, Eigennamenforschung und Hydronymie berücksichtigt.
Welche Thesen zur indogermanischen Urheimat werden diskutiert?
Die Arbeit stellt verschiedene Thesen zur Urheimat der indogermanischen Sprachen gegenüber: die Westthese, die Ostthese und die Nordpontische These. Diese werden anhand linguistischer Methoden und zusätzlicher Quellen wie Eigennamen und Hydronymie analysiert und bewertet.
Wie ist der zweite Teil der Arbeit aufgebaut?
Der zweite Teil konzentriert sich auf die Entwicklung der indogermanischen Sprache zum Neuhochdeutschen. Er behandelt grundlegende Aspekte der Lautentwicklung, den indogermanischen Ablaut und detailliert die Entwicklung des Konsonantismus in verschiedenen Phasen: vom Indogermanischen zum Germanischen, vom Germanischen zum Westgermanischen, vom Westgermanischen zum Althochdeutschen, vom Althochdeutschen zum Mittelhochdeutschen und schließlich vom Mittelhochdeutschen zum Neuhochdeutschen.
Welche Aspekte der Lautentwicklung werden besonders behandelt?
Die Arbeit analysiert detailliert die Entwicklung des Konsonantismus in den verschiedenen Phasen der Sprachentwicklung vom Indogermanischen zum Neuhochdeutschen. Der indogermanische Ablaut wird ebenfalls behandelt, während eine detaillierte Analyse des Vokalismus aufgrund des Umfangs der Arbeit ausgelassen wird.
Welche Kapitel gibt es und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit ist in Kapitel gegliedert, die von der Einleitung über die Entdecker der indogermanischen Sprachverwandtschaft, die Unterscheidung von Kentum- und Satemsprachen und die Problematik der Urheimat bis hin zur Entwicklung des Konsonantismus und einem Schlusswort reichen. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt der indogermanischen Sprachentwicklung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Indogermanisch, Neuhochdeutsch, Urheimat, Kentumsprachen, Satemsprachen, Lautentwicklung, Konsonantismus, Sprachgeschichte, Sprachwissenschaft, Linguistik.
Welche Bedeutung hat die Unterscheidung zwischen Kentum- und Satemsprachen?
Die Unterscheidung zwischen Kentum- und Satemsprachen basiert auf der Entwicklung des palatalen K-Lautes und ist eine wichtige Klassifizierung für das Verständnis der indogermanischen Sprachentwicklung und deren geographische Verbreitung.
Welche Quellen werden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit nutzt linguistische Methoden und bezieht neben der Analyse von Sprachdaten auch Quellen wie Eigennamenforschung und Hydronymie zur Untersuchung der indogermanischen Urheimat mit ein.
Gibt es neue Forschungsergebnisse, die in der Arbeit präsentiert werden?
Die Arbeit enthält ein Kapitel zu neuen Forschungsergebnissen in der Indogermanistik, welches vermutlich aktuelle Erkenntnisse zu den bereits diskutierten Thesen und Fragen präsentiert und den Bezug zu vorherigen Kapiteln herstellt.
- Quote paper
- M.A. Sonja Koesling (Author), 2002, Das Indogermanenproblem und die Entwicklung vom Indogermanischen zum Neuhochdeutschen, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/24240