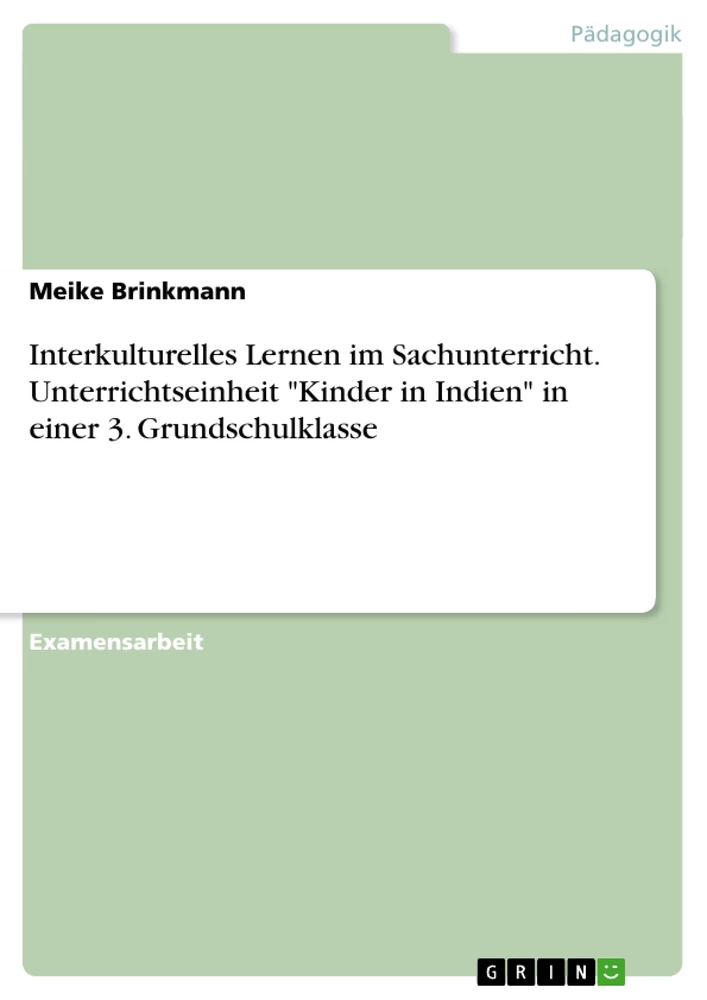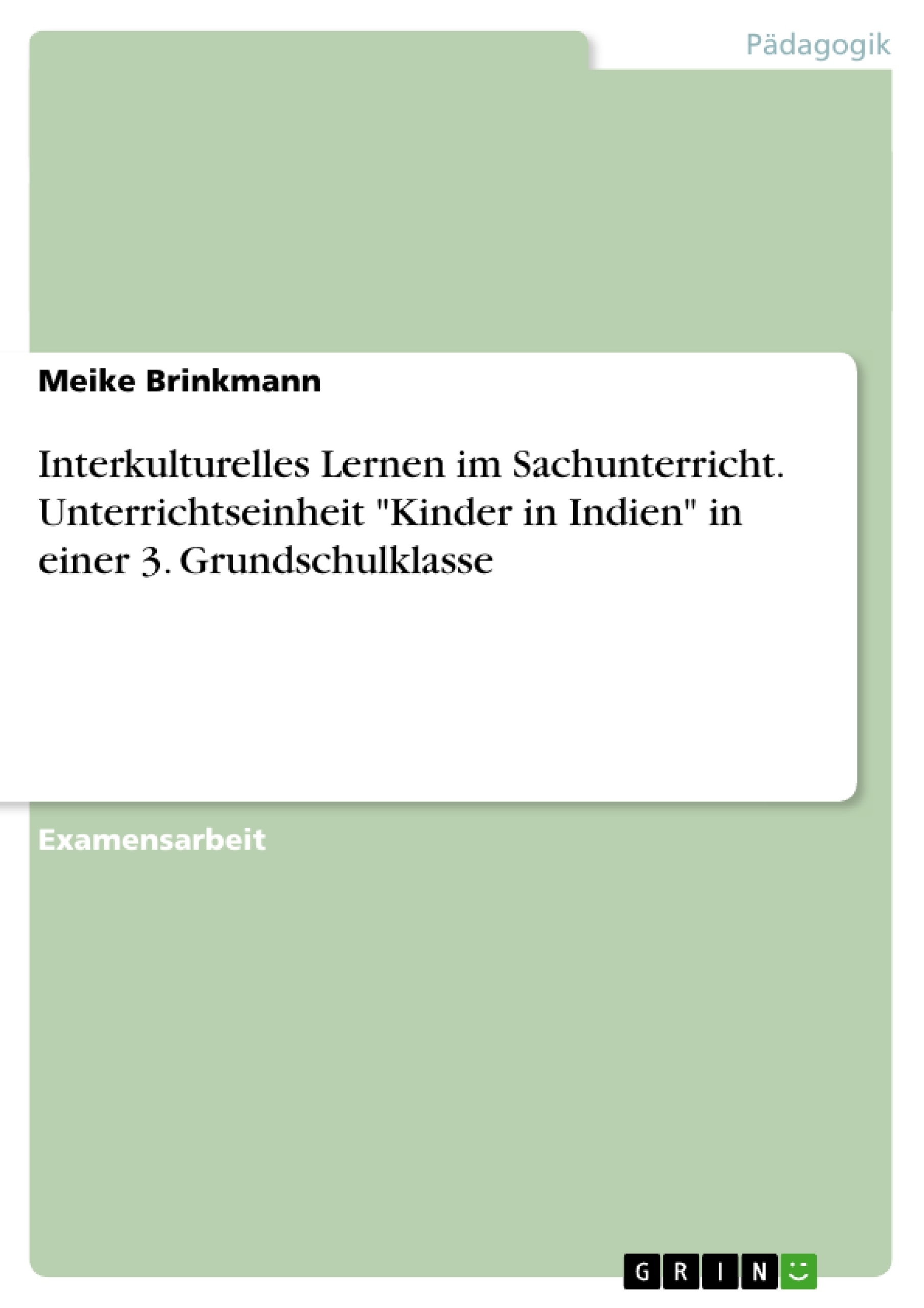Ein längerer Aufenthalt in Spanien eröffnete mir die Möglichkeit verschiedene Aspekte der Kultur Spaniens kennenzulernen. Ich erkannte Unterschiede sowie Gemeinsamkeiten und wurde mir meiner eigenen Sozialisation und der damit zusammenhängenden Abhängigkeit von den Lebensumständen zunehmend bewusst. Insbesondere diese Erfahrungen erweckten bei mir ein Interesse an anderen Kulturen.
Kindern in der Schule möchte ich ermöglichen eine andere Kultur kennenzulernen, unter anderem, weil sie täglich mit Menschen anderer Nationalitäten konfrontiert werden. Ich entschied mich deshalb für eine interkulturelle Thematik, auch wenn eine direkte Begegnung der Schülerinnen und Schüler mit der Kultur im Rahmen der Unterrichtseinheit nicht möglich ist. Die spanische Kultur wähle ich nicht als Lerninhalt, weil die Kultur zwar Unterschiede zur deutschen Kultur zeigt, diese aber nicht sehr offenkundig sind. Eine fremdartigere Kultur ist für interkulturelles Lernen meines Erachtens besser geeignet, wenn Verständnis, Akzeptanz und Toleranz für eine fremde Kultur sowie andere Zielsetzungen des interkulturellen Lernens, die ich erst später aufführe, angebahnt werden sollen. Ich werde mich in der Arbeit auf interkulturelles Lernen in der Grundschule beschränken. Dieses erscheint sinnvoll, denn aufbauend auf den theoretischen Hintergründen, die sich in Kapitel 2 befinden, werde ich eine in der Grundschule durchgeführte Unterrichtseinheit und entsprechende Vorüberlegungen dazu im 3. und 4. Kapitel darstellen.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- INTERKULTURELLES LERNEN IM SACHUNTERRICHT
- Begriffsbestimmung unter historischer Perspektive
- Lernvoraussetzungen bezüglich der Thematik
- Didaktische Überlegungen zum interkulturellen Lernen
- Begründung des interkulturellen Lernens in der Grundschule
- Stellung der Thematik innerhalb des Bildungsauftrags
- Aufgaben und Ziele interkulturellen Lernens
- Möglichkeiten und Grenzen bei der Umsetzung interkulturellen Lernens im Unterricht
- Konsequenzen für die Unterrichtseinheit
- VORÜBERLEGUNGEN ZUR UNTERRICHTSEINHEIT
- Außerschulische und schulische Rahmenbedingungen
- Zur Lernausgangslage der Klasse
- Zur Situation der Lerngruppe sowie allgemeine Lernvoraussetzungen
- Fach- und inhaltsspezifische Lernvoraussetzungen
- Sachanalyse
- Didaktische Strukturierung
- Didaktische Begründungen
- Zielsetzungen der Unterrichtseinheit
- Methodische Entscheidungen
- DARSTELLUNG DER UNTERRICHTSEINHEIT
- Aufbau der Einheit
- Übersicht und Reflexionen der einzelnen Sequenzen der Unterrichtseinheit
- Erste Unterrichtssequenz: Einführung in das Thema - Wir fliegen nach Indien und lernen Gita und ihre Familie kennen (2 Stunden)
- Zweite Unterrichtssequenz: Kleidung in Indien - Wir lernen uns indisch zu kleiden (1 Stunde)
- Dritte Unterrichtssequenz: Wohnen in Indien - Wir stellen indische Hütten her (1 Stunde)
- Vierte Unterrichtssequenz: Essen in Indien - Wir lernen indische Gewürze kennen und essen wie in Indien (2 Stunden)
- Fünfte Unterrichtssequenz: Kinderleben in Indien - Wir lernen, spielen und arbeiten wie Kinder in Indien (5 Stunden)
- Sechste Unterrichtssequenz: Besuch von einer Indienexpertin (1 Stunde)
- Siebte Unterrichtssequenz: Feste und Feiern in Indien - Wir malen Ornamente, bemalen unsere Hände und lernen ein indisches Lied, zu dem wir uns Bewegungen ausdenken (3 Stunden)
- Achte Unterrichtssequenz: Vorbereitung und Präsentation der Ergebnisse - Wir bauen Stationen für unsere Parallelklasse auf (2 Stunden)
- Neunte Unterrichtssequenz: Abschluss - Wir verabschieden uns von Gita und fliegen zurück nach Deutschland (1 Stunde)
- GESAMTREFLEXION
- Bemerkungen zum Verlauf der Unterrichtseinheit
- Auswertung der Unterrichtsergebnisse unter Berücksichtigung der Leitfragen
- Didaktisch - methodische Konsequenzen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit zielt darauf ab, das interkulturelle Lernen im Sachunterricht an der Beispiel einer Unterrichtseinheit zur indischen Kultur in der dritten Grundschulklasse zu beleuchten. Die Arbeit untersucht die Bedeutung von interkulturellem Lernen in der Grundschule, die didaktische Strukturierung einer entsprechenden Einheit und die methodischen Entscheidungen, die für die Umsetzung des Themas und das Erreichen der sozialen Ziele getroffen werden.
- Interkulturelles Lernen in der Grundschule
- Didaktische Strukturierung einer Unterrichtseinheit
- Methodische Entscheidungen für die Umsetzung des Themas
- Bedeutung von interkulturellem Lernen für die Entwicklung von Einstellungen und Verhaltensweisen gegenüber anderen Kulturen
- Angemessenheit der Themenauswahl und der didaktischen Reduktion für die Lernvoraussetzungen der Kinder
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den Hintergrund der Hausarbeit sowie die Leitfragen erläutert. Das zweite Kapitel beleuchtet den Begriff des interkulturellen Lernens unter historischer Perspektive und untersucht die Lernvoraussetzungen und didaktischen Überlegungen zu diesem Thema. Die Möglichkeiten und Grenzen bei der Umsetzung interkulturellen Lernens im Unterricht werden ebenfalls erörtert. Kapitel drei befasst sich mit den Vorüberlegungen zur Unterrichtseinheit, einschließlich der außerschulischen und schulischen Rahmenbedingungen, der Lernausgangslage der Klasse, der Sachanalyse und der didaktischen Strukturierung. Kapitel vier stellt die Unterrichtseinheit „Kinder in Indien“ detailliert dar, indem es die einzelnen Sequenzen der Einheit mit ihren jeweiligen Inhalten, Methoden und Zielen beschreibt. Abschließend werden in Kapitel fünf die Ergebnisse der Unterrichtseinheit reflektiert und die didaktisch-methodischen Konsequenzen für zukünftige interkulturelle Lernprozesse gezogen.
Schlüsselwörter
Interkulturelles Lernen, Sachunterricht, Grundschule, Unterrichtseinheit, Indien, Kinderkultur, Kulturvergleich, interkulturelle Kompetenz, Didaktik, Methoden, Lernvoraussetzungen, Unterrichtseinheiten, Reflexion, didaktisch-methodische Konsequenzen
- Quote paper
- Meike Brinkmann (Author), 2003, Interkulturelles Lernen im Sachunterricht. Unterrichtseinheit "Kinder in Indien" in einer 3. Grundschulklasse, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/23863