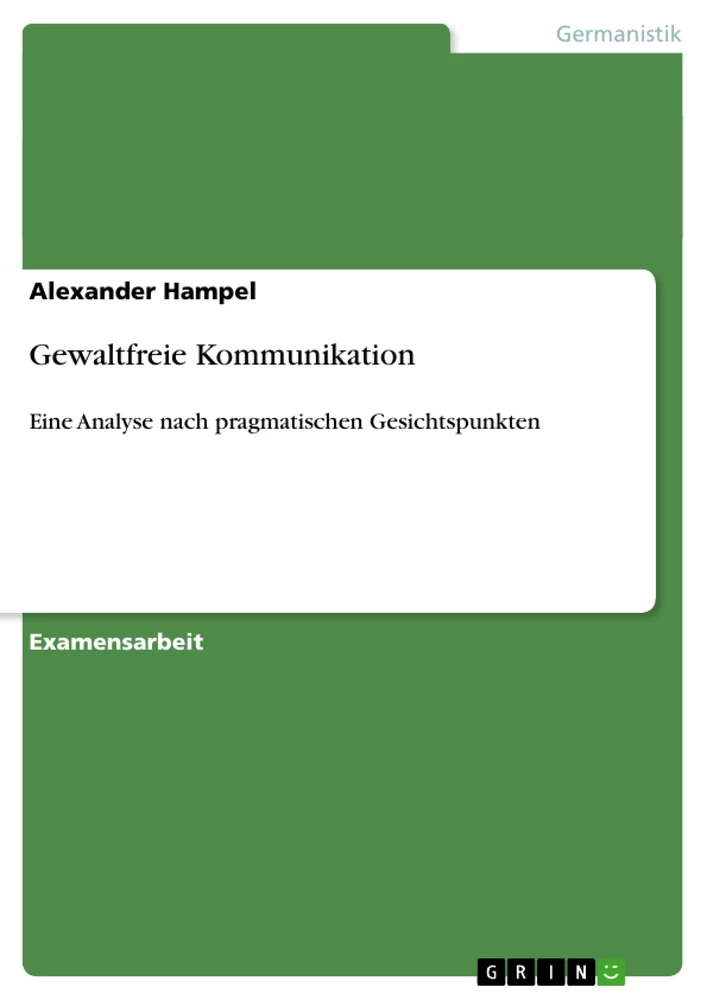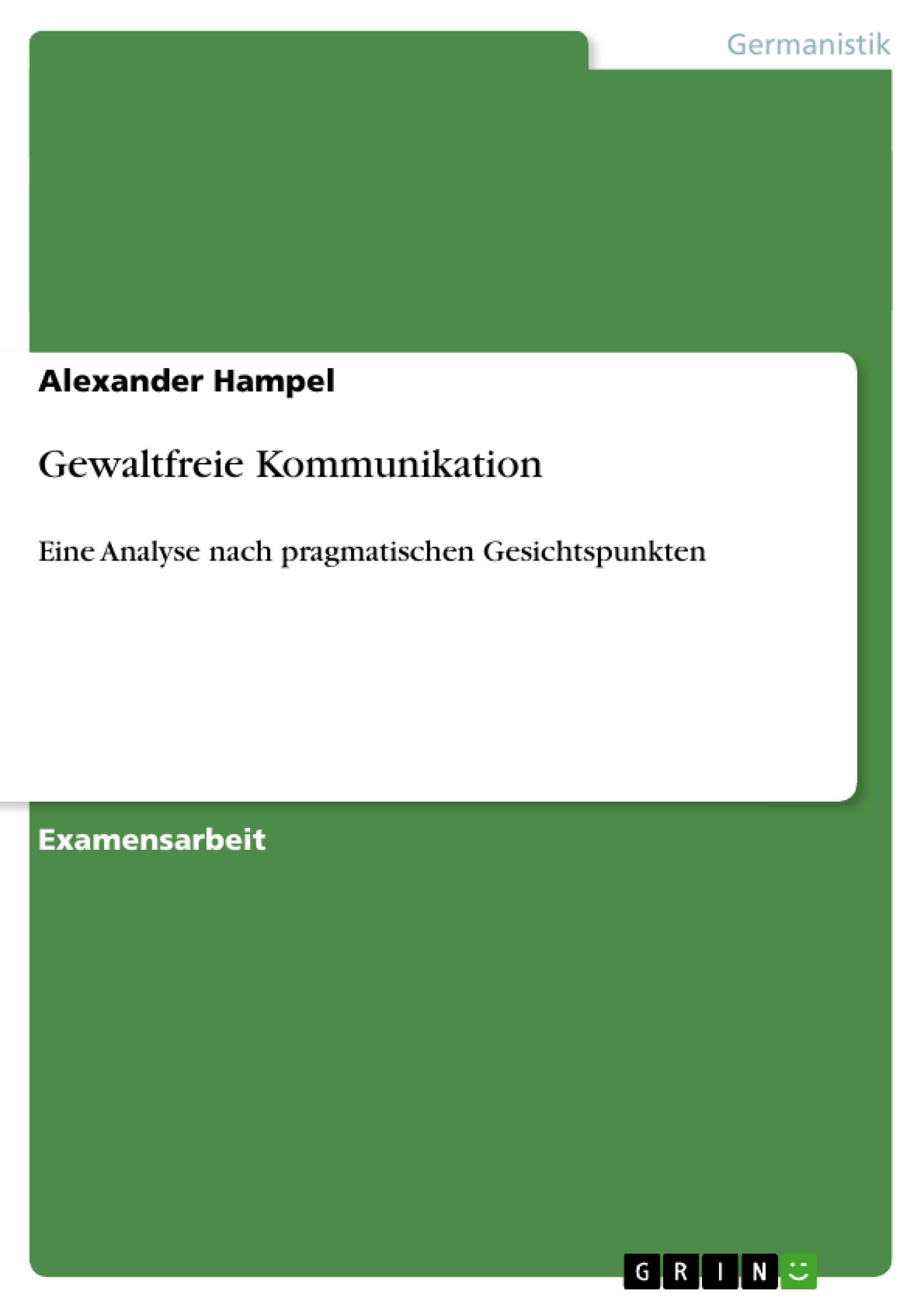Die Gewaltfreie Kommunikation (GFK), entwickelt von Marshall B. Rosenberg, soll Möglichkeiten bieten, den Erfolg in (schwierigen) kommunikativen Situationen zu verbessern und zwar hinsichtlich des Umgangs miteinander, bei der Aufrechterhaltung eines positiven sozialen Umfeldes. Rosenberg nutzt dazu Sprache. Er hat sich im Laufe von mittlerweile über 40 Jahren mit diesem Thema beschäftigt, sein Konzept in dieser Zeit mehrfach erprobt und immer wieder verbessert. In seinem Buch „Gewaltfreie Kommunikation – Eine Sprache des Lebens“ nutzt er verschiedene sprachliche Formen, die seiner Meinung nach, zu einer allgemeinen Verbesserung des Umfeldes eines Menschen führen sollen. Ich habe mich, im Rahmen dieser Examensarbeit, dazu entschieden, mich auf die Analyse der sprachlichen Aspekte zu konzentrieren, die Rosenberg als Mittel für die GFK sieht, und diese hinsichtlich ihrer möglichen Wirkung eines gewaltfreien kommunikativen Umgangs hin zu hinterfragen.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- 1. Vorstellung der Thematik
- 2. Vorgehensweise
- 3. Forschungsstand
- 4. Begrifflichkeiten
- II. Gewaltfreie Kommunikation nach Marschall B. Rosenberg
- 1. Zum Aufbau des Buches „Gewaltfreie Kommunikation – Eine Sprache des Lebens“
- 2. Marshall B. Rosenberg
- 3. Der Begriff „gewaltfrei“ bei Rosenberg
- 4. Die vier Komponenten der GFK
- 4.1 Beobachtung
- 4.2 Gefühle
- 4.3 Bedürfnisse
- 4.4 Bitten
- 5. Empathie
- 6. Zusammenfassung
- III. Theoretischer Teil
- 1. Erving Goffman - interaction Order
- 2. Pragmatik
- 2.1 H. Paul Grice Theorie der Implikaturen
- 2.2 John L. Austin/John Searle - Sprechakttheorie
- 3. Zusammenfassung
- IV. Analyse
- 1. Beobachtung
- 1.1 Syntax
- 1.2 Sprechakttheorie
- 1.3 Theorie der Implikaturen
- 1.4 Face-work
- 1.5 Fazit
- 2. Gefühle
- 2.1 Syntax
- 2.2 Sprechakttheorie
- 2.3 Theorie der Implikaturen
- 2.4 Fazit
- 3. Bedürfnisse
- 3.1 Syntax
- 3.2 Sprechakttheorie
- 3.3 Theorie der Implikaturen
- 3.4 Fazit
- 4. Bitten
- Sprechakttheorie
- 5. Zusammenfassung/Fazit
- 1. Beobachtung
- V. Praktisches Beispiel
- 1. Einleitung/Ziel
- 1.1 Kontext
- 1.2 Vorgehen
- 2. Analyse
- 2.1 Teil I
- 2.2 Teil II
- 3. Fazit
- 1. Einleitung/Ziel
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Gewaltfreie Kommunikation (GFK) nach Marshall B. Rosenberg unter pragmatischen Gesichtspunkten. Ziel ist es, die sprachlichen Mittel der GFK zu untersuchen und deren Potential für gewaltfreien kommunikativen Umgang zu hinterfragen. Die Analyse stützt sich auf die Sprechakttheorie, die Theorie der Implikaturen und Goffmans Face-work.
- Analyse der sprachlichen Mittel der GFK nach Rosenberg
- Anwendung pragmatischer Theorien (Sprechakttheorie, Implikaturen, Face-work) auf die GFK
- Untersuchung des Begriffs „gewaltfrei“ im Kontext der GFK
- Bewertung des Potentials der GFK für gewaltfreien kommunikativen Umgang
- Praktische Anwendung und Analyse eines Beispiels
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung stellt die Thematik der Gewaltfreien Kommunikation (GFK) nach Marshall B. Rosenberg vor und skizziert den Forschungsansatz der Arbeit. Es wird die sprachliche Ebene der GFK untersucht, um deren Wirkung auf einen gewaltfreien kommunikativen Umgang zu analysieren. Die Arbeit konzentriert sich auf die theoretischen Aspekte und verwendet die Sprechakttheorie, die Theorie der Implikaturen und Goffmans Face-work zur Analyse der von Rosenberg vorgeschlagenen sprachlichen Mittel. Praktische Anwendungsmöglichkeiten werden nur am Rande betrachtet.
II. Gewaltfreie Kommunikation nach Marschall B. Rosenberg: Dieses Kapitel beschreibt den Aufbau und die Theorie der GFK nach Rosenberg. Es wird der Begriff „gewaltfrei“ im Kontext der GFK beleuchtet und die vier Komponenten der GFK (Beobachtung, Gefühle, Bedürfnisse, Bitten) detailliert erklärt. Die Bedeutung von Empathie im GFK-Konzept wird ebenfalls behandelt.
III. Theoretischer Teil: Dieser Teil legt die theoretischen Grundlagen der Arbeit dar. Er beschreibt die relevanten pragmatischen Theorien: Erving Goffmans Konzept der "interaction order", die Sprechakttheorie von Austin und Searle sowie die Theorie der Implikaturen von Grice. Diese Theorien bilden den analytischen Rahmen für die Untersuchung der GFK im folgenden Kapitel.
IV. Analyse: Hier wird die GFK anhand der im vorherigen Kapitel vorgestellten pragmatischen Theorien analysiert. Jede der vier Komponenten der GFK (Beobachtung, Gefühle, Bedürfnisse, Bitten) wird einzeln untersucht, wobei die Syntax, die Sprechakttheorie, die Theorie der Implikaturen und der Aspekt des "Face-work" berücksichtigt werden. Die Analyse zielt darauf ab, das Potential der jeweiligen sprachlichen Mittel für eine gewaltfreie Kommunikation zu beurteilen.
V. Praktisches Beispiel: In diesem Kapitel wird ein praktisches Beispiel aus dem schulischen Kontext vorgestellt und analysiert. Die Analyse basiert auf den im vorherigen Kapitel gewonnenen Erkenntnissen. Es wird gezeigt, wie die Prinzipien der GFK in einer konkreten Situation angewendet werden können.
Schlüsselwörter
Gewaltfreie Kommunikation (GFK), Marshall B. Rosenberg, Pragmatik, Sprechakttheorie, Theorie der Implikaturen, Erving Goffman, Face-work, gewaltfreier kommunikativer Umgang, sprachliche Analyse.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Analyse der Gewaltfreien Kommunikation nach Marshall B. Rosenberg
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Gewaltfreie Kommunikation (GFK) nach Marshall B. Rosenberg unter pragmatischen Gesichtspunkten. Das Ziel ist die Untersuchung der sprachlichen Mittel der GFK und die Hinterfragung ihres Potenzials für einen gewaltfreien kommunikativen Umgang.
Welche Theorien werden zur Analyse verwendet?
Die Analyse stützt sich auf die Sprechakttheorie, die Theorie der Implikaturen und Goffmans Face-work. Diese pragmatischen Theorien bilden den analytischen Rahmen für die Untersuchung der GFK.
Welche Aspekte der GFK werden untersucht?
Die Arbeit untersucht die vier Komponenten der GFK: Beobachtung, Gefühle, Bedürfnisse und Bitten. Dabei wird die Syntax, die Sprechakttheorie, die Theorie der Implikaturen und der Aspekt des "Face-work" berücksichtigt. Die Bedeutung von Empathie im GFK-Konzept wird ebenfalls behandelt.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Gewaltfreie Kommunikation nach Marshall B. Rosenberg, Theoretischer Teil, Analyse und Praktisches Beispiel. Die Einleitung stellt die Thematik vor und skizziert den Forschungsansatz. Kapitel zwei beschreibt die Theorie der GFK. Kapitel drei erläutert die relevanten pragmatischen Theorien. Kapitel vier analysiert die GFK anhand dieser Theorien. Kapitel fünf präsentiert und analysiert ein praktisches Beispiel aus dem schulischen Kontext.
Welche konkreten Forschungsfragen werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit folgenden Fragen: Analyse der sprachlichen Mittel der GFK nach Rosenberg; Anwendung pragmatischer Theorien (Sprechakttheorie, Implikaturen, Face-work) auf die GFK; Untersuchung des Begriffs „gewaltfrei“ im Kontext der GFK; Bewertung des Potentials der GFK für gewaltfreien kommunikativen Umgang; und praktische Anwendung und Analyse eines Beispiels.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Schlüsselbegriffe sind: Gewaltfreie Kommunikation (GFK), Marshall B. Rosenberg, Pragmatik, Sprechakttheorie, Theorie der Implikaturen, Erving Goffman, Face-work, gewaltfreier kommunikativer Umgang und sprachliche Analyse.
Wo findet man ein detailliertes Inhaltsverzeichnis?
Ein detailliertes Inhaltsverzeichnis mit Unterkapiteln ist im HTML-Dokument enthalten und beschreibt den Aufbau der Arbeit im Detail.
Welche Zusammenfassung der Kapitel wird geboten?
Eine Zusammenfassung jedes Kapitels, welche die zentralen Inhalte und den jeweiligen Fokus beschreibt, ist ebenfalls im HTML-Dokument vorhanden.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist für Personen relevant, die sich für Gewaltfreie Kommunikation, Pragmatik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung interessieren. Sie bietet eine akademische Analyse der GFK und deren sprachlicher Mittel.
Wie ist der Begriff "gewaltfrei" in der Arbeit definiert?
Der Begriff "gewaltfrei" wird im Kontext der GFK nach Rosenberg definiert und im Laufe der Arbeit unter pragmatischen Gesichtspunkten analysiert und diskutiert.
- Arbeit zitieren
- Alexander Hampel (Autor:in), 2012, Gewaltfreie Kommunikation, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/233580