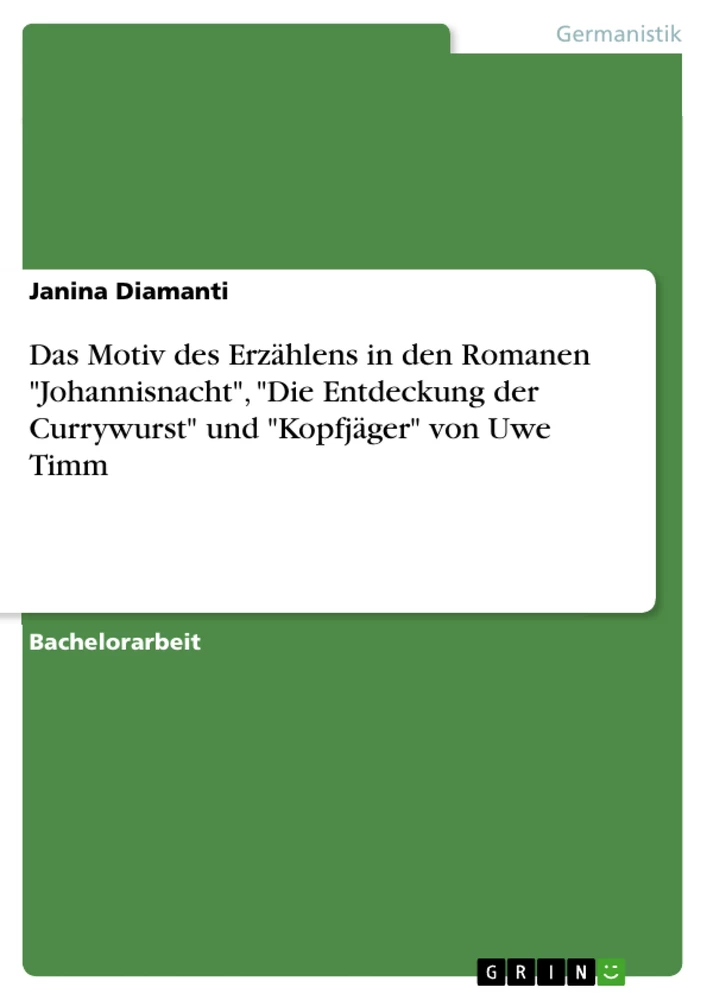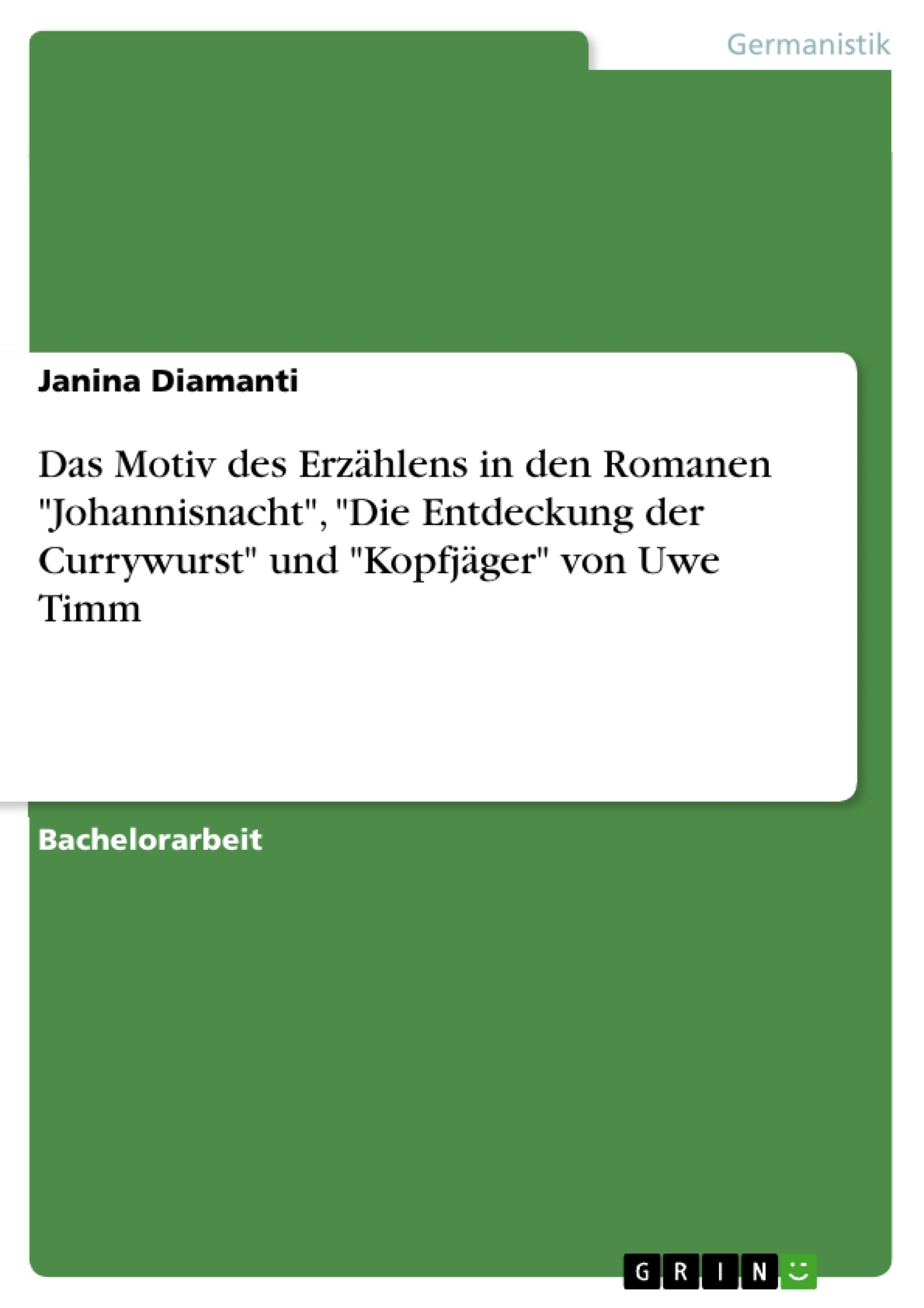Das Werk der Hamburger Schriftstellers Uwe Timm ist mit diversen Romane zu den unterschiedlichsten Themen, von Kinderbüchern über die Ost-West-Problematik und den 2. Weltkrieg hin zur 86-Bewegung, breit und vielfältig angelegt. Doch gibt es viele sich wiederholende Motive, von denen eines besonders hervorsticht: Das Motiv des Erzählens. In Uwe Timms Romanen spielt das Erzählen eine zentrale Rolle. So wird das Romanschreiben thematisiert, Figuren erzählen und lassen sich erzählen, es wird um Geld und Liebe erzählt. Immer wieder taucht eine Szene auf, die auch als „Urszene“ beschrieben wird: das Zusammensitzen in der Küche und Geschichtenerzählen (vgl. Steinecke 2005: 253)
Uwe Timm ist ein so genannter „Schriftsteller der mittleren Generation“, d.h. er gehört einer Gruppe von Schriftstellern an, die auf die Generation folgte, die direkte Zeitzeugen des 2. Weltkrieges waren und ihre Erfahrungen literarisch verarbeitet haben. Uwe Timm und seine Zeitgenossen folgten auf Schriftsteller, die Teil dieser prägenden Erlebnisse waren und hatten mit dem daraus resultierenden Vorwurf, nichts Neues schreiben zu können, zu kämpfen. Das historische Ereignis, das Uwe Timms Leben und seine Schriftstellergeneration prägte, war die Studentenbewegung und der damit verbundene Aufstand gegen die Vätergeneration, der gleichzeitig ein Aufstand gegen die Generation der Nachkriegsschriftsteller war (vgl. Durzak 1995). Timm ist somit mit seinem ersten Roman Heißer Sommer berühmt geworden, in dem es um die 68er-Bewegung geht und hat andere Werke zu diesem Thema verfasst. Die Thematik der Studentenbewegung macht einen Großteil der Diskussion um Uwe Timm aus. Doch hat er gleichzeitig mit seiner Poetik-Vorlesung, die er im Wintersemester 1991/92 an der Universität Paderborn gehalten hat und die in dem Buch Erzählen und kein Ende festgehalten ist, viel Raum für eine Diskussion und Forschung um sein Erzählmodell geboten. Viele der Erkenntnisse, die Uwe Timm in Erzählen und kein Ende gewinnt, sind auf seine Werke anzuwenden und lassen interessante Rückschlüsse zu. Dies soll in der vorliegenden Arbeit getan werden. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- l. Alltagserzählungen und literarisches Erzählen
- 1 _ 1 _ Abgrenzung von literarischem und alltäglichem Erzählen durch Timm
- 1 _2_ Literarisches und alltägliches Erzählen in Die Entdeckung der Currywurst
- 2. „Der wunderbare Konjunktiv"'
- 2.1 _ „Der "underbare Konjunktiv" — Uwe Timms Definition
- 2.2. Lüge und Wahrheit in Die Entdeckung der Currywurst
- 2.3 _ Möglichkeiten der Wahrheit in Kopfäger
- Der Erzähler
- Die Geschichten
- 3. Wirkung und Funktion des Erzählens in Johannisnacht und Kopjäger
- 3 _ 1 _ Johannisnacht
- 3 _ 2. Kopfäger
- 4. Selbstreferenz und Thematisierung des Erzählens
- 4.1. Johannisnacht
- 4 _ 2. Die Entdeckung der Currywurst
- F azit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende wissenschaftliche Hausarbeit befasst sich mit dem Motiv des Erzählens in drei Romanen von Uwe Timm: „Johannisnacht", „Die Entdeckung der Currywurst" und „Kopfjäger". Ziel ist es, die Bedeutung und Funktion des Erzählens in diesen Werken zu untersuchen und dabei insbesondere auf die Poetik des Autors einzugehen, wie sie in seiner Poetik-Vorlesung „Erzählen und kein Ende" dargelegt wird.
- Die Abgrenzung von literarischem und alltäglichem Erzählen nach Uwe Timm.
- Der „wunderbare Konjunktiv", ein von Uwe Timm geprägter Begriff, der die Funktion des Erzählens als Erschaffung möglicher Wirklichkeiten beschreibt.
- Die Macht des Erzählens in den Romanen: Wie wird Erzählen von den Figuren eingesetzt und verstanden? Welche Auswirkungen hat es?
- Die Selbstreferenz und Thematisierung des Erzählens in den Romanen: Wie wird der Erzählvorgang selbst thematisiert und reflektiert?
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und stellt die drei ausgewählten Romane von Uwe Timm vor. Sie erläutert die Relevanz des Motivs des Erzählens in Timms Werk und stellt die Forschungsfrage nach der Bedeutung und Funktion des Erzählens in diesen Romanen.
Kapitel 1 befasst sich mit der Abgrenzung von literarischem und alltäglichem Erzählen nach Uwe Timm. Es werden die grundlegenden Unterschiede zwischen beiden Formen des Erzählens herausgearbeitet, wobei der Fokus auf Timms Definition des „Ferments des Zusammenlebens" liegt. Anschließend wird das Konzept des alltäglichen und literarischen Erzählens anhand des Romans „Die Entdeckung der Currywurst" analysiert.
Kapitel 2 widmet sich dem „wunderbaren Konjunktiv", einem von Uwe Timm geprägten Begriff, der die Funktion des Erzählens als Erschaffung möglicher Wirklichkeiten beschreibt. Es wird erläutert, wie die erzählte Wahrheit in Timms Werken genauso wahr wirken kann wie die tatsächliche Wahrheit, und wie das Erzählen im Konjunktiv die Freiheit ermöglicht, andere Wirklichkeiten zu schaffen. Die Kapitel 2.2 und 2.3 veranschaulichen dieses Konzept anhand der Romane „Die Entdeckung der Currywurst" und „Kopfjäger".
Kapitel 3 untersucht die Macht des Erzählens in den Romanen „Johannisnacht" und „Kopfjäger". Es wird gezeigt, wie das Erzählen in diesen Werken als Mittel der Identitätssicherung, der erotischen Spannung und der Manipulation eingesetzt wird. Die Kapitel 3.1 und 3.2 beleuchten die unterschiedlichen Funktionen des Erzählens in den beiden Romanen.
Kapitel 4 befasst sich mit der Selbstreferenz und Thematisierung des Erzählens in den Romanen „Johannisnacht" und „Die Entdeckung der Currywurst". Es wird analysiert, wie die Erzähler in diesen Werken den Prozess des Erzählens selbst reflektieren und wie sie die Entstehung ihrer eigenen Geschichten thematisieren.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen das Motiv des Erzählens, die Poetik von Uwe Timm, die Abgrenzung von literarischem und alltäglichem Erzählen, den „wunderbaren Konjunktiv", die Macht des Erzählens und die Selbstreferenz in Timms Romanen. Die Analyse beleuchtet die Bedeutung des Erzählens für die Gestaltung von Identität, die Erschaffung möglicher Wirklichkeiten und die Manipulation von Menschen. Die Arbeit untersucht die drei Romane „Johannisnacht", „Die Entdeckung der Currywurst" und „Kopfjäger" und bezieht sich dabei auf Timms Poetik-Vorlesung „Erzählen und kein Ende".
- Quote paper
- Janina Diamanti (Author), 2008, Das Motiv des Erzählens in den Romanen "Johannisnacht", "Die Entdeckung der Currywurst" und "Kopfjäger" von Uwe Timm, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/232476