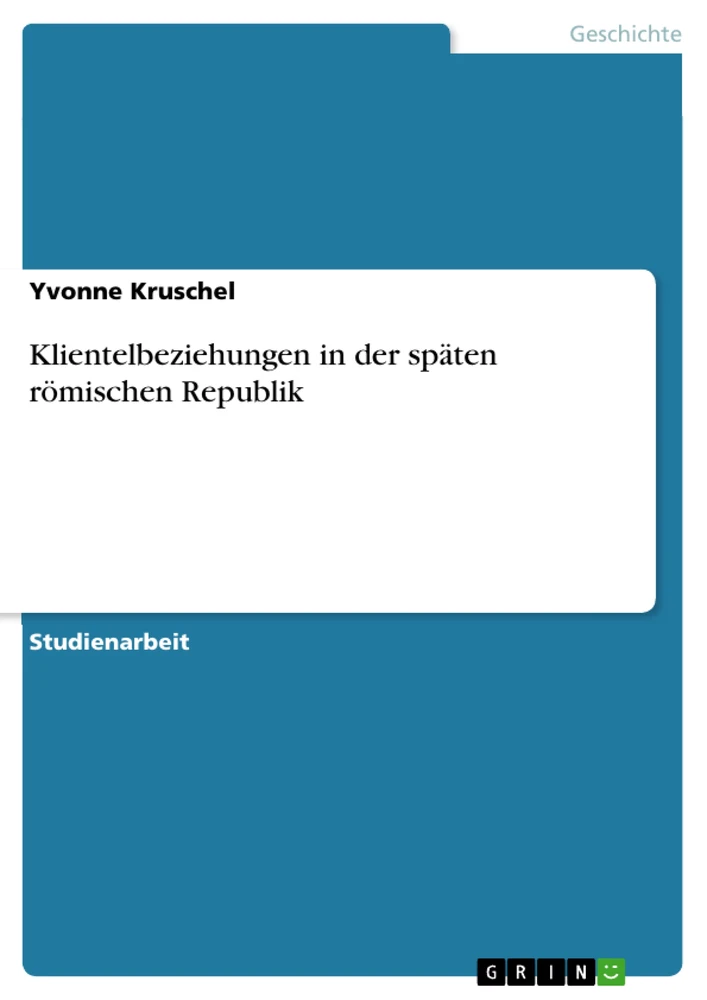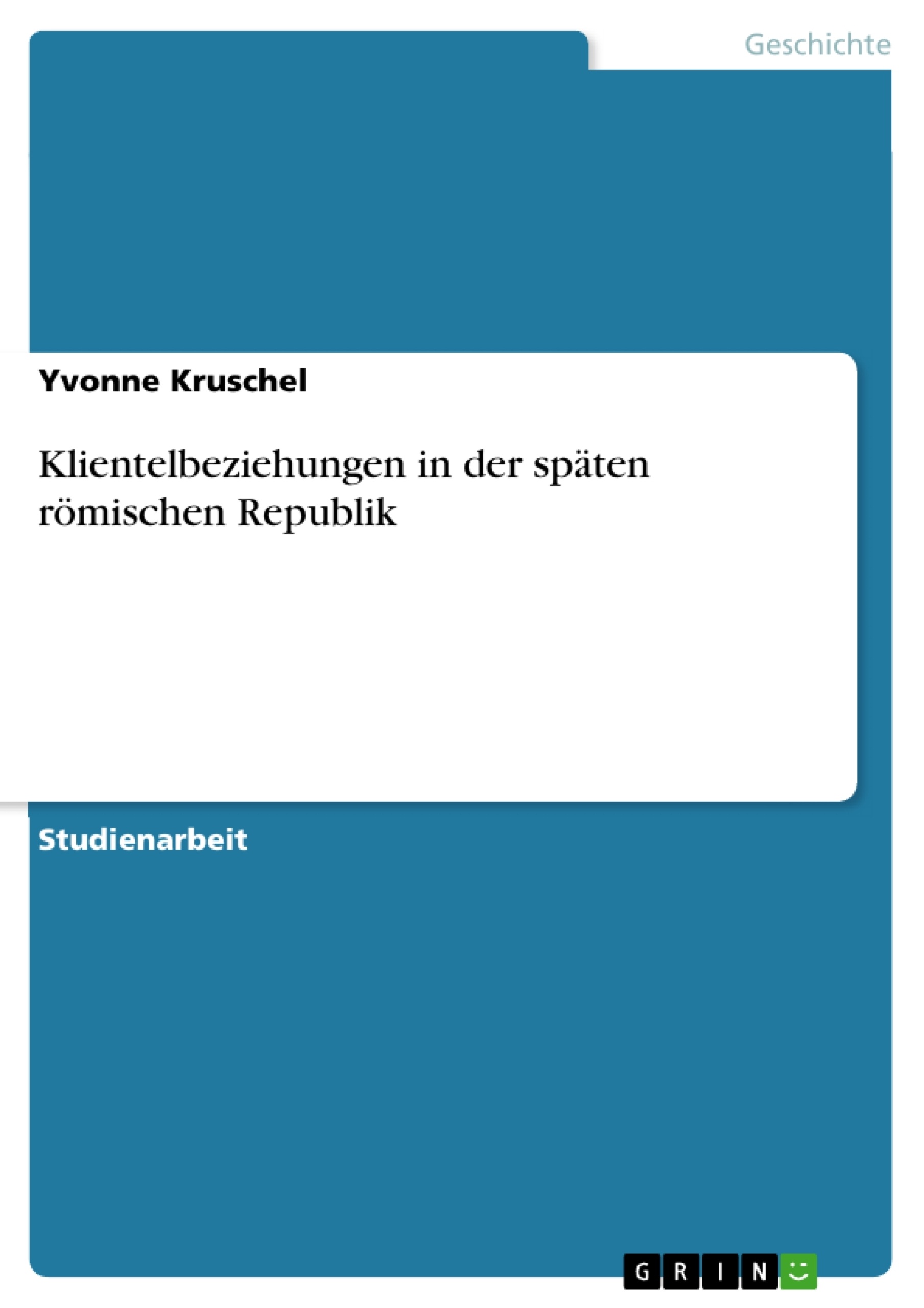Das römische Klientelwesen, das in der Fachliteratur als ein Schutz bietendes Nah- und Treueverhältnis zwischen dem Patron und seinem Klienten beschrieben wird , könnte ebenfalls ein auf Machtmissbrauch beruhendes Herrschaftsverhältnis gewesen sein. Das Klientelverhältnis (lat. clientela), entwickelte sich ursprünglich „auf der Grundlage einer moralisch-religiösen, nicht juristischen Treueverpflichtung (…) zu einer (gegenseitigen) Unterstützungsbeziehung mit einer klaren Rollenverteilung“. Dieses Verhältnis zwischen untergeordneten Personen mit geringer Macht, den Klienten, und den einflussreichen Patronen, durchzieht die gesamte römische Gesellschaft. Dieses hatte nicht nur großen Einfluss auf das allgemeine Gesellschaftsleben, sondern auch auf das politische Mitwirkungsrecht, da die meisten Klienten, in einer Klientelbeziehung, in der Regel ihren Patron bei Wahlen und öffentlichen Auftritten unterstützten. In dieser Arbeit soll untersucht werden, in wie weit das Klientelwesen in der späten römischen Republik eine der wesentlichen Voraussetzungen war, unter denen die staatliche Ordnung stand und funktionierte. So werden zu Beginn die Begriffe „Klient“ und „Patronus“ definiert, im Anschluss daran die politische Funktion der Klientelverhältnisse, sowie deren Einfluss auf das soziale Leben untersucht. Außerdem wird noch die Entwicklung des Klientelwesens, von den Ständekämpfen bis zum Ende der Republik beschrieben werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Hauptteil
- 2.1 Das römische Klientelwesen – Eine Begriffsdefinition
- 2.2 Die Entstehung des Klientelwesens in der römischen Republik
- 2.3 Einfluss des Klientelwesens auf das politische Mitwirkungsrecht sowie das allgemeine Gesellschaftsleben
- 2.4 Exkurs - Heeresklientel
- 3. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Einfluss des römischen Klientelwesens auf die staatliche Ordnung der späten römischen Republik. Es wird analysiert, inwieweit dieses System eine wesentliche Voraussetzung für das Funktionieren der Republik war. Die Untersuchung umfasst die Definition der Begriffe „Klient“ und „Patronus“, die politische Funktion der Klientelverhältnisse und deren Einfluss auf das soziale Leben sowie die Entwicklung des Systems von den Ständekämpfen bis zum Ende der Republik.
- Definition und Charakterisierung des römischen Klientelwesens
- Entstehung und Entwicklung des Klientelwesens in der römischen Republik
- Politische Funktion und Einfluss auf das gesellschaftliche Leben
- Vergleich des Klientelwesens mit der Freundschaft (amicitia)
- Die Rolle der Nobilität im Klientelsystem
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema des römischen Klientelwesens ein und stellt die Forschungsfrage nach dessen Bedeutung für die staatliche Ordnung der späten römischen Republik. Sie skizziert den Forschungsstand, bezeichnet die wichtigsten Forschungsansätze (Winterling, Bleicken, Gelzer) und benennt die zentralen Aspekte der Untersuchung, wie die Definition der beteiligten Rollen (Klient und Patron), die politische Funktion und der gesellschaftliche Einfluss des Klientelwesens.
2. Hauptteil: Der Hauptteil besteht aus verschiedenen Unterkapiteln die sich mit dem römischen Klientelwesen auseinandersetzen. Er beschreibt das Klientelwesen als eine gesellschaftliche Einrichtung, in der ein Klient und ein Patron in einem festen persönlichen Abhängigkeitsverhältnis zueinander stehen, und deren rechtliche und soziale Implikationen. Anschließend wird die Entstehung des Klientelwesens in der römischen Republik nachgezeichnet, beginnend mit der Unterscheidung zwischen Patriziern und Plebejern und der späteren Entwicklung der Nobilität. Der Einfluss auf das politische Leben wird beleuchtet, sowie die Veränderung des Systems im Laufe der Zeit und die Auswirkungen auf das gesellschaftliche Gefüge.
Schlüsselwörter
Römisches Klientelwesen, Patron, Klient, Republik, Nobilität, Ständekämpfe, amicitia, politische Macht, soziales Gefüge, Reziprozität, Fides.
Häufig gestellte Fragen zum römischen Klientelwesen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Einfluss des römischen Klientelwesens auf die staatliche Ordnung der späten römischen Republik. Sie analysiert, inwieweit dieses System eine wesentliche Voraussetzung für das Funktionieren der Republik war.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit umfasst die Definition der Begriffe „Klient“ und „Patronus“, die politische Funktion der Klientelverhältnisse, deren Einfluss auf das soziale Leben und die Entwicklung des Systems von den Ständekämpfen bis zum Ende der Republik. Weitere Schwerpunkte sind die Charakterisierung des Klientelwesens, seine Entstehung und Entwicklung, seine politische Funktion und sein gesellschaftlicher Einfluss, ein Vergleich mit der Freundschaft (amicitia) und die Rolle der Nobilität.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, einen Hauptteil und einen Schluss. Der Hauptteil ist in Unterkapitel unterteilt, die sich jeweils mit spezifischen Aspekten des römischen Klientelwesens befassen. Die Einleitung führt in das Thema ein, stellt die Forschungsfrage und skizziert den Forschungsstand. Der Hauptteil beschreibt das Klientelwesen, seine Entstehung, seinen Einfluss auf das politische und gesellschaftliche Leben und seine Entwicklung im Laufe der Zeit. Der Schluss fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Kapitel gibt es und worum geht es in ihnen?
Kapitel 1 (Einleitung): Einführung in das Thema, Forschungsfrage, Forschungsstand und zentrale Aspekte der Untersuchung (Definition von Klient und Patron, politische Funktion und gesellschaftlicher Einfluss des Klientelwesens).
Kapitel 2 (Hauptteil): Beschreibung des Klientelwesens als gesellschaftliche Einrichtung, Entstehung in der römischen Republik (beginnend mit der Unterscheidung zwischen Patriziern und Plebejern), Einfluss auf das politische Leben, Veränderung des Systems im Laufe der Zeit und Auswirkungen auf das gesellschaftliche Gefüge. Enthält einen Exkurs zum Heeresklientel.
Kapitel 3 (Schluss): Zusammenfassung der Ergebnisse.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Römisches Klientelwesen, Patron, Klient, Republik, Nobilität, Ständekämpfe, amicitia, politische Macht, soziales Gefüge, Reziprozität, Fides.
Welche wichtigen Forschungsansätze werden berücksichtigt?
Die Arbeit berücksichtigt die Forschungsansätze von Winterling, Bleicken und Gelzer.
- Quote paper
- Yvonne Kruschel (Author), 2010, Klientelbeziehungen in der späten römischen Republik, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/231549