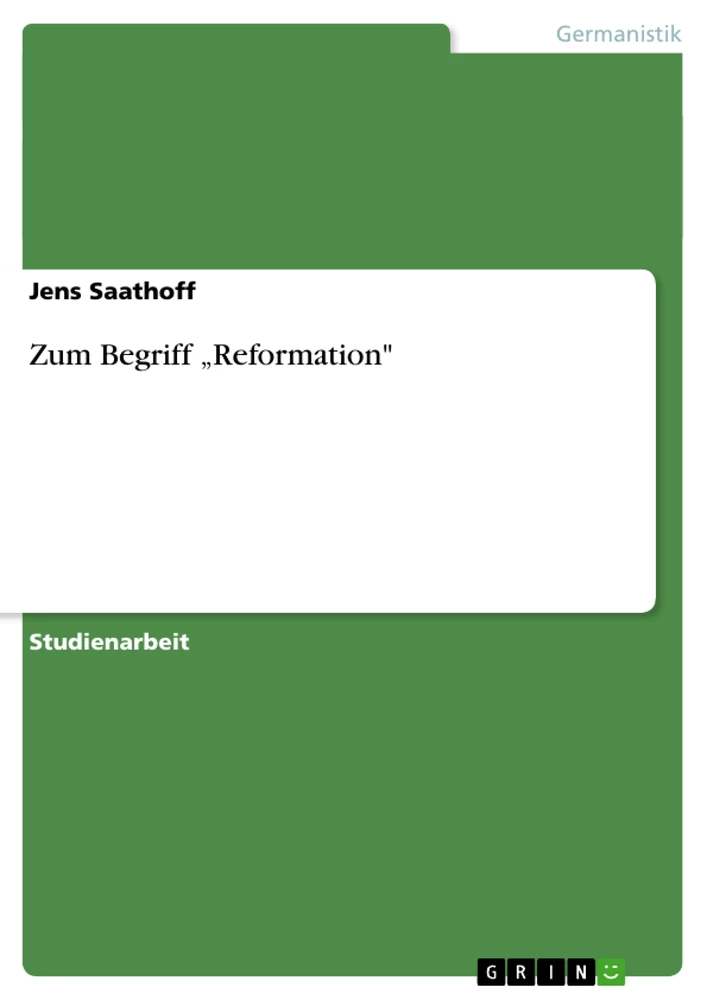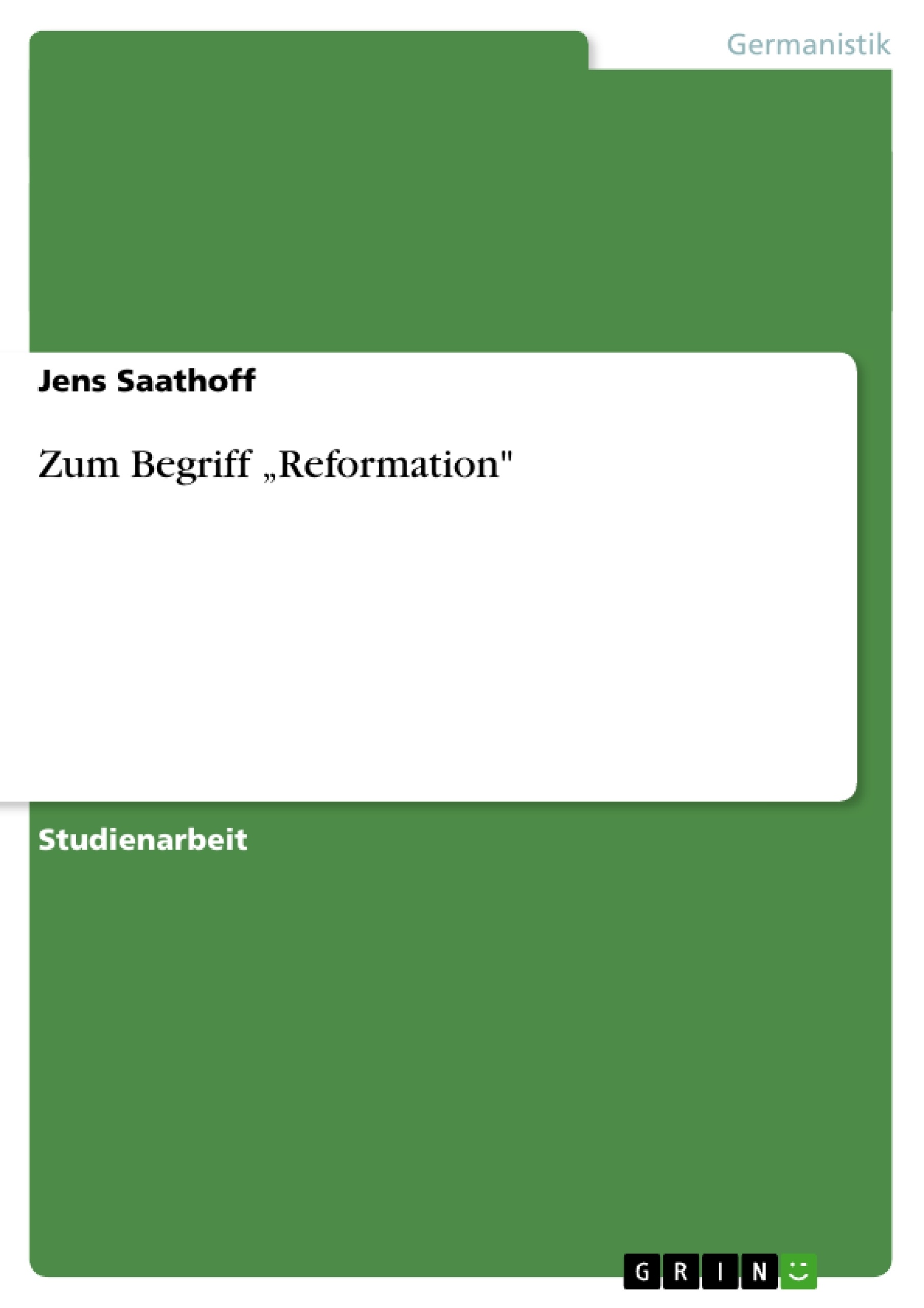Der Begriff der „Reformation“ besitzt eine Fülle von Bedeutungen, die im unter-schiedlichen Verständnis und Betrachtungsstandpunkt des jeweiligen Benutzers be-gründet ist. Je nachdem, aus welchem Geschichtsverständnis heraus der Reformationsbegriff benutzt wird (z. B. aus politischer, theologischer, juristischer oder sozialgeschichtlicher Sicht), ändert sich auch seine Deutung. Somit ist die jeweilige Interpretation auch immer Ausdruck eines bestimmten geschichtswissenschaftlichen Erkenntnisansatzes.
Bei der Klärung des Reformationsbegriffs müssen offensichtlich zwei Untersuchungsebenen unterschieden werden. Zum einen existiert eine Ebene, die sich auf die Begriffsbedeutung in ihrer geschichtlichen Entwicklung bezieht und versucht, das Verständnis von „Reformation“ zur jeweiligen Zeit der Begriffsbenutzung und der Entstehung entsprechender Textquellen zu untersuchen. Zum anderen handelt es sich um eine Ebene, auf der eine Begriffsdeutung aus heutiger, geschichtstheoretischer Sicht vorgenommen wird. Hier wird also betrachtet, wie dieser Begriff gegenwärtig eingesetzt wird, um auf der Grundlage von Analyse und Interpretation zu einer Kennzeichnung bestimmter historischer Ereignisse und Prozesse zu gelangen.
Der ausgeführten Unterscheidung folgend soll zunächst die Begriffsbedeutung hinsichtlich ihrer geschichtlichen Entwicklung betrachtet und daraufhin der Begriff in seiner Anwendung als wissenschaftliche Kategorie behandelt werden.
Inhalt
1. Einleitung
2. Die Begriffsgeschichte von „Reformation“
2.1 Die antike Verwendung von „reformatio“
2.2 Der Reformationsbegriff des Mittelalters
2.3 Der Reformationsbegriff im 15. und 16. Jahrhundert
2.4 Das Begriffsverständnis des 17. Jahrhunderts
2.5 „Reformation“ als Bezeichnung einer Epoche
3. „Reformation“ als kategorisierender Begriff heutiger Geschichtstheorie
4. Fazit
Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Der Begriff der „Reformation“ besitzt eine Fülle von Bedeutungen, die im unterschiedlichen Verständnis und Betrachtungsstandpunkt des jeweiligen Benutzers begründet ist. So führt Rainer Wohlfeil aus, daß der Begriff nicht nur innerhalb seiner geschichtlichen Entwicklung unterschiedliche Bedeutungen angenommen hat, sondern auch in seiner gegenwärtigen geschichtstheoretischen Verwendung unterschiedlich interpretiert wird.[1] Je nachdem, aus welchem Geschichtsverständnis heraus der Reformationsbegriff benutzt wird (z. B. aus politischer, theologischer, juristischer oder sozialgeschichtlicher Sicht), ändert sich auch seine Deutung. Somit ist die jeweilige Interpretation auch immer Ausdruck eines bestimmten geschichtswissenschaftlichen Erkenntnisansatzes. Die Vielzahl von möglichen Bedeutungsinhalten macht es erforderlich, daß bei der Verwendung des Reformationsbegriffs das jeweils zugrundeliegende Verständnis festgelegt und deutlich gemacht wird.[2]
Bei der Klärung des Reformationsbegriffs müssen offensichtlich zwei Untersuchungsebenen unterschieden werden. Zum einen existiert eine Ebene, die sich auf die Begriffsbedeutung in ihrer geschichtlichen Entwicklung bezieht und versucht, das Verständnis von „Reformation“ zur jeweiligen Zeit der Begriffsbenutzung und der Entstehung entsprechender Textquellen zu untersuchen. Zum anderen handelt es sich um eine Ebene, auf der eine Begriffsdeutung aus heutiger, geschichtstheoretischer Sicht vorgenommen wird. Hier wird also betrachtet, wie dieser Begriff gegenwärtig eingesetzt wird, um auf der Grundlage von Analyse und Interpretation zu einer Kennzeichnung bestimmter historischer Ereignisse und Prozesse zu gelangen. Zu beachten ist dabei, daß auf beiden Ebenen aus verschiedenartigen Perspektiven wiederum unterschiedliche Begriffsauffassungen resultieren.[3]
Der ausgeführten Unterscheidung folgend soll zunächst die Begriffsbedeutung hinsichtlich ihrer geschichtlichen Entwicklung betrachtet und daraufhin der Begriff in seiner Anwendung als wissenschaftliche Kategorie behandelt werden.
2. Die Begriffsgeschichte von „Reformation“
Bei der Betrachtung der Begriffsgeschichte werden hier in erster Linie die Ausführungen zum Begriff „Reformation“ aus Otto Brunners Werk „Geschichtliche Grundbegriffe“ referiert.[4]
2.1 Die antike Verwendung von „reformatio“
Im Lateinischen ist das Verb „reformare”, das einer spätgriechischen Form entspricht, früher zu belegen als das Substantiv „reformatio“. Es ist zunächst bei Ovid und dann auch bei Apuleius anzutreffen. Dabei besitzt „reformare” in der Verwendung beider Dichter einen poetischen, jedoch keinen politischen Bezug und bezeichnet die körperliche Verwandlung in eine frühere Gestalt, wobei impliziert wird, daß der frühere Zustand sich durch höhere Qualität auszeichnet. Im ersten Jahrhundert nach Christus beginnt die Bedeutung von „reformare” aus dem rein poetischen auch in den politisch-ethischen Bereich übertragen zu werden. Hier ist für die Bedeutung die Vorstellung grundlegend, daß der fortschreitende Verfall und die Verderbnis augenblicklicher Zustände eine Veränderung notwendig machen und daß sich diese Veränderung durch Besinnung auf und Rückkehr zu den besseren Zuständen früherer Zeiten vollzieht. Somit stellt die Verfallenheit eine Voraussetzung für die Umwandlung und der vergangene Zustand einen Orientierungsmaßstab für die notwendig gewordene Veränderung dar. Hier besitzt „reformare” also eine normative Bedeutung. Innerhalb dieses Bedeutungsbereiches werden nun auch die Formen „reformatio“ und „reformator“ in den Sprachgebrauch eingeführt.[5] Abgesehen von dieser normativen Bedeutung bezeichnet „reformare” zu jener Zeit auch den Vorgang der materiellen Wiederherstellung, ohne damit eine Wertbezogenheit auszudrücken. Anzumerken ist zudem, daß der Begriff „reformatio“ im Lateinischen ebenso Bestandteil der juristischen Terminologie ist.[6] Von der häufig sehr spezifischen rechtswissenschaftlichen Begriffsbedeutung soll jedoch an dieser Stelle wie auch im folgenden abgesehen werden, soweit sie sich nicht als wichtig für die allgemeine Entwicklung erweist.
In der Bibel sind die Begriffe „reformatio“ und „reformare” in Röm. 12,2 und Phil. 3,21 des Neuen Testaments zu finden. Im biblischen Sprachgebrauch bezeichnen diese Begriffe die Verwandlung des Menschen zu einem Status höherer Qualität. Für diese Verwandlung des Menschen ist nicht nur maßgeblich, daß sie sich am ursprünglichen Schöpfungszustand orientiert, sondern es wird betont, daß es sich ebenso um eine Neugestaltung handelt, mit der sich die heilsgeschichtliche „religiöse Vollendung“[7] des Menschen vollzieht. Damit erhält diese Umgestaltung den Anspruch, nach dem Ebenbild Gottes zu erfolgen.
Auch im patristischen Sprachgebrauch enthält „reformatio“ sowohl bei den griechischen als auch bei den lateinischen Kirchenvätern einen eschatologischen Bezug. Bei den griechischen Kirchenvätern kennzeichnet der Begriff die Vorstellung, daß der ursprüngliche Paradieszustand und die nach dem Sündenfall verlorene Gottebenbildlichkeit des Menschen wiederhergestellt werden. In der lateinischen Patristik existieren verschiedene Begriffsausprägungen. So steht „reformatio“ für die Vorstellung von der durch die Taufe begonnenen und sich später fortsetzenden Wiedergeburt, für die Auferstehung als Rückkehr zu den Ursprüngen und für die Bekehrung zum Christentum.
Bei Ambrosius erhält der Reformationsbegriff einen neuen Aspekt, der die theologische Bedeutung auch später geprägt hat. „Reformatio“ wird von ihm verstanden als die Verwandlung zu einem qualitativ höheren Zustand, als er bei der Schöpfung vorgelegen hat. Somit wird für die Veränderung des Menschen kein Vorbild in der Vergangenheit, sondern nur eine Orientierung am Gottesideal angenommen.[8]
Zusammenfassend lassen sich in der Antike zwei Bedeutungen des Reformationsbegriffs erkennen. Im profanen Sprachgebrauch bezeichnet „reformatio“ die aufgrund der gegenwärtigen Verderbnis notwendig gewordene Rückkehr zu einem früheren, besseren Zustand, der für die Verwandlung normgebend ist. Und im religiösen Sprachgebrauch wird dieser Begriff verstanden als die im eschatologischen Kontext zu sehende Veränderung auf ein Gottesreich hin, wobei die Umwandlung sich hier nicht an einem früheren Zustand orientiert.
[...]
[1] Wohlfeil: Einführung in die Geschichte der deutschen Reformation. München: 1982. S. 44f.
[2] Laube: Überlegungen zum Reformationsbegriff. Stuttgart 1989. S. 24.
[3] Ebd.
[4] Brunner: Geschichtliche Grundbegriffe. Stuttgart 1984.
[5] Ebd. S. 313.
[6] Vgl. Brunner: Geschichtliche Grundbegriffe. Stuttgart 1984. S. 314.
[7] Brunner: Geschichtliche Grundbegriffe. Stuttgart 1984. S. 315.
[8] Ebd. S. 316.
- Quote paper
- Dr. Jens Saathoff (Author), 1993, Zum Begriff „Reformation", Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/231312