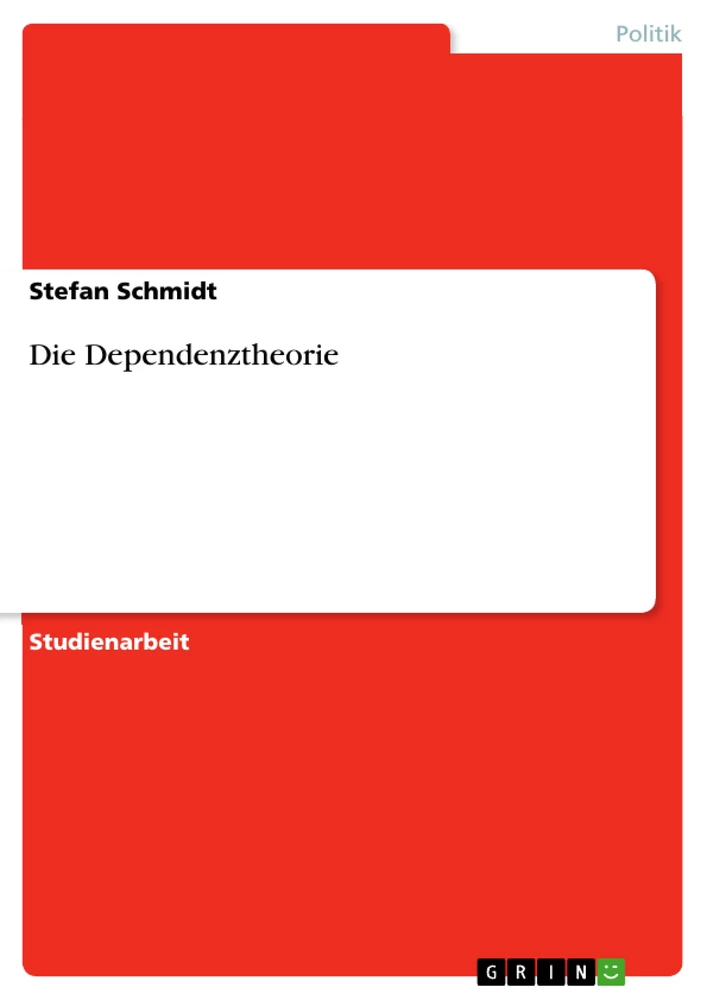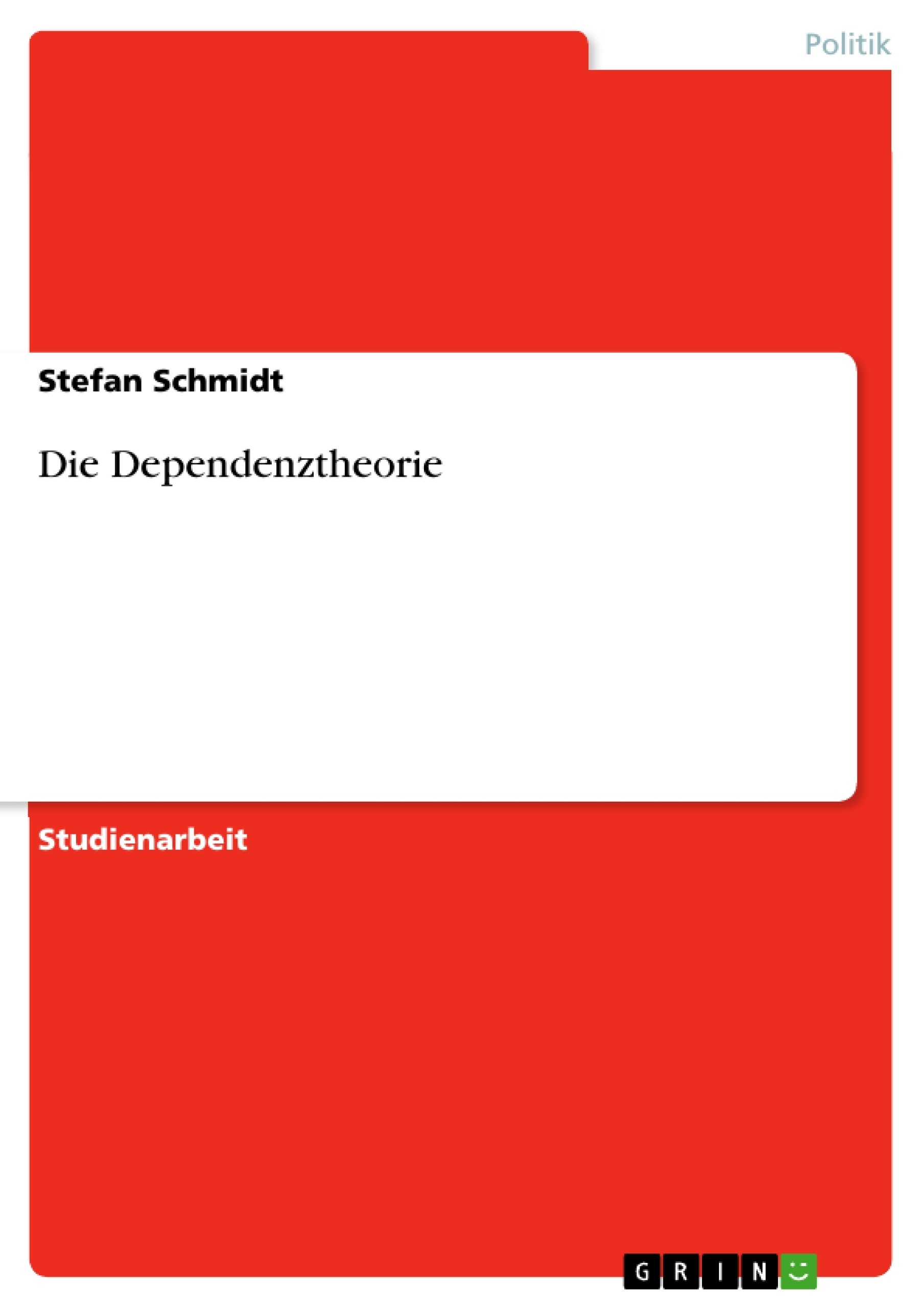Die Ausprägungen der Erklärungsansätze für die Unterentwicklung der dritten Welt sind mannigfach und ich nahezu allen Färbungen vorhanden. Das breite Spektrum verlangt deshalb Überkategorien, um die einzelnen sogenannten Entwicklungstheorien einzuordnen. Unter diesem Überbegriff unterteilt die Wissenschaft wiederum in Theorien, die die Ursache in exogenen Faktoren und in Theorien, die die Ursache in endogenen Faktoren vermutet. Zu den endogenen Theorien gehören beispielsweise die Modernisierungstheorien, die davon ausgehen, dass die Entwicklungsländer aus kulturellen, sozialen oder organisatorischen Gründen mehr Zeit zur Entwicklung zu Industrienationen benötigen als andere Länder. Die Ursachen für die Rückständigkeit sind also endogen. Modernisiert man allerdings einzelne Bereich wie das Rechtssystem, das politische System oder das Bildungssystem, werden die Entwicklungsländer den gleichen Weg zur Industrienation machen, wie die aktuellen Länder der ersten Welt.1 Dem gegenüber stehen die exogenen Entwicklungstheorien. Das meist verbreitete Beispiel ist hier die Imperialismustheorie. Sie besagt, dass die monopolistische Konzentration der weltweiten Vermögenswerte auf wenige Industrienationen nur auf Kosten der Ausbeutung der Entwicklungsländer möglich ist und die Unterentwicklung somit eine logische Folge der Ausbeutung ist.2 Somit sind hier also exogene Faktoren für die Unterentwicklung verantwortlich. Die Imperialismustheorie wird im Rahmen der Untersuchung der Neoimperialismustheorie in dieser Arbeit noch näher betrachtet werden. Die Dependenztheorie mit ihren verschiedenen Ausprägungen ist zu den exogenen Theorien zu zählen. Die folgende Arbeit wird sich näher mit der Dependenztheorie beschäftigen. Zunächst wird untersucht, aus welchen verschiedenen Strömungen die Dependenztheorie entstanden ist. Hier wird nach den Untersuchungen von Reinhard Stockmann und Ulrich Menzel verfahren. Anschließend wird die Dependenztheorie selbst vorgestellt. Abschließend werden die Anwendbarkeit der Dependenztheorie untersucht und somit die generelle Eignung für die Erklärung der Unterentwicklung überprüft.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1,2. Die Genese der Dependenztheorie
- 2.1. Singer/Prebisch These
- 2.2. Die Neoimperialismustheorie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Dependenztheorie als Erklärungsansatz für die Unterentwicklung der Dritten Welt. Sie beleuchtet die Genese der Theorie, ihre zentralen Argumentationslinien und ihre Anwendbarkeit. Die Arbeit prüft die Eignung der Dependenztheorie zur Erklärung von Unterentwicklungsphänomenen.
- Die Entstehung der Dependenztheorie aus verschiedenen Strömungen.
- Die zentralen Aussagen und Argumentationsmuster der Dependenztheorie.
- Die Singer/Prebisch-These und ihre Bedeutung für die Dependenztheorie.
- Der Einfluss der Neoimperialismustheorie auf die Dependenztheorie.
- Die Anwendbarkeit und Eignung der Dependenztheorie zur Erklärung von Unterentwicklung.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die verschiedenen Erklärungsansätze für die Unterentwicklung der Dritten Welt vor, unterteilt in endogene und exogene Theorien. Sie differenziert zwischen Theorien, die die Ursachen in den Entwicklungsländern selbst (endogen) und solchen, die sie in externen Faktoren (exogen) sehen. Als Beispiel für exogene Theorien wird die Imperialismustheorie genannt, während Modernisierungstheorien als Beispiel für endogene Theorien dienen. Die Arbeit konzentriert sich auf die Dependenztheorie als eine exogene Theorie, die im weiteren Verlauf genauer untersucht werden soll. Die Arbeit skizziert den Aufbau, der die Genese, die Darstellung der Theorie selbst und schließlich deren Anwendbarkeit umfasst.
1,2. Die Genese der Dependenztheorie: Dieser Abschnitt beschreibt die vier Kernpunkte der Dependenztheorie nach Datta: die Unmöglichkeit, Unterentwicklung ohne externe Faktoren zu erklären; die gleichzeitige historische Existenz von Entwicklung und Unterentwicklung als funktional verbundene Seiten desselben Prozesses; die externe Begründung der Unterentwicklung mit internen Auswirkungen; und die notwendige Aufhebung externer Beherrschung zur Überwindung der Unterentwicklung. Der Abschnitt betont den Perspektivwechsel der Dependenztheorie im Vergleich zur Imperialismustheorie, der die Auswirkungen der Unterentwicklung in den abhängigen Staaten in den Vordergrund rückt. Die Bedeutung der Sozialstrukturen der unterentwickelten Länder, in der traditionellen Imperialismustheorie vernachlässigt, wird hervorgehoben.
2.1. Singer/Prebisch These: Dieser Abschnitt behandelt die Singer/Prebisch-These, die die Frage untersucht, ob Entwicklungsländer durch Integration in das Weltsystem profitieren. Analysiert werden die Terms of Trade (ToT) zwischen Entwicklungs- und Industrieländern. Singer und Prebisch stellten eine Verschlechterung der ToT für Entwicklungsländer fest, was die neoklassische Theorie widerlegte und einen Wohlfahrtsverlust für Entwicklungsländer aufzeigte. Ursachen hierfür sind gewerkschaftliche Stärke und beschränktes Arbeiterpotential in Industrieländern im Gegensatz zu einem Arbeiterüberschuss in Entwicklungsländern, sowie Unterschiede in der Einkommenselastizität der Nachfrage nach Industrie- und Rohstoffen. Die These wird kritisch hinterfragt, unter anderem bezüglich der Qualitätssteigerung von Industriegütern und der unterschiedlichen Ergebnisse bei variierenden Untersuchungszeiträumen.
2.2. Die Neoimperialismustheorie: Dieser Abschnitt betrachtet die Neoimperialismustheorie von Baran und Sweezy als Grundlage der Dependenztheorie. Sie baut auf Lenins Imperialismustheorie auf, die den Imperialismus als höchste Entwicklungsstufe des Kapitalismus sieht. Die Kernaussagen der Imperialismustheorie nach Hobsbawm (Konzentration von Produktion und Kapital, Verschmelzung von Bank- und Industriekapital, Bedeutung des Kapitalexports, internationale monopolistische Verbände und die Beendigung der territorialen Aufteilung der Erde) werden zusammengefasst. Der Abschnitt stellt die Verbindung zwischen der Neoimperialismustheorie und der Dependenztheorie her und betont deren Bedeutung für das Verständnis der letzteren.
Schlüsselwörter
Dependenztheorie, Unterentwicklung, Entwicklungsländer, Imperialismustheorie, Neoimperialismustheorie, Singer/Prebisch-These, Terms of Trade, exogene Faktoren, endogene Faktoren, Weltsystem, Ausbeutung, Abhängigkeit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Dependenztheorie
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Dependenztheorie als Erklärungsansatz für die Unterentwicklung der Dritten Welt. Sie beleuchtet die Entstehung der Theorie, ihre zentralen Argumente und ihre Anwendbarkeit zur Erklärung von Unterentwicklungsphänomenen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Genese der Dependenztheorie aus verschiedenen Strömungen, die zentralen Aussagen und Argumentationsmuster der Theorie, die Singer/Prebisch-These und ihre Bedeutung, den Einfluss der Neoimperialismustheorie, sowie die Anwendbarkeit und Eignung der Dependenztheorie zur Erklärung von Unterentwicklung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in Kapitel gegliedert, beginnend mit einer Einleitung, die verschiedene Erklärungsansätze für Unterentwicklung vorstellt (endogene und exogene Theorien). Es folgen Kapitel zur Genese der Dependenztheorie, zur Singer/Prebisch-These und zur Neoimperialismustheorie. Die Arbeit endet mit einer Zusammenfassung der zentralen Argumente und Schlussfolgerungen.
Was sind die Kernaussagen der Dependenztheorie nach Datta?
Nach Datta beinhaltet die Dependenztheorie vier Kernpunkte: die Unmöglichkeit, Unterentwicklung ohne externe Faktoren zu erklären; die gleichzeitige historische Existenz von Entwicklung und Unterentwicklung als funktional verbundene Seiten desselben Prozesses; die externe Begründung der Unterentwicklung mit internen Auswirkungen; und die notwendige Aufhebung externer Beherrschung zur Überwindung der Unterentwicklung.
Was ist die Singer/Prebisch-These und ihre Bedeutung?
Die Singer/Prebisch-These untersucht, ob Entwicklungsländer durch Integration in das Weltsystem profitieren. Sie analysiert die Terms of Trade (ToT) und stellt eine Verschlechterung der ToT für Entwicklungsländer fest, was einen Wohlfahrtsverlust aufzeigt und die neoklassische Theorie widerlegt. Die These wird jedoch auch kritisch hinterfragt.
Welche Rolle spielt die Neoimperialismustheorie?
Die Neoimperialismustheorie von Baran und Sweezy, basierend auf Lenins Imperialismustheorie, bildet eine Grundlage der Dependenztheorie. Sie betont die Konzentration von Produktion und Kapital, die Verschmelzung von Bank- und Industriekapital und den Einfluss des Kapitalexports auf die Unterentwicklung.
Welche Schlussfolgerung zieht die Arbeit bezüglich der Anwendbarkeit der Dependenztheorie?
Die Arbeit prüft die Eignung der Dependenztheorie zur Erklärung von Unterentwicklungsphänomenen. Die genauen Schlussfolgerungen lassen sich aus dem vorliegenden Inhaltsverzeichnis und den Kapitelzusammenfassungen nicht vollständig ableiten, da die Arbeit selbst nicht vollständig wiedergegeben ist.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Dependenztheorie?
Schlüsselwörter sind: Dependenztheorie, Unterentwicklung, Entwicklungsländer, Imperialismustheorie, Neoimperialismustheorie, Singer/Prebisch-These, Terms of Trade, exogene Faktoren, endogene Faktoren, Weltsystem, Ausbeutung, Abhängigkeit.
- Quote paper
- Stefan Schmidt (Author), 2012, Die Dependenztheorie, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/230747