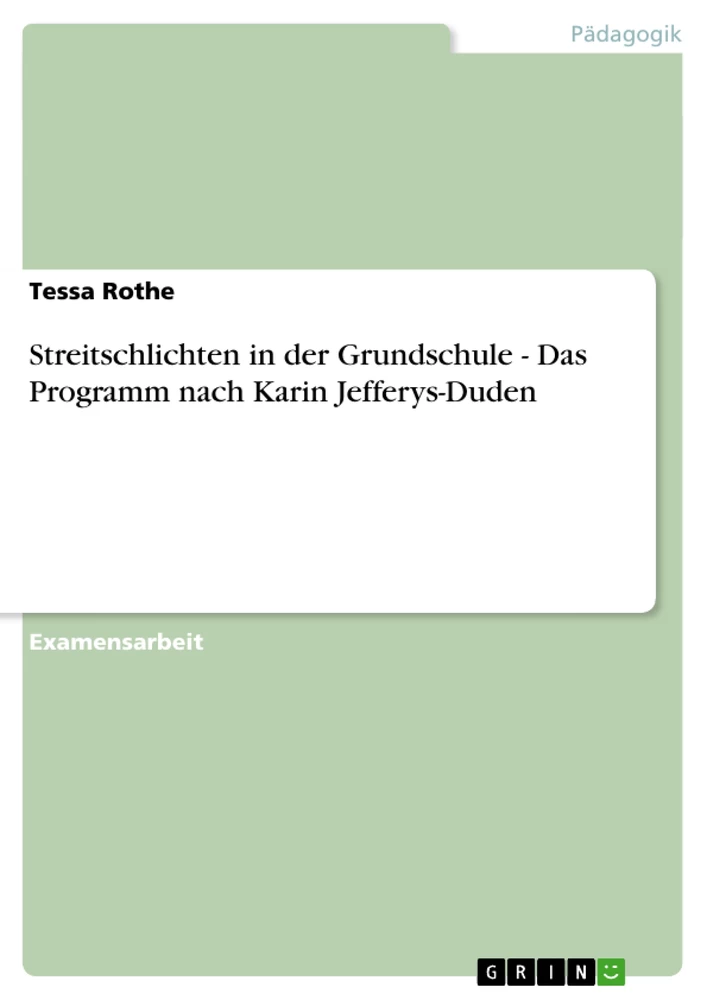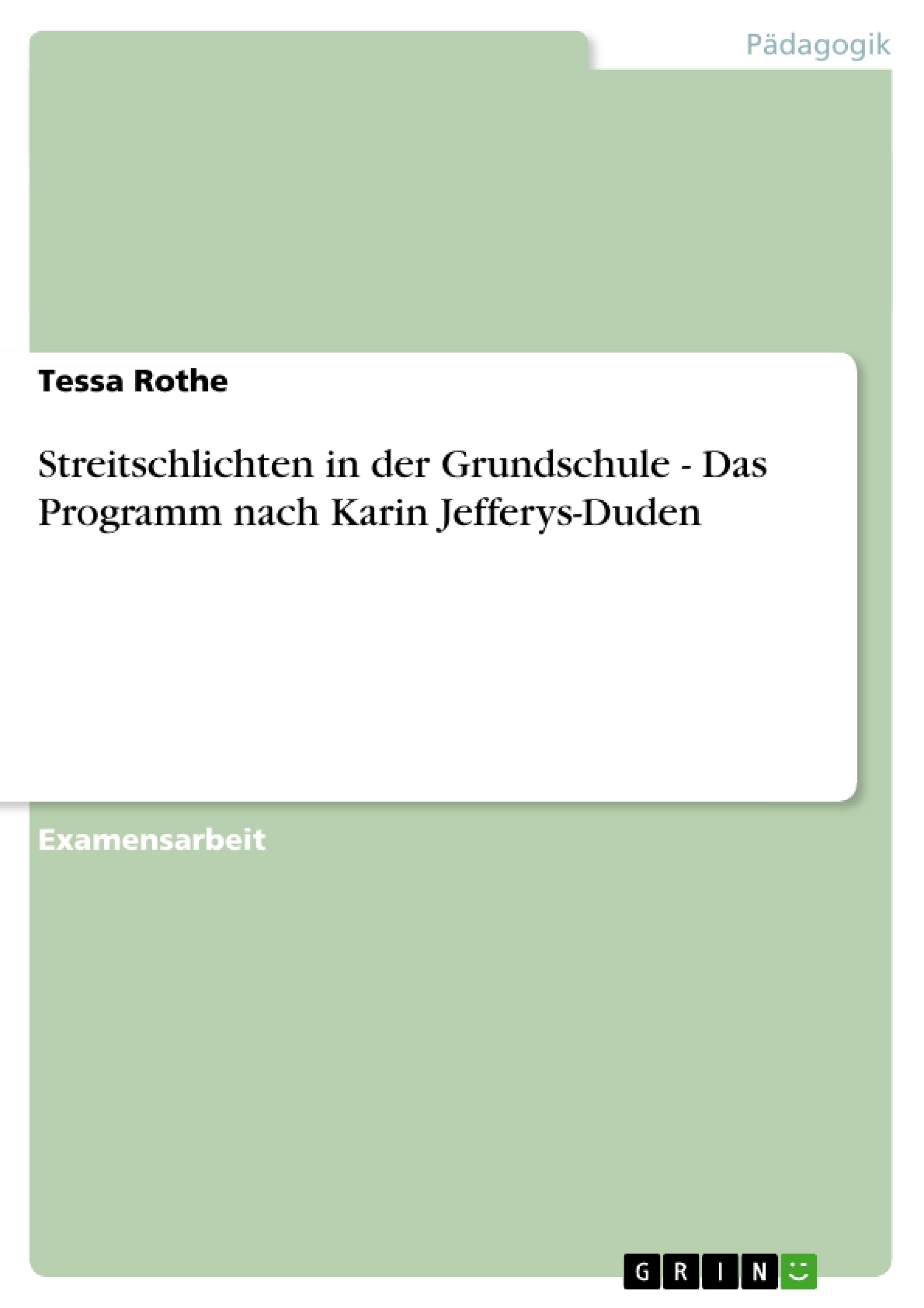In den letzten Jahren wurde dem Thema "Aggression und Gewalt an Schulen" eine immer größere Aufmerksamkeit zuteil. Zeitungsberichte und Fernsehreportagen über Gewaltbereitschaft und Gewalttätigkeiten unter Kindern und Jugendlichen lösen Betroffenheit und Erschütterung aus.
Durch die Medien, durch Beobachtung alltäglicher Streitsituationen und im persönlichen Umgang mit Mitmenschen „bekommen Kinder als Betroffene und Zeugen häufig den Eindruck, Gewalt sei ein akzeptables und vor allem effektives Mittel der Konfliktaustragung“. Wichtig ist, dass es hierbei nicht nur um physische Gewalt geht. Auch psychische Gewalt durch Ausgrenzung, Lästern, Drohungen, Auslachen, Gruppenzwang oder Hänseln überschattet den (Schul-)Alltag vieler Kinder und Jugendlicher. Als Beispiele seien hier nur gewaltverherrlichende Liedtexte, Mobbing am Arbeitsplatz eines Elternteils und das aggressive Verhalten vieler Straßenverkehrsteilnehmer (z. B. durch Missachtung der Geschwindigkeitsbegrenzung in Spielstraßen oder drängelndes Hupen) genannt. Tagtäglich werden Heranwachsende mit solchen Negativ-Beispielen konfrontiert. Es verwundert daher nicht, dass die Tendenz, Aggressionen und Gewalt als Bewältigungsstrategien in Konfliktsituationen zu sehen, bei Kindern und Jugendlichen zunimmt.
Versteht man Gewalt also als Symptom oder Ventil für unbewältigte Konflikte und damit einhergehende negative Gefühle, so wird deutlich, dass man den Kindern und Jugendlichen Handlungsalternativen für Konfliktsituationen aufzeigen muss, wenn man der Tendenz zur Gewalt entgegenwirken will. Es geht darum, sie in dem Sinne konfliktfähig zu machen, dass sie in der Lage sind, Konflikte verbal und sachlich zu lösen.
Inhaltsverzeichnis
- 0. Einleitung
- 1. Zur Frage: Was ist Streit?
- 1.1. Zur Frage: Was ist ein Konflikt?
- 1.1.1. Intrasubjektiver und intersubjektiver Konflikt
- 1.1.2. Merkmale eines Konflikts
- 1.2. Entstehung und Typologie von Konflikten nach Lewin
- 1.2.1. Das Person-Umwelt-Modell
- 1.2.2. Bedürfnis, Spannung und Verhalten
- 1.2.3. Ziel, Valenz und Konflikt
- 1.3. Konfliktlösungen
- 1.3.1. Konflikte lösen - warum eigentlich?
- 1.3.2. Konflikte lösen – wie eigentlich?
- 2. Mediation als Verfahren der Konfliktlösung
- 2.1. Was ist Mediation?
- 2.2. Leitgedanken
- 2.3. Methode und Ziele
- 2.4. Die Rolle der Mediatoren
- 2.4.1. Wann kommen Mediatoren zum Einsatz?
- 2.4.2. Anforderungen an den Mediator
- 2.4.3. Möglichkeiten und Aufgaben
- 2.5. Anwendungsfelder
- 3. Mediation an Schulen
- 3.1. Konflikte unter Kindern
- 3.2. Ziele der Schulmediation
- 3.2.1. Mediation als Intervention
- 3.2.2. Mediation als Prävention
- 3.2.3. Nebenwirkungen
- 3.3. Die Bausteine der Konfliktfähigkeit
- 3.3.1. Selbstwahrnehmung und Selbstregulation
- 3.3.2. Perspektivenübernahme und Empathie
- 3.3.3. Kommunikation
- 3.3.3.1. Ausreden lassen und Zuhören
- 3.3.3.2. Gefühle ausdrücken
- 3.3.3.3. Kritik annehmen und konstruktiv Kritik üben
- 3.4. Rahmenbedingungen für erfolgreiche Mediation
- 3.4.1. Motivation der Lehrer- und Elternschaft
- 3.4.2. Streitschlichtung im Schulprogramm
- 3.5. Vorbereitung und Organisation
- 4. Das Streitschlichterprogramm nach Karin Jefferys-Duden
- 4.1. Einführung in das Schlichtungskonzept
- 4.1.1. Konflikte erkennen
- 4.1.2. Grundbegriffe der Mediation
- 4.1.3. Schlichtung: Was ist das? Wie funktioniert sie?
- 4.1.4. Kommunikation und Interaktion
- 4.2. Konflikte und Lösungsmöglichkeiten
- 4.2.1. Kategorisierung der Konflikte
- 4.2.2. Erarbeitung der Lösungsmöglichkeiten
- 4.2.2.1. Im Unterrichtsgespräch
- 4.2.2.2. In Gruppenarbeit
- 4.3. Regeln und Schlichterfähigkeiten
- 4.3.1. Regeln und Regelverstöße
- 4.3.2. Paraphrasieren und Zuhören
- 4.4. Gefühle
- 4.4.1. Gefühle erkennen: Körpersprache und Intonation
- 4.4.2. Eigene Gefühle wahrnehmen und vergleichen
- 4.5. Der Ablauf eines Schlichtungsgesprächs
- 4.5.1. Das Bild der Friedensbrücke
- 4.5.2. Einleitung des Schlichtungsgespräches
- 4.5.3. Positionen klären
- 4.5.4. Lösungen suchen
- 4.5.5. Abkommen treffen
- 4.6. Übungsphase
- 4.7. Abschlusstest
- 4.8. Organisation von Streitschlichtung
- 4.9. Quantitative und qualitative Erfolgskontrolle
- 5. Grenzen der Schulmediation
- 6. Der Erfolg des Programms: eine theoretische Fundierung
- 7. Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht das Streitschlichterprogramm nach Karin Jefferys-Duden für die Grundschule. Ziel ist es, das Programm zu beschreiben, seine Anwendung an Schulen zu beleuchten und seine theoretische Fundierung zu diskutieren. Dabei werden die Grenzen des Programms ebenfalls berücksichtigt.
- Konfliktbegriff und -typologien
- Mediation als Konfliktlösungsprozess
- Implementierung von Mediation in der Schule
- Das Streitschlichterprogramm nach Jefferys-Duden
- Theoretische Fundierung und Grenzen der Schulmediation
Zusammenfassung der Kapitel
0. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Streitschlichtung in der Grundschule ein und beschreibt den Kontext der Arbeit. Sie benennt das verwendete Programm und skizziert den Aufbau der Hausarbeit.
1. Zur Frage: Was ist Streit?: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Begriff des Konflikts, verschiedenen Konflikttypen nach Lewin und möglichen Konfliktlösungsansätzen. Es werden intra- und intersubjektive Konflikte differenziert und die Entstehung von Konflikten anhand des Person-Umwelt-Modells erläutert. Der Fokus liegt auf dem Verständnis von Konflikten als Spannungsfelder zwischen Bedürfnissen und Zielen. Unterschiedliche Lösungsansätze werden angerissen.
2. Mediation als Verfahren der Konfliktlösung: Dieses Kapitel erläutert das Verfahren der Mediation. Es beschreibt die Leitgedanken, Methoden und Ziele von Mediation und beleuchtet die Rolle des Mediators, inklusive der Anforderungen und Aufgaben. Der Schwerpunkt liegt auf der Darstellung von Mediation als einen konstruktiven Prozess zur Konfliktlösung, der auf Konsens und Eigenverantwortung der Beteiligten basiert. Verschiedene Anwendungsfelder werden vorgestellt.
3. Mediation an Schulen: Dieses Kapitel widmet sich der Anwendung von Mediation im schulischen Kontext. Es werden die spezifischen Konflikte unter Kindern beleuchtet und die Ziele der Schulmediation (Intervention und Prävention) erläutert. Die „Bausteine der Konfliktfähigkeit“ wie Selbstwahrnehmung, Perspektivenübernahme und Kommunikation werden detailliert behandelt und mit praktischen Beispielen aus dem Schulalltag verknüpft. Die Kapitel erläutert die Bedeutung von Rahmenbedingungen, Motivation und Organisation für den Erfolg der Schulmediation.
4. Das Streitschlichterprogramm nach Karin Jefferys-Duden: Dieses Kapitel beschreibt detailliert das Streitschlichterprogramm von Karin Jefferys-Duden. Es beinhaltet eine Einführung in das Schlichtungskonzept, die Kategorisierung von Konflikten, die Erarbeitung von Lösungsmöglichkeiten und die Schulung der Schlichterfähigkeiten. Der Ablauf eines Schlichtungsgesprächs wird Schritt für Schritt erklärt, inklusive Übungen und einem Abschlusstest. Die Organisation und Erfolgskontrolle des Programms werden ebenfalls thematisiert. Der Fokus liegt auf der praktischen Anwendung des Programms.
5. Grenzen der Schulmediation: Dieses Kapitel analysiert kritisch die Grenzen und Herausforderungen der Schulmediation. Es werden potentielle Probleme und Limitationen des Ansatzes beleuchtet, möglicherweise mit Beispielen für Situationen, in denen Mediation nicht geeignet oder erfolgreich ist.
6. Der Erfolg des Programms: eine theoretische Fundierung: Dieses Kapitel bietet eine theoretische Fundierung für den Erfolg des Streitschlichterprogramms. Es verknüpft die praktischen Aspekte des Programms mit relevanten pädagogischen und psychologischen Theorien.
Schlüsselwörter
Streitschlichtung, Mediation, Konfliktlösung, Grundschule, Karin Jefferys-Duden, Schulmediation, Konfliktfähigkeit, Konfliktprävention, Konfliktintervention, Selbstwahrnehmung, Perspektivenübernahme, Kommunikation.
Häufig gestellte Fragen zum Dokument: Streitschlichterprogramm nach Karin Jefferys-Duden
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über das Streitschlichterprogramm nach Karin Jefferys-Duden für die Grundschule. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der Beschreibung des Programms, seiner Anwendung in Schulen und seiner theoretischen Fundierung, inklusive einer kritischen Betrachtung der Grenzen des Ansatzes.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt folgende Kernbereiche: den Konfliktbegriff und verschiedene Konflikttypologien nach Lewin, Mediation als Konfliktlösungsprozess, die Implementierung von Mediation in der Schule, das detaillierte Streitschlichterprogramm nach Jefferys-Duden (inkl. Ablauf eines Schlichtungsgesprächs und der Schulung von Schlichterfähigkeiten), die theoretische Fundierung des Programms und eine kritische Auseinandersetzung mit den Grenzen der Schulmediation.
Wie ist das Dokument strukturiert?
Das Dokument ist in sieben Kapitel gegliedert: Eine Einleitung, ein Kapitel zum Konfliktbegriff, ein Kapitel zur Mediation als Konfliktlösung, ein Kapitel zur Schulmediation, ein Kapitel zur detaillierten Beschreibung des Streitschlichterprogramms nach Jefferys-Duden, ein Kapitel zu den Grenzen der Schulmediation und ein Kapitel zur theoretischen Fundierung des Programms. Jedes Kapitel wird zusammengefasst.
Was sind die Ziele des Streitschlichterprogramms nach Jefferys-Duden?
Das Programm zielt darauf ab, Schülerinnen und Schüler in Konfliktlösungskompetenzen zu schulen. Es soll ihnen helfen, Konflikte eigenständig und friedlich zu lösen, indem es ihnen Fertigkeiten in Kommunikation, Perspektivenübernahme und der Suche nach gemeinsamen Lösungen vermittelt. Es verfolgt sowohl präventive als auch interventive Ziele.
Welche Fähigkeiten werden im Programm vermittelt?
Das Programm vermittelt wichtige Fähigkeiten zur Konfliktlösung, darunter: aktives Zuhören, Paraphrasieren, das Erkennen und Ausdrücken von Gefühlen, Perspektivenübernahme, die Formulierung von konstruktiver Kritik und die Entwicklung gemeinsamer Lösungen. Es schult die Schüler in der Anwendung der Friedensbrücke als Methode der Konfliktlösung.
Wie ist der Ablauf eines Schlichtungsgesprächs nach Jefferys-Duden?
Der Ablauf beinhaltet die Einleitung des Gesprächs, die Klärung der Positionen der Beteiligten, die Suche nach gemeinsamen Lösungsansätzen, das Treffen einer Vereinbarung und die abschließende Bestätigung des Abkommens. Das Programm verwendet das Bild der Friedensbrücke als visuelle Hilfestellung.
Welche theoretischen Grundlagen liegen dem Programm zugrunde?
Das Dokument erwähnt, dass das siebte Kapitel eine theoretische Fundierung für den Erfolg des Streitschlichterprogramms liefert, indem es praktische Aspekte mit relevanten pädagogischen und psychologischen Theorien verknüpft. Die genauen Theorien werden jedoch nicht im Überblick genannt.
Welche Grenzen und Herausforderungen der Schulmediation werden angesprochen?
Das Dokument erwähnt explizit ein Kapitel, welches sich mit den Grenzen und Herausforderungen der Schulmediation auseinandersetzt. Konkrete Beispiele oder Probleme werden jedoch in der Zusammenfassung nicht genannt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Streitschlichtung, Mediation, Konfliktlösung, Grundschule, Karin Jefferys-Duden, Schulmediation, Konfliktfähigkeit, Konfliktprävention, Konfliktintervention, Selbstwahrnehmung, Perspektivenübernahme, Kommunikation.
- Quote paper
- Tessa Rothe (Author), 2003, Streitschlichten in der Grundschule - Das Programm nach Karin Jefferys-Duden, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/23048