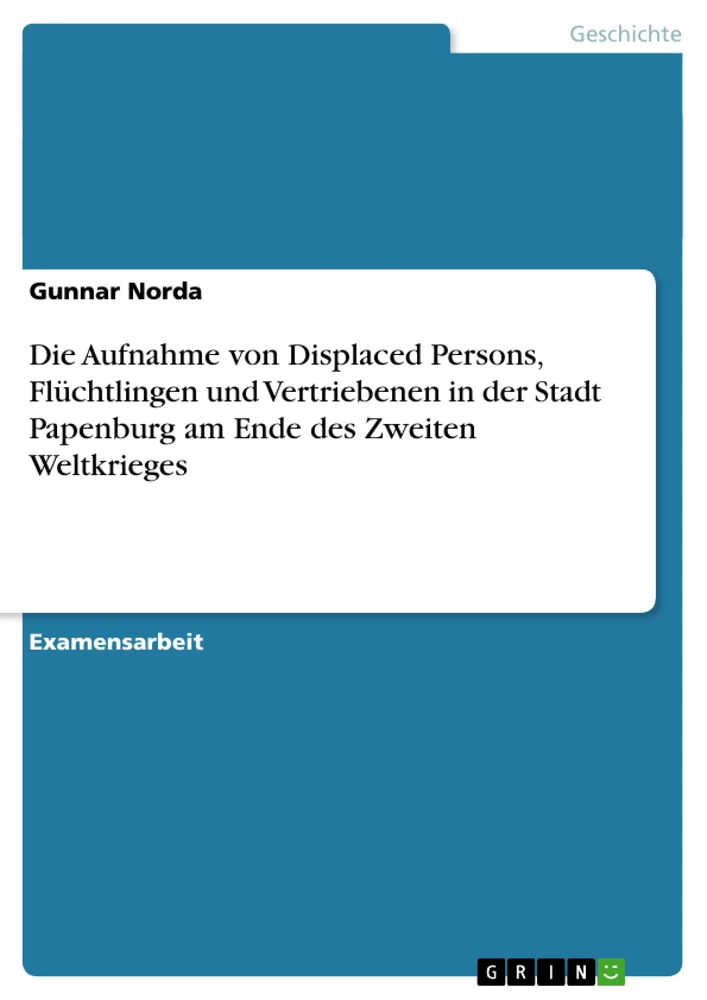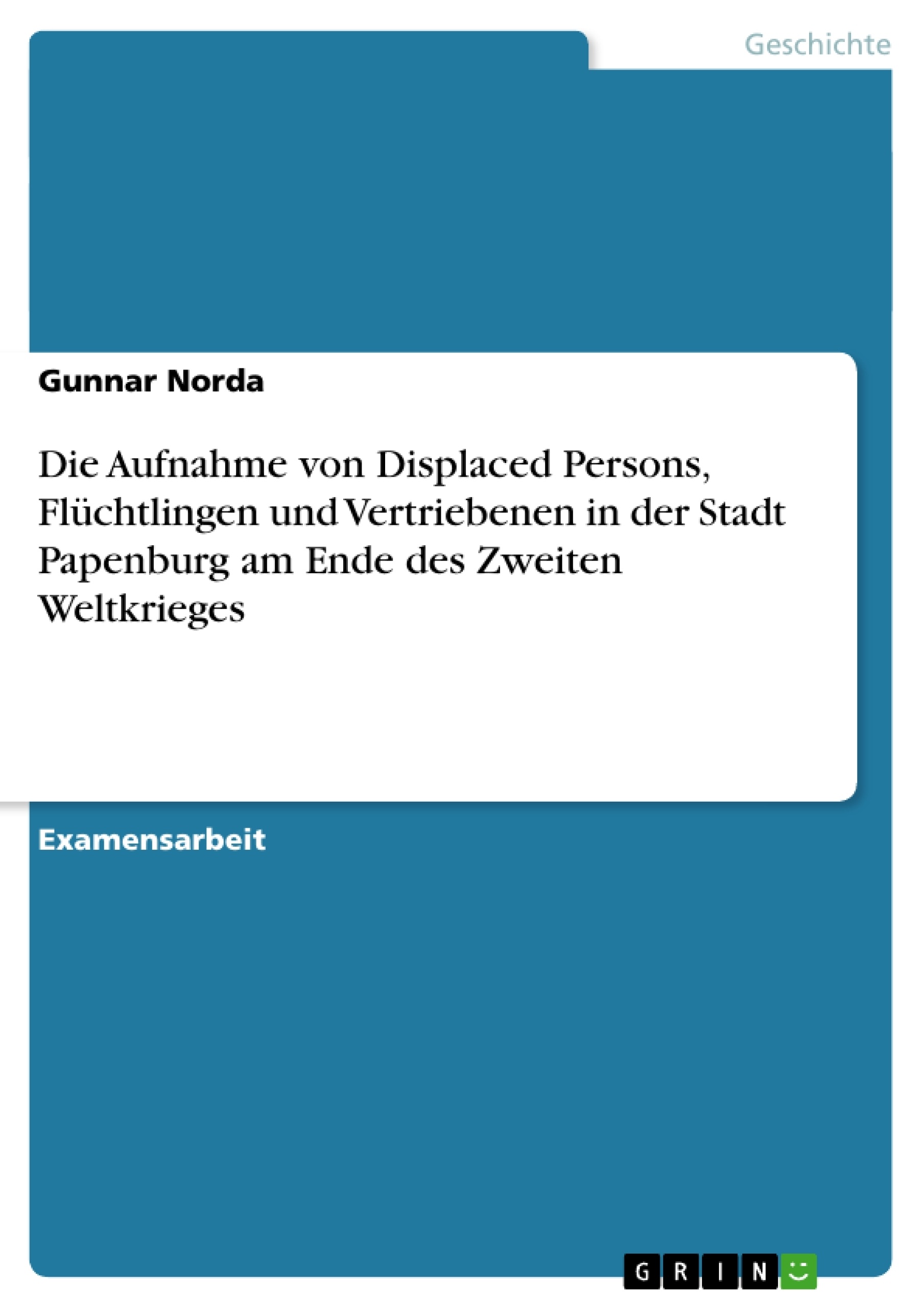Die Arbeit zeigt in einem kurzen Überblick, inwieweit die Fehnstadt und seine Einwohner mit den Verbrechen des Nationalsozialismus in Verbindung standen. Danach werden die Ereignisse des Kriegsendes in Papenburg und die Ausgangslage (Zerstörungen, Wohnraumsituation etc.) in der Fehnstadt dargestellt. Um die sogenannten "Displaced Persons (DPs)" geht es schließlich im ersten Hauptteil der Arbeit. Nachdem geklärt wurde, warum sich überhaupt so viele polnische DPs im Emsland aufhielten, soll deren Aufnahme in Papenburg näher beleuchtet werden (Evakuierung und Besetzung von Lagern und Siedlungen, Versorgung und Verwaltung, Wohnungsnot, "DP-Kriminalität", Schulwesen und kulturelle Aspekte etc.).
Der zweite Hauptteil beschäftigt sich mit den zahlreichen Flüchtlingen und Vertriebenen aus den deutschen Ostgebieten, die auch schon vor Kriegsende nach Papenburg kamen. Anfangs wird rekonstruiert, wie und warum Reichs- und Volksdeutsche überhaupt in den Westen Niedersachsens kamen, obwohl der Osten des Landes prinzipiell weitaus beliebter war und demgemäß viel stärker von Flüchtlingen und Vertriebenen aufgesucht wurde. Nachfolgend wird deren Unterbringung in Papenburg thematisiert, die hauptsächlich in vorhandenem Wohnraum bei Einheimischen erfolgte. Aufgrund der beengten Wohnsituation waren Konflikte, die über Jahre Bestand haben sollten, vorprogrammiert. Ein kleinerer Teil der Flüchtlinge und Vertriebenen wurde auch in Lagern untergebracht, von denen es vier in Papenburg gab. Im Anschluss daran soll Auskunft darüber gegeben werden, wer für die Betreuung der Flüchtlinge zuständig war und in welcher Form deren (politischen) Interessen vertreten werden konnten. Für die Papenburger Schulen war die zusätzliche Aufnahme von Flüchtlingskindern eine besondere Herausforderung. Auch die Kirchenlandschaft der katholischen Fehnstadt änderte sich nachhaltig, da die Mehrzahl der aufgenommenen Flüchtlinge evangelischer Konfession war. Neben diesen Aspekten soll wie bei den Displaced Persons besondere Aufmerksamkeit auf das Verhältnis zu den Einheimischen gelegt werden.
Insgesamt versucht die Arbeit, bisher Veröffentlichtes und thematisch Relevantes über Papenburg am Ende des Zweiten Weltkrieges und der frühen Nachkriegszeit zusammenzutragen und durch archivisches Material ,gedruckte Quellen, Zeitungen und Chroniken so weit zu ergänzen, dass ein noch umfassenderes und authentischeres Bild Papenburgs der unmittelbaren Nachkriegszeit gewonnen werden kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Stadt Papenburg und der Nationalsozialismus
- Das Kriegsende: Befreiung und Besatzung
- Herbrum, Aschendorf, Lager Aschendorfermoor, Tunxdorf und Nenndorf
- Papenburg
- Die Aufnahme von Displaced Persons
- Begriffsbestimmung
- Die politische Ausgangslage: Papenburg unter britischer Militärregierung
- (Erst-)Betreuung und Repatriierung der westlichen Displaced Persons
- Evakuierung und Besetzung von Lagern und Siedlungen
- Bokel und Tunxdorf
- „Splitting I und II“
- Versorgung und Verwaltung
- (Gesundheits-)Versorgung
- United Nations Relief and Rehabilitation Administration
- Wohnungsnot
- „DP-Kriminalität“ und deutsche Wahrnehmung
- Schulwesen und kulturelle Aspekte
- Auflösung der Lager: Repatriierung, Resettlement oder „heimatloser Ausländer“
- Die Aufnahme von Flüchtlingen und Vertriebenen
- Begriffsbestimmungen
- Ankunft und Unterbringung im Westen
- Die „Verteilung“ in Niedersachsen
- Unterbringung in Papenburg und die Wohnungsnot
- Verteilung auf den Wohnraum
- Lagerunterbringung
- Versorgung, Betreuung und Interessenvertretung
- Folgen für Schulen und Kirchen
- Schlussbemerkungen und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Aufnahme von Displaced Persons (DPs), Flüchtlingen und Vertriebenen in Papenburg am Ende des Zweiten Weltkriegs. Ziel ist es, die Herausforderungen und die Bewältigungsstrategien der Stadt in dieser komplexen Situation zu beleuchten. Die Arbeit analysiert die unterschiedlichen Gruppen und ihre Unterbringung, die Versorgungssituation und die Auswirkungen auf das soziale und kulturelle Leben Papenburgs.
- Die Integration von DPs in die Stadtgesellschaft Papenburgs
- Die Herausforderungen der Wohnungsnot und der Versorgung der neu ankommenden Bevölkerungsgruppen
- Die Rolle der britischen Militärregierung bei der Organisation und Verwaltung der Flüchtlingsaufnahme
- Die Auswirkungen der Flüchtlingsströme auf das Schulwesen und die kulturellen Institutionen Papenburgs
- Die Wahrnehmung und die Behandlung der DPs durch die deutsche Bevölkerung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Stadt Papenburg und der Nationalsozialismus: Dieses Kapitel bietet einen historischen Kontext und beleuchtet die Situation Papenburgs während des Nationalsozialismus, um die späteren Entwicklungen im Zusammenhang mit der Aufnahme von Flüchtlingen und Vertriebenen besser zu verstehen. Es analysiert den Einfluss der NS-Ideologie auf die Stadt und ihre Bevölkerung und legt den Grundstein für die Untersuchung der nachfolgenden Ereignisse.
Das Kriegsende: Befreiung und Besatzung: Der Abschnitt beschreibt die unmittelbaren Folgen des Kriegsendes in Papenburg, einschließlich der Besetzung durch britische Truppen und die Ankunft der ersten Flüchtlingsgruppen. Es werden die ersten Herausforderungen bei der Unterbringung und Versorgung der Betroffenen sowie die anfängliche Reaktion der lokalen Bevölkerung skizziert. Der Fokus liegt auf der chaotischen Situation in den ersten Wochen nach der Befreiung.
Die Aufnahme von Displaced Persons: Dieses zentrale Kapitel analysiert detailliert die Aufnahme und Integration von Displaced Persons (DPs) in Papenburg. Es werden die verschiedenen Kategorien von DPs, ihre Unterbringung in Lagern und privaten Haushalten, die Versorgung durch UNRRA und die Herausforderungen bei der Repatriierung behandelt. Die Kapitel beleuchten die soziale und politische Situation, die "DP-Kriminalität" sowie die Auswirkungen auf Schule und Kultur.
Die Aufnahme von Flüchtlingen und Vertriebenen: Dieser Teil untersucht die parallele Ankunft und Unterbringung von Flüchtlingen und Vertriebenen aus den Ostgebieten. Es werden die Schwierigkeiten bei der Wohnungsverteilung, die Lagerunterbringung und die Organisation der Versorgung thematisiert. Das Kapitel beleuchtet die Auswirkungen auf Schulen und Kirchen und verdeutlicht die zusätzlichen Belastungen für die Stadtgesellschaft.
Schlüsselwörter
Papenburg, Zweiter Weltkrieg, Displaced Persons (DPs), Flüchtlinge, Vertriebene, Britische Militärregierung, UNRRA, Wohnungsnot, Integration, Repatriierung, Resettlement, Sozialgeschichte, lokale Geschichte, Emsland.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Die Aufnahme von Displaced Persons, Flüchtlingen und Vertriebenen in Papenburg nach dem Zweiten Weltkrieg
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Aufnahme von Displaced Persons (DPs), Flüchtlingen und Vertriebenen in der Stadt Papenburg nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Sie beleuchtet die Herausforderungen und Bewältigungsstrategien der Stadt in dieser komplexen Situation.
Welche Gruppen werden untersucht?
Die Arbeit analysiert die Aufnahme und Integration von drei Gruppen: Displaced Persons (DPs), Flüchtlinge und Vertriebene. Es werden deren unterschiedliche Hintergründe und Bedürfnisse berücksichtigt.
Welche Aspekte werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Unterbringung (Lager, private Haushalte), die Versorgung (UNRRA, lokale Initiativen), die Auswirkungen auf das soziale und kulturelle Leben (Schulen, Kirchen), die Rolle der britischen Militärregierung, die Wahrnehmung der DPs durch die deutsche Bevölkerung und die Herausforderungen der Wohnungsnot.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel, die den historischen Kontext (Papenburg im Nationalsozialismus und das Kriegsende), die Aufnahme von DPs, die Aufnahme von Flüchtlingen und Vertriebenen sowie abschließende Bemerkungen umfassen. Ein Inhaltsverzeichnis bietet eine detaillierte Übersicht.
Welche Themenschwerpunkte werden besonders hervorgehoben?
Besondere Schwerpunkte liegen auf der Integration der DPs in die Stadtgesellschaft, den Herausforderungen der Wohnungsnot und Versorgung, der Rolle der britischen Militärregierung, den Auswirkungen auf das Schulwesen und die kulturellen Institutionen sowie der Wahrnehmung und Behandlung der DPs durch die deutsche Bevölkerung.
Welche Quellen wurden vermutlich verwendet?
Die Arbeit stützt sich wahrscheinlich auf diverse Quellen, darunter Archivmaterialien (britische Militärverwaltung, lokale Archive), Statistiken (UNRRA), Zeitzeugenberichte und möglicherweise auch Sekundärliteratur zur Geschichte Papenburgs und des Zweiten Weltkriegs.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Papenburg, Zweiter Weltkrieg, Displaced Persons (DPs), Flüchtlinge, Vertriebene, Britische Militärregierung, UNRRA, Wohnungsnot, Integration, Repatriierung, Resettlement, Sozialgeschichte, lokale Geschichte, Emsland.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Historiker, Sozialwissenschaftler, Lokalhistoriker und alle, die sich für die Geschichte des Zweiten Weltkriegs, die Flüchtlingsgeschichte und die Sozialgeschichte des Emslandes interessieren.
Wo finde ich weitere Informationen?
Weitere Informationen könnten in lokalen Archiven in Papenburg und im Emsland, sowie in wissenschaftlichen Datenbanken und Bibliotheken zu finden sein. Die Arbeit selbst liefert ein detailliertes Inhaltsverzeichnis und Kapitelzusammenfassungen.
Gibt es eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Ja, die Arbeit enthält eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel, die einen Überblick über den Inhalt und die wichtigsten Ergebnisse jedes Kapitels bieten.
- Quote paper
- Gunnar Norda (Author), 2007, Die Aufnahme von Displaced Persons, Flüchtlingen und Vertriebenen in der Stadt Papenburg am Ende des Zweiten Weltkrieges, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/230435