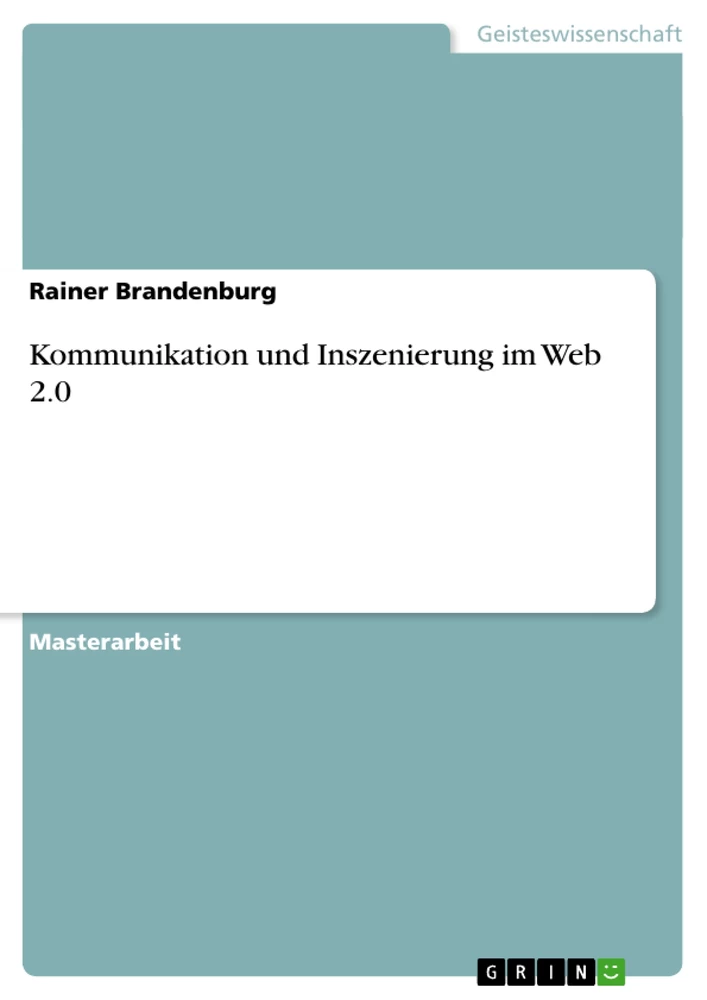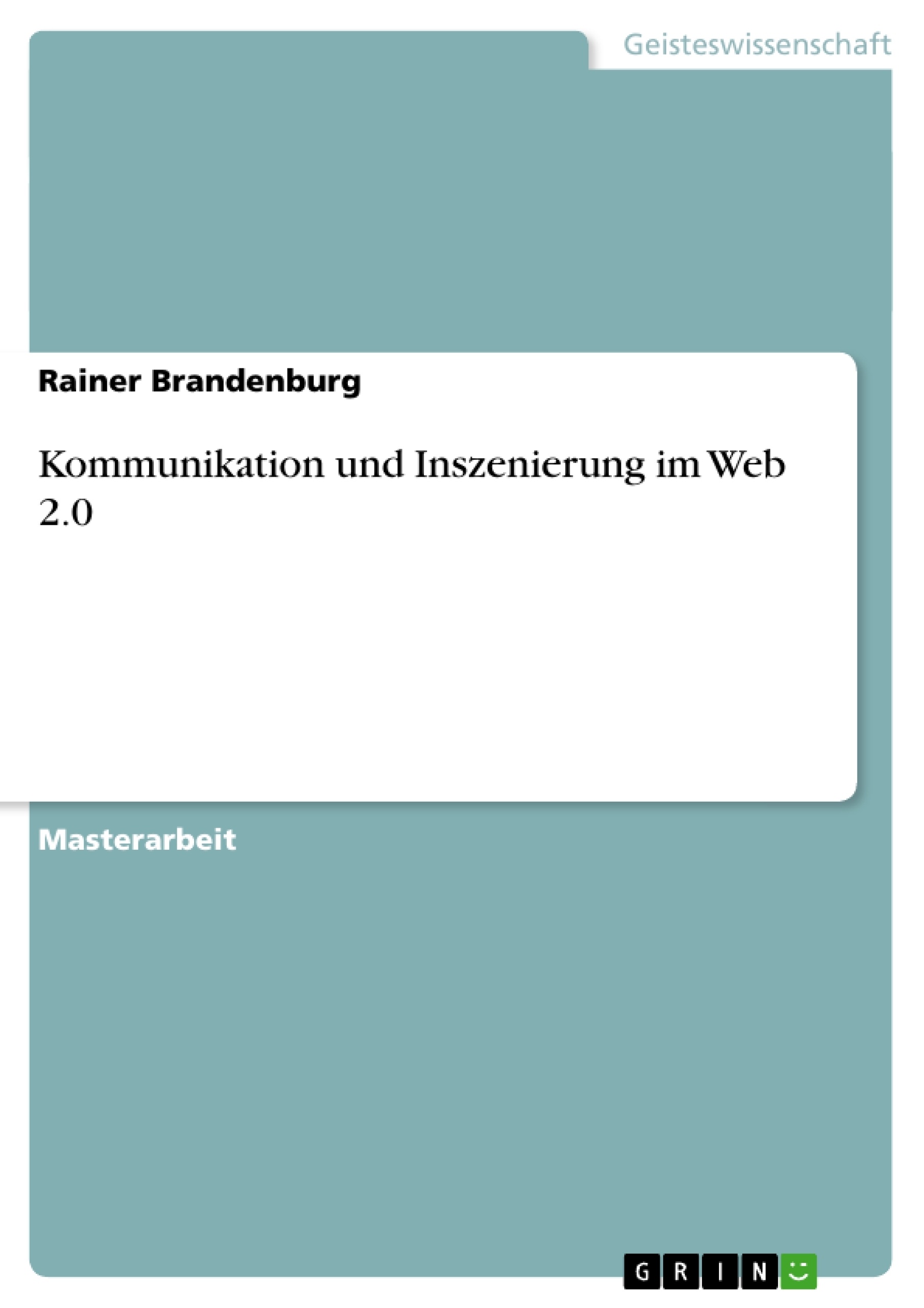(...)
Zum einen wären hier (für die vorliegenden Absichten dieser Arbeit) identitätsbildende Prozesse in der gesellschaftlichen Umwelt zu nennen. Damit sind all jene Abläufe gemeint, die dazu beitragen, dass individuelle Selbst zu beeinflussen und zu formen und das Ganze im Wechselverhältnis von online-spezifischen Milieu und lebensweltlicher Umwelt. Ansatzpunkte wären die kommunikativen Prozesse und inszenatorischen Darstellung(en) des Alter und Ego im Netz. Wie werden Identitäten auf die Metaebene projiziert und welchen Einfluss haben sie umgekehrt? Welche Rollenausprägungen werden auf der einen Seite virtuell, auf welche Weise durch das Selbst probiert und wie schlägt sich das lebensweltlich nieder? Welche gesellschaftliche Realität und die Auslegungen dessen tritt dadurch zu Tage? Diesen Fragen könnte durch die Einbeziehung und Abstraktion der Theoreme von u.a. Erving Goffman, Niklas Luhmann, Peter Berger/Thomas Luckmann sowie Lothar Krappmann (bzw. Erik H. Erikson) nachgegangen werden.
(...)
Eine rein deskriptive Bearbeitung dieses Untersuchungsfeldes, wie der Titel der Arbeit eventuell nahelegen könnte, würde zu kurz greifen und ist nicht und war nie beabsichtigt. Erst in einer Kontrastierung mit der ,realen Welt‘ wird im Sinne Goffmans das besondere der Kommunikation und Inszenierung in der virtuellen Welt trennscharf identifizierbar. In beiden Welten sind Vergesellschaftsprozesse konstitutiv, wie sie in den Theoremen Berger und Luckmanns näher definiert sind. Sie bestimmen das Handeln des Subjekts in ihnen, werden aber ebenso vom handelnden Subjekt determiniert, ausgefüllt und gegebenenfalls verändert. Als Schnittstelle für eine Beschreibung dieser wechselseitigen Wirkfaktoren scheint für die Absicht dieser Arbeit das theoretische Konstrukt der Identität besonders geeignet. Einer kontrastierenden Betrachtungsweise soll dadurch eine theoretische Fundierung gegeben werden, die hoffentlich verwertbare Aussagen und weiterführende Fragestellungen generiert.
(...)
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Internet und Web 2.0
- Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte des Internet
- Der Weg zum Web 2.0
- Web 2.0 versus Social Media
- Lebensweltliche Schlussfolgerungen
- Kommunikation
- Erkenntnistheoretische Grundlagen
- N. Luhmann - Systemische Kommunikation
- P. Berger/T. Luckmann - Gesellschaftliche Wirklichkeitskonstruktion
- E. Goffman - Theatermodell und Rahmen(analyse)
- Online-Kommunikation
- Formen der Online-Kommunikation
- Öffentlich virtuelle Kommunikation
- (Teil-)Öffentliche Kommunikation in sozialen Netzwerken
- Kommunikationskanäle auf Facebook
- Chat
- Nachricht/Instant-/Private Message
- 'Post'
- Einladung/Veranstaltung/App
- Emotionen
- Kontext
- Das Beispiel 'Xing'
- Erkenntnistheoretische Grundlagen
- Inszenierung und Identität
- Erkenntnistheoretische Grundlagen
- Identitätskonstruktion im Alltag
- Das virtuelle Subjekt
- Das 'Image'
- Der Kommentar
- Entsubjektivierung und die Kontextfrage
- Erkenntnistheoretische Grundlagen
- Fazit
- Ausblick
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Master-Thesis „Kommunikation und Inszenierung im Web 2.0" befasst sich mit der Frage, wie sich Kommunikation und Inszenierung im Internet, insbesondere im Web 2.0, vollziehen und welche Auswirkungen diese Prozesse auf die Konstruktion von Identität haben.
- Die Entstehung und Entwicklung des Internets sowie die Abgrenzung von Web 2.0 und Social Media
- Die Analyse von Kommunikationstheorien im Kontext von Online-Interaktion
- Die verschiedenen Formen der Online-Kommunikation, insbesondere in sozialen Netzwerken
- Die Rolle von Inszenierung und Identität im Web 2.0
- Die Auswirkungen von Online-Kommunikation und -Inszenierung auf die Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung der Arbeit stellt die Relevanz des Internets als Medium der Kommunikation und Inszenierung in der heutigen Zeit heraus und skizziert die Forschungsfrage und die Zielsetzung der Arbeit. Das dritte Kapitel beleuchtet die Entstehungsgeschichte des Internets und die Entwicklung zum Web 2.0. Es wird die Abgrenzung zum Begriff Social Media vorgenommen und die lebensweltlichen Schlussfolgerungen aus der technologischen Entwicklung des Internets dargelegt. Das vierte Kapitel befasst sich mit dem Thema Kommunikation. Es werden die erkenntnistheoretischen Grundlagen der Kommunikation anhand der Theorien von Niklas Luhmann, Peter Berger und Thomas Luckmann sowie Erving Goffman erarbeitet und für die Online-Kommunikation transformiert. Anschließend werden die verschiedenen Formen der Online-Kommunikation, wie z.B. öffentliche und (teil-)öffentliche Kommunikation, sowie die Kommunikation in sozialen Netzwerken, detailliert dargestellt. Besondere Aufmerksamkeit wird dabei den Kommunikationskanälen auf Facebook und dem professionellen Netzwerk Xing gewidmet. Das fünfte Kapitel widmet sich der Inszenierung und Identität. Es werden die erkenntnistheoretischen Grundlagen der Identitätskonstruktion im Alltag anhand der Arbeiten von Heiner Keupp und Lothar Krappmann erarbeitet und auf das virtuelle Subjekt übertragen. Die Arbeit schließt mit einem Fazit, das die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit zusammenfasst, und einem Ausblick, der weitere Forschungsfelder und -perspektiven im Kontext von Kommunikation, Inszenierung und Identität im Web 2.0 aufzeigt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Kommunikation, Inszenierung, Identität, Web 2.0, Social Media, Online-Kommunikation, Facebook, Xing, Systemtheorie, Gesellschaftliche Wirklichkeitskonstruktion, Rahmenanalyse, Identitätskonstruktion, virtuelles Subjekt, Entsubjektivierung, Kontext, Authentizität, Anerkennung, Zugehörigkeit, Netz-Panoptikon, Daten-schutz, Medienethik, Medien-rechte, Medien-wandel, Medien-gesellschaft, Medien-kultur, digitale Revolution, digitale Medien, digitale Transformation, digitale Gesellschaft, digitale Kultur, digitale Bildung, digitale Zukunft.
- Arbeit zitieren
- Rainer Brandenburg (Autor:in), 2013, Kommunikation und Inszenierung im Web 2.0, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/230070