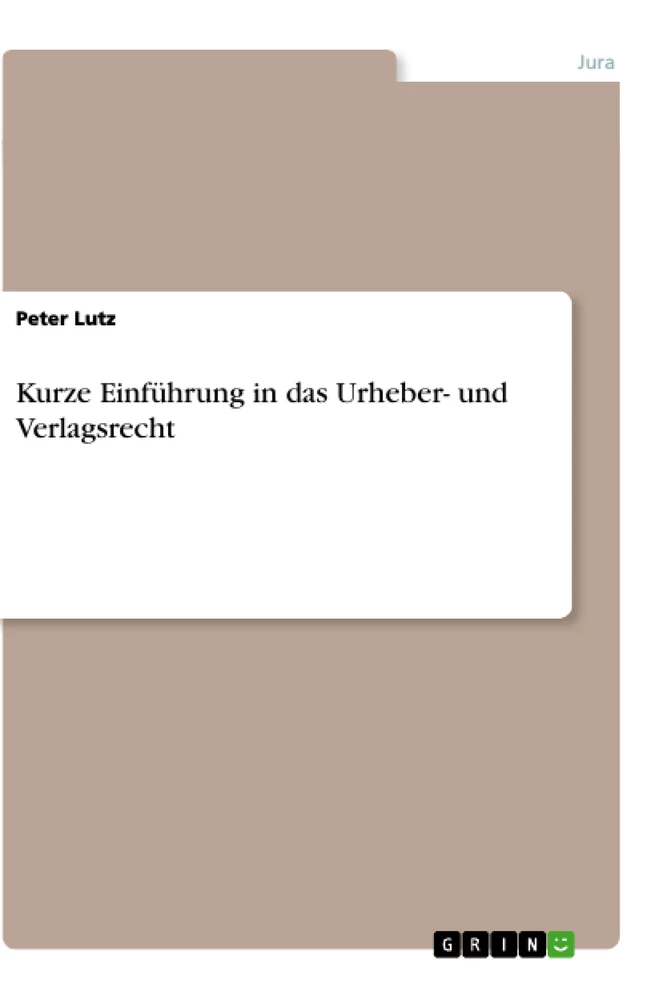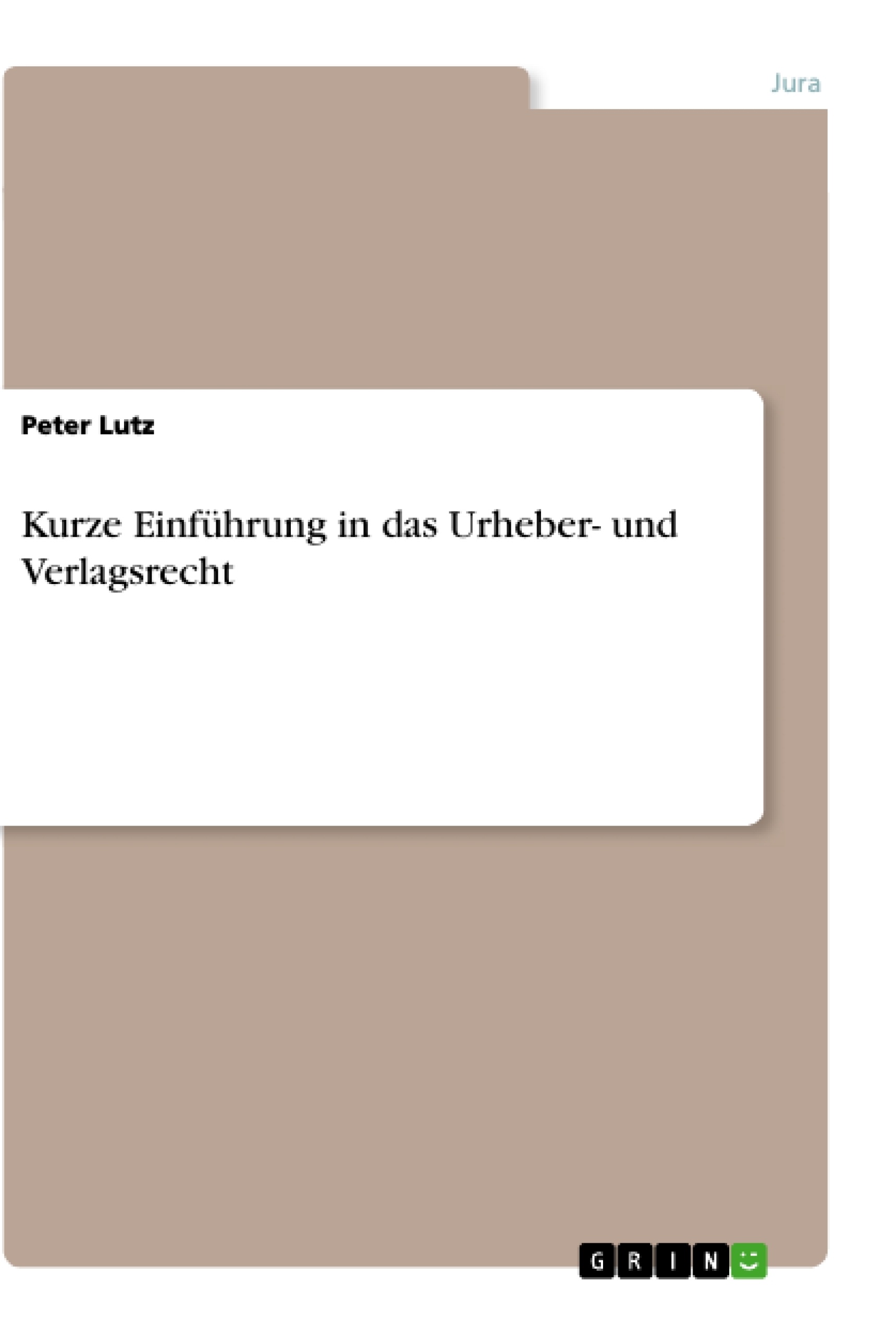Darf ich ein fremdes Zitat veröffentlichen? Kann ich eine Abbildung aus einem Buch oder von einer Webseite verwenden, ohne den Verlag oder Autor fragen zu müssen?
Dieses Buch gibt Antworten auf solche Fragen und enthält allgemeinverständliches Grundlagenwissen zum Urheber- und Verlagsrecht auf dem gesicherten Stand der herrschenden Meinung. Die wichtigsten urheberrechtlichen Begrifflichkeiten werden nachvollziehbar erklärt, dazu bedient sich der Autor des Gesetzeswortlauts sowie vieler Fundstellen aus der Rechtsprechung und der Literatur. Das vorliegende Buch richtet sich nicht nur an Jurastudenten und Buchwissenschaftler, sondern an alle Autoren und juristische Laien.
Dr. Peter Lutz ist Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht sowie Honorarprofessor für Buchwissenschaft unter besonderer Berücksichtigung des Urheber- und Verlagsrechts an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.
Aus dem Buch:
Was ist ein „Werk“ im urheberrechtlichen Sinne? Wann endet der Urheberrechtsschutz? Was ist das Urheberpersönlichkeitsrecht? Wann kann ein Werk einwilligungs- und vergütungsfrei genutzt werden (z.B. Zitatrecht, Zitierfreiheit)? Welchen Schutz gegen Urheberrechtsverletzungen gibt es? Was ist das „Recht am eigenen Bild“? Der Verlagsvertrag: Rechte und Pflichten der Vertragspartner?
G. Urheberrecht
1. Urheberrechtliche Abmahnung
Einwurf/Einschreiben
Firma
A. Verlag GmbH 1,2 , 3
. . . . . .
Betr.: C. C. „Skitouren im bayerischen Alpenvorland“
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit zeigen wir unter Vorlage einer Vollmacht4 die anwaltschaftliche Vertretung des Fotografen B. B.5, B.straße, B-Stadt, an.
Unser Mandant ist Verfasser mehrerer Bücher über Skitouren im bayerischen Alpenvorland; im Rahmen dieser Publikationen hat er zahlreiche prämierte Fotografien und in Fachkreisen als besonders präzise geschätzte Tourenbeschreibungen verfasst. So publizierte er in dem Führer „Alpenvorland“ eine Routenbeschreibung für den Weg vom Blomberggipfel nach Wackersberg mit Aufnahmen.
Unser Auftraggeber hat soeben festgestellt, dass in Ihrem Verlag ein Buch unter der Bezeichnung „Skitouren im bayerischen Alpenvorland“ (ISBN 3-. . . . . .-. . . . . .-x), verfasst von C. C., erschienen ist. Auf S. 137 und S. 139 dieses Werkes publizieren Sie zwei Fotografien unseres Mandanten von einer Skitour auf dem Blomberg und übernehmen in der Folge (S. 138 und S. 140) die von unserem Auftraggeber verfasste Skitourenbeschreibung „Vom Blomberg nach Wackersberg“. Sowohl die Fotos als auch die Beschreibungen sind identisch wiedergegeben worden.6
Bei der übernommenen Fotografie handelt es sich um ein Lichtbildwerk im Sinne von § 2 Abs. 1 Nr. 5, Abs. 2 UrhG. Durch die besondere Auswahl des Motivs, des Standortes, des Bildausschnittes sowie durch die Wahl der Blenden und auf Grund ihres besonders ausgeprägten individuellen Charakters erweisen sich die beiden Aufnahmen als Werke, die dem besonderen Schutz des UrhG unterliegen. Diese Aufnahme wurde im Übrigen beim begehrten Fotowettbewerb des Deutschen Alpenvereins ausgezeichnet.
Die in Ihrem Verlagsobjekt weiterhin von unserem Mandanten übernommene Routenbeschreibung ist als Sprachwerk ebenso urheberrechtlich geschützt (§ 2 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 UrhG). Die Präzision der Wortwahl, die eingängige Sprache und die kurzen Sätze führen dazu, dass diese Routenbeschreibung wie andere Routenbeschreibungen unseres Mandanten auch von der einschlägigen Fachwelt als besonders gelungen bezeichnet werden.
Sie haben die Lichtbildwerke und das Sprachwerk in Ihre Publikation aufgenommen, ohne die erforderliche Zustimmung unseres Auftraggebers einzuholen. Dadurch verletzen Sie die unserem Auftraggeber als Urheber der Werke zustehenden Rechte zur Vervielfältigung und Verbreitung (§§ 15, 16, 17 UrhG). Unser Mandant hat daher Anspruch auf Unterlassung, Auskunft, Rechnungslegung und Schadensersatz (§§ 97, 101 UrhG, 259 ff., 249 ff. BGB).7
Demgemäß fordern wir Sie auf, es ab sofort zu unterlassen, weitere Vervielfältigungsstücke des Werkes „Skitouren im bayerischen Alpenvorland“, verfasst von C. C., herzustellen und/oder zu verbreiten, sofern darin die Lichtbildwerke unseres Mandanten und/oder dessen Tourenbeschreibung „Vom Blomberg nach Wackersberg“ enthalten sind (§§ 96 Abs. 1, 97 UrhG). Ferner fordern wir Sie auf, diese Unterlassungsverpflichtung uns gegenüber durch eine vertragsstrafebewehrte Unterlassungsverpflichtungserklärung8, für deren Eingang wir uns den
Datum . . . . . .9.
vorgemerkt haben, zu bestätigen.
Für die Unterlassungsverpflichtungserklärung übergeben wir beigeschlossen einen Formulierungsvorschlag.10
Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass wir für den Fall der nicht rechtzeitigen oder nicht vollständigen Erfüllung der Ansprüche unserem Auftraggeber die Inanspruchnahme gerichtlicher Hilfe empfehln werden.11 Nur durch eine vertragsstrafebewehrte Unterlassungserklärung können Sie die Wiederholungsgefahr und das Rechtsschutzbedürfnis für die Unterlassungsansprüche beseitigen.
Ferner fordern wir Sie auf, Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg der rechtsverletzenden Vervielfältigungsstücke zu erteilen und zwar über Namen und Anschrift der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer der Vervielfältigungsstücke sowie der gewerblichen Abnehmer und Verkaufsstrellen, für die sie bestimmt waren, ferner über die Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Vervielfältigungsstücke sowie über Preise, die für die betreffenden Vervielfältigungsstücke bezahlt worden sind sowie Rechnung zu legen über die durch die Vervielfältigung und Verbreitung erzielten Gewinne.
Zu diesen Auskünften sind Sie verpflichtet, da es Ihnen ohne weiteres möglich ist, diese Informationen zu erteilen, die unser Mandant zur Berechnung seines Schadensersatzanspruches (§§ 242, 259 ff. BGB) und zur Verhinderung weiterer Rechtsverletzungen (§ 101 UrhG) benötigt.
Schließlich haben wir Sie aufzufordern, den Schadensersatzanspruch unseres Mandanten wegen der oben geschilderten Verletzung der Rechte unserer Partei so anzuerkennen, wie er sich aus der Auskunft- und Rechnungslegung ergibt. Der Schadensersatzanspruch umfasst auch die Kosten unserer Inanspruchnahme (§§ 97 UrhG, 249 ff. BGB).12
Zum Schadensersatz sind Sie verpflichtet, weil Sie ohne weiteres bei Anwendung der erforderlichen Sorgfalt hätten erkennen können, dass das Lichtbildwerk sowie die Routenbeschreibung von unserem Mandanten stammen und urheberrechtlich geschützt sind (§ 276 BGB).13
Selbst wenn Sie nicht schuldhaft gehandelt hätten, hat unser Auftraggeber Anspruch auf Auskunft und Rechnungslegung sowie Erstattung der Ihnen zugeflossenen ungerechtfertigten Bereicherung (§§ 97 UrhG, 812 f. BGB)14 sowie ebenso Erstattung der Kosten unserer Inanspruchnahme unter dem Gesichtspunkt der Geschäftsführung ohne Auftrag (§ 667 BGB).15
Hinsichtlich der Ansprüche auf Auskunft und Rechnungslegung sowie auf Anerkennung des Schadensersatz- bzw. Erstattungsanspruches dem Grunde nach haben wir uns ebenso die oben genannte Frist vorgemerkt16. Auch insofern kündigen wir bereits jetzt an, dass wir unserem Auftraggeber empfehlen werden, seine Ansprüche gerichtlich durchzusetzen für den Fall, dass auch insofern die Frist fruchtlos verstreichen sollte.
Mit freundlichen Grüßen
Rechtsanwalt
Anmerkungen
1. Die Abmahnung ist die an den Verletzer gerichtete vorprozessuale Aufforderung, eine bereits begangene oder bevorstehende Urheberrechtsverletzung zu unterlassen, verbunden mit der Aufforderung, eine rechtsverbindliche Verpflichtungserklärung innerhalb einer bestimmten Frist abzugeben und ferner verbunden mit der Androhung gerichtlicher Maßnahmen für den Fall, dass die verlangte Erklärung nicht fristgerecht eingeht (Wandtke/Bullinger-Kefferpütz, UrhG, 3. Aufl., 2009, vor §§ 97 ff., Rdn. 3; Deutsch, in: Pastor/Ahrens, Der Wettbewerbsprozeß, 4. Aufl., 1999., Kap. 4, Rdn. 1).
Sie ist regelmäßiger Verfahrensschritt vor der Stellung des Antrags auf Erlass einer einstweiligen Verfügung oder Erhebung der Hauptsacheklage. Gemäß § 97 a Abs.1UrhG soll der Verletzte dem Verletzer die Gelegenheit geben, den Streit über die Unterlassungsverpflichtung durch eine Unterlassungserklärung beizulegen. Durch die Aufforderung an den Verletzter, die Ansprüche eines Verletzten außergerichtlich zu erfüllen, soll zum einen eine prozessuale Auseinandersetzung und zum anderen die Kostenfolge im Zuge eines sofortigen Anerkenntnis, § 93 ZPO, vermieden werden. Nach allgemeiner Meinung hat derjenige, der, ohne außergerichtlich aufgefordert worden zu sein, die Ansprüche in der ersten mündlichen Verhandlung sofort anerkennt, keine Klageveranlassung gegeben (Zöller/ Herget, ZPO, 29. Aufl., 2012, § 93, Rdn. 4, 6, Stichwort „Wettbewerbsstreitigkeiten“; Baumbach/ Hartmann, ZPO, 71. Aufl., 2013, § 93, Rdn. 67 ff., 86 ff.).
Die Verfahrensvorschriften, die durch Rspr. und Lehre für das Wettbewerbsverfahren entwickelt worden sind, werden grundsätzlich auf den Rechtsschutz bei der Verletzung eines absoluten Schutzrechtes übertragen, wenn und soweit den Besonderheiten des jeweiligen Schutzrechts sowie den Interessen der Parteien im Einzelfall Rechnung getragen wird. Der Inhaber eines absoluten Schutzrechts kann nicht schlechter gestellt werden als er stünde, wenn er nur nach den Grundsätzen über den ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz Schutz suchen würde (OLG Karlsruhe NJW-CoR 1994, 301; Kreft, in: Jacobs u. a., UWG Großkommentar, 1991, vor § 13 C, Rdn. 6; Rogge, in: Erdmann u. a., FS für v. Gamm, 1990, S. 461, 468 ff. zu Patent- und Gebrauchsmusterstreitigkeiten).
Von dem Grundsatz, dass zur Vermeidung der Kostenrisiken aus § 93 ZPO vor Inanspruchnahme der Gerichte abzumahnen ist, ist nur bei besonderen Fallgestaltungen eine Ausnahme zu machen. Die Rechtsprechung hat insbesondere für das Wettbewerbsverfahrensrecht drei Fallkategorien (vgl. auch: Wandtke/Bullinger-Kefferpütz, UrhR, 3. Aufl., 2009, vor §§ 97 ff. UrhG, Rdn. 4) entwickelt:
– Bei abzusehender Erfolglosigkeit der Abmahnung, da diese ansonsten nur eine überflüssige Förmelei wäre; insbesondere im Falle einer offenkundig vorsätzlichen und beim Bewusstsein der Rechtswidrigkeit begangenen Verletzung (OLG Frankfurt GRUR 1985, 240 – Entbehrlichkeit einer Abmahnung; OLG Düsseldorf WRP 1979, 39; Teplitzky, Wettbewerbsrechtliche Ansprüche, 10. Aufl., 2011, Kap. 41, Rdn. 35; Baumbach/ Hartmann, ZPO, 71. Aufl., 2013, § 93, Rdn. 69). Es wird jedoch selten gelingen, sowohl den Vorsatz als auch das bestehende Bewusstsein der Rechtswidrigkeit zu beweisen oder glaubhaft zu machen. Von der voraussichtlichen Erfolglosigkeit einer Abmahnung ist auch dann auszugehen, wenn der Verletzer nach Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung erneut gegen die Rechte des Verletzten verstößt (BGH WRP 1990, 670).
– Im Fall einer besonderen Eilbedürftigkeit der Anspruchsdurchsetzung. Diese liegt dann vor, wenn die Verzögerung durch die Abmahnung so beschaffen ist, dass sie die Durchsetzung des Anspruchs gefährden oder vereiteln würde. Ein solcher Fall liegt dann vor, wenn keine rechtzeitige gerichtliche Hilfe für den Fall der Ablehnung auch einer fernmündlichen Abmahnung erlangt werden kann (Teplitzky, Wettbewerbsrechtliche Ansprüche, 10. Aufl., 2011, Kap. 41, Rdn. 30).
– Schließlich kann die vorgerichtliche Verwarnung entbehrlich sein, wenn dadurch die Durchsetzung der Unterlassungsansprüche oder anderer Ansprüche, z. B. Sicherstellungsansprüche, durch Maßnahmen des Verletzers gefährdet werden (OLG Düsseldorf, NJWE-WettbR 1998, 234 f.; WRP 1997, 471 f.; OLG Hamburg WRP 2006, 1262 (LS); OLG Stuttgart NJW-RR 2001, 257; Teplitzky, Wettbewerbsrechtliche Ansprüche, 10. Aufl., 2011, Kap. 41, Rdn. 30; OLG Frankfurt GRUR 1983, 753 – Pengo).
Die Abmahnung ist eine rechtsgeschäftsähnliche Handlung wie die Mahnung des Bürgerlichen Rechts (BGHZ 47, 357). Sie ist auf die Abgabe eines Angebots zum Abschluss eines Unterlassungsverpflichtungsvertrages gerichtet (BGHZ 121, 17- Fortsetzungszusammenhang; Köhler/Bornkamm, UWG, 31. Aufl., 2013, § 12 Rdn.1.10; a. A. KG WRP 1986, 680, 682), auf die die Regeln der Willenserklärungen entsprechend anzuwenden sind (Kreft, in: Jacobs u. a., UWG Großkommentar, 1991, Vor § 13 UWG, C, Rdn. 68–83; Piper/Ohly/Sosnitza, UWG, 5. Aufl., 2010, § 12, Rdn. 3).
2. Adressat der Abmahnung ist der Schuldner der Unterlassungs-, Auskunfts-, Rechnungslegungs- sowie Schadensersatzzahlungsverpflichtung, also der spätere Passivlegitimierte. Es handelt sich dabei regelmäßig um den oder die Täter oder Teilnehmer (BGH GRUR 2011, 1018 – Automobil-Onlinebörse Tz. 17f.) an einer unerlaubten Handlung oder den Störer, der ohne Täter oder Teilnehmer zu sein nur auf Unterlassung und Kostenerstattung haftet (BGH GRUR 2010 633 – Sommer unseres Lebens Tz. 17; BGH MMR 2012, 815 – Stiftparfüm ). Jede Art der Beteiligung genügt, also haftet der Verfasser eines Plagiats, dessen Drucker und dessen Verleger (RGSt. 12, 34, 36), derjenige, der ein geschütztes Werk ungenehmigt aufführt ebenso wie der Veranstalter (BGH GRUR 1956, 515 f. – Tanzkurse; OLG München GRUR 1979, 152 – Transvestiten - Show), der Geschäftsführer einer GmbH ( Werner, GRUR 2009, 820), der Unternehmer für Handlungen seines Mitarbeiters (§ 100 UrhG), der jedoch nicht auf Schadensersatz haftet (Wild, in: Schricker/Loewenheim, Urheberrecht, 4. Aufl., 2010, § 97, Rdn. 63 ff.; Nordemann, in: Fromm/Nordemann, Urheberrecht, 10. Aufl. 2008, § 97, Rdn. 144 ff.). Diensteanbieter des Internets sind für eigene Inhalte (Contentprovider) verantwortlich (§ 7 TMG), während sonstige für fremde Inhalte, die sie zur Nutzung bereithalten (Diensteanbieter i. S. v. §§ 8 bis 10 TMG, also insbesondere Accessprovider, Hostprovider und Carrier) nur dann haften, wenn sie vom Inhalt Kenntnis haben und es technisch möglich und zumutbar ist, diese Nutzung zu verhindern (BGH GRUR 2013, 370 – Alone in the Dark Tz. 19,28,31f., 39). Unabhängig von der Täterschaft oder der Teilnahme kann auch derjenige als Störer zur Unterlassung verpflichtet sein, der in irgendeiner Art und Weise einen adäquaten Kausalzusammenhang (Wild, in: Schricker/Loewenheim, Urheberrecht, 4. Aufl., 2010, § 97, Rdn. 62 ) zwischen dem beanstandetenVerhalten einerseits und der Rechtsverletzung andererseits herstellt (BGH GRUR 1999, 418 – Möbelklassiker; BGHZ 42, 118, 124 – Personalausweise in std. Rspr.; Haedicke GRUR 1999, 397), die rechtliche Möglichkeit hat die Rechtsverletzung zu verhindern und dem die Maßnahme zur Störungsbeseitigung zumutbar ist (BGH ZUM 2010, 696 – Sommer unseres Lebens; Dreier/Schulze, UrhG, 4. Aufl., 2013, § 97, Rdn. 33 f.).
Die Mittäter und Teilnehmer an einer Urheberrechtsverletzung haften als Gesamtschuldner (§§ 830, 840 BGB). Der Verletzter kann einen oder auch alle nach seiner Wahl in Anspruch nehmen (§ 421 BGB; Dreier/Schulze, UrhG, 4. Aufl., 2013, § 97, Rdn. 24).
Es genügt schließlich, die Abmahnung an die Betriebsstätte zu richten; die Firmenzusammenhänge brauchen vorher nicht erforscht zu werden. Stellt sich dann aber ein anderer Verursacher heraus, muss ggfl. neu abgemahnt werden.
3. Die Abmahnung ist grundsätzlich formfrei (Wandtke/Bullinger-Kefferpütz, UrhR, 3. Aufl., 2009, Vor § 97, Rdn. 5; Köhler/Bornkamm, UWG, 31. Aufl., 2013, § 12 Rdn. 1.22 ff.; Teplitzky, Wettbewerbsrechtliche Ansprüche, 10. Aufl., 2011, Kap. 41, Rdn. 10 ff.), also mündlich (OLG Frankfurt WRP 1984, 560; GRUR 1988, 32 – Messeverstoß; OLG Köln NJW-RR 1987, 36), fernmündlich (OLG Stuttgart WRP 1986, 54; OLG München WRP 1988, 62 f.), per Telefax (OLG Düsseldorf GRUR 1990, 310 – Telex Abmahnung; KG WRP 1994, 39 f.; OLG Hamburg NJW-RR 1994, 629; Schmidtmann WRP 1994, 225 ff.), aber auch durch Telegramm, Fernschreiber oder per E-Mail und selbstverständlich schriftlich zulässig. Das OLG Düsseldorf (WRP 1972, 257), OLG Hamm (WRP 1979, 563) und KG (GRUR 1973, 86 – Neumöbelverkauf) sind jedoch der Auffassung, dass die Abmahnung nicht mündlich oder telefonisch wirksam ausgesprochen werden kann. Aus Beweisgründen empfiehlt es sich, die Abmahnung stets schriftlich, telegraphisch, fernschriftlich, per Telefax oder per eMail zu versenden (Köhler/Bornkamm, UWG, 31. Aufl., 2013, aaO.; Teplitzky, Wettbewerbsrechtliche Ansprüche, 10. Aufl., 2011, Kap. 41, Rdn. 11).
Die Abmahnung muss dem Schuldner zugehen (BGH GRUR 2007, 629 – Zugang des Abmahnschreibens; vgl. zur früheren Kontroverse Köhler/Bornkamm, UWG, 31. Aufl., 2013, § 12 Rdn. 1.32 mwN.). Es empfiehlt sich daher die Abmahnung per Boten, Gerichtsvollzieher oder per Einschreiben/Rückschein zu übermitteln, da dadurch der Zugang zweifelsfrei bewiesen werden kann. Auch mit Hilfe des Einwurf-Einschreibens und der entsprechenden Bestätigung der Post über Tag und Zeitpunkt des Einwurfs in den Briefkasten (abzufragen unter: www.deutschepost.de, „Sendung verfolgen“) dürften Zweifel am Zugang nur im Ausnahmefälle erfolgreich sein. Ist diese Form der Übermittlung nicht möglich sollte die Abmahnung gleichzeitig per Post, per Fax und per Email übermittelt werden. Bestreitet der Beklagte dann noch den Zugang der Abmahnung, erscheint dies wenig glaubhaft (BGH GRUR 2007, 629 – Zugang des Abmahnschreibens). Will der Beklagte eine günstige Kostenentscheidung nach § 93 ZPO erreichen, muss er darlegen und beweisen, dass ihm die Abmahnung nicht zugegangen ist. Da es sich bei der Behauptung, die Abmahnung nicht erhalten zu haben um eine negative Tatsache handelt, muss der Gläubiger Tatsachen vortragen und ggfls beweisen, aus denen sich die Absendung der Abmahnung ergibt. Dann muss der Beklagte den Beweis antreten, die Abmahnung nicht erhalten zu haben, z. B. durch das Zeugnis des Büropersonals. Ist die Abmahnung per Post, Fax und Mail versandt worden, erscheint die Aussage, dass keines der Schreiben zugegangen ist wenig, glaubhaft.
Jedenfalls sollte der Beweis der ordnungsgemäßen Adressierung (Postleitzahl, Hausnummer!), Frankierung und Absendung einer Abmahnung geführt werden können. Bei Telefax-Abmahnung sollte der Sendebericht mit dem Vermerk „o. k.“ vorliegen (OLG München NJW 1994, 527). Bei der Email Übermittlung kann eine Lesebestätigung ein taugliches Indiz für den Zugang sein. Hat der Abmahnende Kenntnis davon, dass die Abmahnung dem Adressaten nicht zugegangen ist, so muss er die Abmahnung wieder holen (Köhler/Bornkamm, UWG, 31. Aufl., 2013, § 12 Rdn. 1.36; Kreft, in: Jacobs u. a., UWG Großkommentar, 1991, vor § 13 UWG, C, Rdn. 111; Teplitzky, Wettbewerbsrechtliche Ansprüche, 9. Aufl., 2007, 41. Kap., Rdn. 11).
4. Die Vorlage einer Vollmacht ist nach h. M. keine Wirksamkeitsvoraussetzung für ein Abmahnschreiben (OLG Köln WRP 1985, 360 f.; 1988, 79; Kreft, in: Jacobs u. a., UWG Großkommentar, 1991, vor § 13 UWG, C., Rdn. 78; Wandtke/Bullinger-Kefferpütz, UrhR, 3. Aufl., 2009, vor § 97, Rdn. 5; a. A. OLG Düsseldorf GRUR-RR 2001, 281-T-Company L. P.; OLG Dresden NJWE-WettbR 1999, 140; OLG Nürnberg WRP 1991, 522 f.; Piper/Ohly/Sosnitza, UWG, 5. Aufl., 2010 § 12 Rdn. 11). Der Abgemahnte kann die Abmahnung jedoch gem. § 174 BG zurückweisen. Ist die Abmahnung aber als Angebot zum Abschluss einer Unterlassungsvereinbarung ausgestaltet, so kann der Schuldner diese nicht zurückweisen, weil der Unterwerfungsvertrag, der mit dem Vertreter ohne Vertretungsmacht geschlossen wurde keine Vertragsstrafeansprüche auslösen würde und weil dieser Vertrag jederzeit vom Gläubiger genehmigt werden kann (§ 177 BGB); sowie schließlich, weil der Schuldner nur durch ein wirksames Vertragsstrafeversprechen die Wiederholungsgefahr beseitigen kann. Fordert der Schuldner aber mit Abgabe der Unterlassungserklärung den Gläubiger zur Vorlage einer Vollmacht auf, so ist diese vorzulegen (Köhler/Bornkamm, UWG, 31. Aufl., 2013, § 12 Rdn. 1.25 ff.; Teplitzky, Wettbewerbsrechtliche Ansprüche, 10. Aufl., 2011, 41. Kap., Rdn. 6 a; OLG Stuttgart NJWE-WettbR 2000, 125). Sofern eine Vollmacht jedoch verfügbar ist, sollte diese der Abmahnung unmittelbar beigefügt werden.
5. In der Abmahnung ist der Verletzte zu bezeichnen. Die Grundlage seiner Aktivlegitimation ist in der Sachverhaltsschilderung wiederzugeben. Aktivlegitimiert sind zunächst der Urheber oder der Inhaber eines Leistungsschutzrechts selbst. Sie können sich auf die Urheber- und Inhabervermutung gem. § 10 UrhG stützen. Bei der Verletzung von Persönlichkeitsrechten sind nach dem Tod des Urhebers dessen Erben (§ 28 UrhG) und nach dem Tod des ausübenden Künstlers dessen Angehörige (§ 76 S. 4 UrhG). Bei der Verletzung von ausschließlichen Nutzungsrechten ist neben dem Urheber selbst der Inhaber des betroffenen ausschließlichen Nutzungsrechts aktivlegitimiert. Schließlich kann die Aktivlegitimation im Wege der gewillkürten Prozessstandschaft erworben werden, wenn der Rechtsinhaber zustimmt und ein eigenes berechtigtes Interesse an der Rechtsverfolgung vorliegt (Wandtke/Bullinger-v. Wolff, UrhR, 3. Aufl., 2009, § 97, Rdn. 5 ff.; Dreier/Schulze, UrhG, 4. Aufl., 2013, § 97, Rdn. 16 ff.; Möhring/Nicolini-Lütje, UrhG, 2. Aufl., 2000, § 97, Rdn. 227). Den Verwertungsgesellschaften steht eine Vermutung der Sachbefugnis zu (§ 13 c UrhWG). Darüber hinaus ist von der Rechtsprechung (BGH GRUR 1986, 62; 1986, 66; ZUM 1986, 199; GRUR 1988, 296 – GEMA Vermutung I–II) die sogenannte GEMA-Vermutung entwickelt worden, wonach die GEMA eine tatsächliche Vermutung ihrer Wahrnehmungsbefugnis für die Aufführungsrechte an in- und ausländischer Tanz- und Unterhaltungsmusik und für die mechanischen Rechte für sich in Anspruch nehmen kann. Hat der Abmahnende seine Recht nicht originär erworben, so ist der Erwerbstatbestand einzuführen, z. B. „. . . hat mit Verlagsvertrag vom . . . das inhaltlich, räumlich und zeitlich unbeschränkte Verlagsrecht erworben“ oder „. . . ist, wie sich aus dem Erbschein des AG . . . vom . . . (Gesch. Nr. . . .) ergibt, Alleinerbe des Verfassers . . .“.
6. Der beanstandete Sachverhalt ist so genau zu beschreiben, dass der Adressat diesen in tatsächlicher Hinsicht nachvollziehen und selbst rechtlich bewerten kann (OLG München WRP 1981, 601 f.; OLG Koblenz WRP 1983, 700 f.; Köhler/Bornkamm, UWG, 31. Aufl., 2013, § 12 Rdn. 1.15; Teplitzky, Wettbewerbsrechtliche Ansprüche, 10. Aufl., 2011, Kap. 41, Rdn. 14, 15).
Da bei der Auslegung des Umfangs einer Unterwerfungserklärung auch der Inhalt der Abmahnung mit heranzuziehen ist, sollte bei der Schilderung der Sachverhaltsumstände im Abmahnschreiben große Sorgfalt verwandt werden.
In der Abmahnung selbst müssen keine Beweismittel benannt werden (KG GRUR 1983, 673 – falscher Inserent). Es ist jedoch sinnvoll, einzelne Beweismittel zu benennen, wenn dadurch dem Abgemahnten vor Augen geführt wird, dass der Sachverhalt auch jederzeit beweisbar ist. Werden Belege in der Verwarnung als beigefügt erwähnt, so macht deren Fehlen die Abmahnung nicht unwirksam. Weist der Verletzer auf das Fehlen nicht hin, gibt er Klageveranlassung (OLG Hamm GRUR 1990, 716 (LS); KG WRP 1992, 358).
7. Neben der Sachverhaltsschilderung bedarf es eines Hinweises auf die rechtlichen Folgen, die der Abmahnende dem Sachverhalt zuordnet. Dabei genügt eine summarische Bewertung des Verhaltens, wobei rechtlich fehlerhafte Einordnungen unschädlich sind (OLG Stuttgart, WRP 1996, 1229; Teplitzky, Wettbewerbsrechtliche Ansprüche, 10. Aufl., 2011, Kap. 41, Rdn. 14, 15).
8. Zum notwendigen Inhalt des Abmahnungsschreibens gehört die Aufforderung, eine strafbewehrte Unterlassungsverpflichtungserklärung abzugeben (Wandtke/Bullinger-Kefferpütz, UrhR, 3. Aufl., 2009, Vor §§ 97 ff., Rdn. 4; Köhler/Bornkamm, UWG, 31. Aufl., 2013, § 12 Rdn.1.16; Teplitzky, Wettbewerbsrechtliche Ansprüche, 10. Aufl., 2011, Kap. 41, Rdn. 15 ff.; OLG Hamburg WRP 1972, 599, Gloy/Loschelder- Schwippert, Handbuch des Wettbewerbsrechts, 4. Aufl., 2010,, § 84, Rdn. 17). Da die Abmahnung einen Prozess über das beanstandete Verhalten vermeiden soll, muss sie das zur Vermeidung eines Rechtsstreits geeignete Mittel, nämlich die strafbewehrte Unterlassungsverpflichtungserklärung, benennen. Zweckmäßigerweise wird dem Unterlassungsverlangen ein Vorschlag für die Erklärung beigefügt
9. Regelmäßig bedarf es der Setzung einer angemessenen Frist zur Abgabe der strafbewehrten Unterlassungserklärung. Ist die Frist dem Datum nach festgelegt, so endet sie um 24.00 Uhr (§§ 188, 193 BGB); ggfl. sind Stunde und Minute anzugeben. Die Angemessenheit richtet sich dabei nach den Umständen des Einzelfalles. Eine unangemessen kurze Frist setzt automatisch eine angemessene Frist in Lauf (BGH GRUR 1990, 381 f. – Antwortpflicht des Abgemahnten; OLG Köln WRP 1982, 669; Teplitzky, Wettbewerbsrechtliche Ansprüche, 10. Aufl., 2011, Kap. 41, Rdn. 16). Bei der Fristsetzung ist einerseits zu berücksichtigen, dass der Abgemahnte genügend Zeit erhält, um den Sachverhalt aufzuklären und rechtlich zu prüfen bzw. prüfen zu lassen, während umgekehrt das dringliche Interesse des Gläubigers, die Gefahr von Wiederholungen der Verletzungshandlungen oder die Gefahr von nicht wiedergutmachbaren Schädigungen zu berücksichtigen sind. Weiterhin sollte bei der Fristbestimmung berücksichtigt werden, dass einzelne OLGe nach Ablauf von bestimmten Fristen regelmäßig vom Fortfall der Eilbedürftigkeit ausgehen (vgl. Form. G. 5 Anm. 27). Werden nach Ablauf einer zu kurz bemessenen Frist gerichtliche Maßnahmen ergriffen und erkennt der Verletzter im ersten Termin an, so hat der Verletzte die Kosten zu Tragen (§ 93 ZPO).
10. Der Abmahnung soll, muss jedoch nicht, ein Formulierungsvorschlag für eine strafbewehrte Unterlassungserklärung beigefügt werden (Teplitzky, Wettbewerbsrechtliche Ansprüche, 10. Aufl., 2011, Kap. 41, Rdn. 14). Zur Vermeidung von Auslegungszweifeln sollte der Formulierungsvorschlag beigefügt werden (vgl. Form. G. 2). Wird der Abmahnung ein Formulierungsvorschlag der Unterwerfungserklärung beigefügt, dann ist die Abmahnung gleichzeitig ein Angebot auf Abschluss eines Unterlassungsvertrages. Es ist unschädlich, wenn der Gläubiger mehr fordert als ihm zusteht, da es Sache des Schuldners ist, die zur Beseitigung der Wiederholungsgefahr erforderliche Erklärung abzugeben (Köhler/Bornkamm, UWG, 31. Aufl., 2013, § 12 Rdn. 1.17).
11. Der Verletzer ist durch die Androhung der Klage auf die Risiken hinzuweisen, die mit der Nichtabgabe einer strafbewehrten Unterlassungsverpflichtungserklärung verbunden sind (OLG München WRP 1981, 601; WRP 1979, 888; OLG Düsseldorf WRP 1988, 107 f.).Zwar bedarf es keines ausdrücklichen Hinweises, da sich der Wille gerichtlich vorgehen zu wollen auch aus den Umständen (Abmahnung durch einen Rechtsanwalt u. a.) ergeben kann, aber aus Gründen der Klarheit sollte die Androhung nicht fehlen.
12. Es ist sinnvoll, die urheberrechtliche Abmahnung mit der Aufforderung zur Erfüllung der Folgeansprüche zu verbinden.
Wichtigster Anspruch des Verletzten neben demjenigen auf Unterlassung ist der Schadensersatzanspruch (§ 97 Abs. 2 UrhG). Der Schadensersatz kann auf drei verschiedene Berechnungs arten ermittelt werden: Ersatz des tatsächlich erlittenen Schadens in der Form des entgangenen Gewinns, Zahlung in Höhe einer angemessenen Lizenzgebühr oder Herausgabe des Verletzergewinns (BGHZ 44, 372, 375 ff.; Messmer-Tee II für Warenzeichenverletzung; BGH GRUR 1980, 227, 232 – Monumenta Germaniae Historica; Wild, in: Schricker/Loewenheim, Urheberrecht, 4. Aufl., 2010, § 97, Rdn.145 ff.; Nordemann, in: Fromm/ Nordemann, 10. Aufl. 2008, § 97, Rdn. 68ff.; Dreier/Schulze, UrhG, 4. Aufl., 2013, § 97, Rdn. 58 ff.; Wandtke/Bullinger-v. Wolff, UrhR, 3. Aufl., 2009, § 97, Rdn. 54 ff.; Möhring/Nicolini, UrhG, 2. Aufl., 2000, § 97, Rdn. 148 ff.). Zur Bezifferung des Schadensersatzanspruchs, aber auch des Bereicherungsanspruchs (§§ 97 Abs. 3 UrhG, 812 ff. BGB), hat sich der gewohnheitsrechtlich anerkannte Anspruch auf Auskunftserteilung und Rechnungslegung über alle für die Schadensberechnung erforderlichen Angaben entwickelt (Gloy/Loschelder- Schwippert, Handbuch des. Wettbewerbsrecht, 4. Aufl., 2010,, § 82, Rdn. 13; Wild, in: Schricker/Loewenheim, Urheberrecht, 4. Aufl., 2010, § 97, Rdn. 187 ff.; Nordemann, in: Fromm/ Nordemann, Urheberrecht, 10. Aufl. 2008, § 97, Rdn. 70 ; Dreier/Schulze, UrhG, 4. Aufl., 2013, § 97, Rdn. 78 ff.; Wandtke/Bullinger-v. Wolff, UrhR, 3. Aufl, 2009, § 97, Rdn. 43 ff.; Möhring/Nicolini-Lütje, UrhG, 2. Aufl., 2000, § 97, Rdn. 227).
Da regelmäßig die Bezifferung des Schadensersatzanspruches erst dann möglich ist, wenn der Verletzte über die Berechnungsgrundlagen anhand der Auskunfts- und Rechnungslegung verfügt, sollte vom Verletzer ein Anerkenntnis seiner Schadensersatzverpflichtung dem Grunde nach (§§ 780, 781 BGB) gefordert werden. Ein etwaiger Rechtsstreit könnte sich dann auf die Höhe des Schadensersatzes beschränken.
Weiterhin kann der Verletzte vom Verletzer die sog. Drittauskunft fordern (§ 101 UrhG), wenn die Inanspruchnahme nicht im Einzelfall unverhältnismäßig ist (§ 101 Abs. 4 UrhG). Danach kann der Verletzte unverzüglich Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg der Vervielfältigungsstücke verlangen, wobei der zur Auskunft Verpflichtete Angaben zu machen hat über Namen und Anschrift des Herstellers, des Lieferanten und anderer Vorbesitzer der Vervielfältigungsstücke, der gewerblichen Abnehmer oder Auftraggeber sowie über die Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Vervielfältigungsstücke und deren Preise (§ 101 Abs. 3 UrhG). Die Angaben dienen insbesondere zur Bekämpfung der Produktpiraterie, um Hersteller, Lieferanten und die mit der gewerblichen Verbreitung Befassten ebenso auf Unterlassung in Anspruch nehmen zu können. Dieser Auskunftsanspruch kann in Fällen der offensichtichen Rechtsverletzung im Wege der einstweiligen Verfügung durchgesetzt werden (§ 101 Abs. 7 UrhG); vgl. Form. G. 10.
Neben diesen Ansprüchen könnte der Verletzte bei berechtigtem Interesse die Urteilsbekanntmachung (§ 103 UrhG) und die Vernichtung bzw. Herausgabe der rechtswidrig hergestellten und zur Verbreitung bestimmten Vervielfältigungsstücke fordern oder die Überlassung bzw. die Vernichtung der zur Herstellung bestimmten Vorrichtungen (§ 98, UrhG). Da diese Ansprüche eher selten geltend gemacht werden, sind sie nicht im Formularvorschlag aufgenommen. Gegebenenfalls könnte formuliert werden:
„Weiterhin hat unser Auftraggeber Anspruch auf Vernichtung aller rechtswidrig hergestellter, verbreiteter und zur Verbreitung bestimmter Vervielfältigungsstücke, insbesondere der S. 137 bis 140 des Werkes „Skitouren im bayerischen Alpenvorland“, die in Ihrem Besitz oder Eigentum sind, sowie der zu deren Herstellung ausschließlich oder nahezu ausschließlich benutzten Vorrichtungen, insbesondere Filme, Lithos, Disketten (§ 98 UrhG).
Da durch Ihre Publikation der Eindruck entstand, die Tourenbeschreibung und die Lichtbildwerke stammen nicht von unserem Auftraggeber, hat unser Mandant auch Anspruch auf eine entsprechende Bekanntmachung in der Bergsteiger Zeitschrift „. . .“ anstelle einer Urteilsbekanntmachung auf Ihre Kosten (§ 103 UrhG).“
13. Die Verpflichtung zur Zahlung von Schadensersatz setzt die schuldhafte Verletzung der Urheber- oder Leistungsschutzrechte voraus. Der BGH hat in diesem Zusammenhang gefordert, dass sich der Nutzer von Rechten „vergewissert“ (BGH GRUR 1974, 97 – Spielautomaten II), dass er keine Rechte Dritter verletzt, wobei er sich gegebenenfalls die Rechtsinhaberschaft nachweisen lassen muss (BGH GRUR 1988, 375 – Schallplattenimport II; Wandtke/Nicolini-Lütje, UrhR, 3. Aufl., 2009, § 97, Rdn. 142 ff.) und bei der Publikation periodischer Druckschriften auch dem Herausgeber eine Prüfungsflicht darüber auferlegt, ob das Werk nicht die Rechte Dritter verletzt (BGHZ 14, 163 – Constanze II; GRUR 1982, 102, 104 – Masterbänder; GRUR 1993, 34, 35 – Bedienungsanleitung; Neumann-Duesberg NJW 1966, 624 ff.; Nordemann, in: Fromm/ Nordemann, Urheberrecht, 10. Aufl. 2008, § 97, Rdn. 157 f. mwN.; Wandtke/Nicolini-Lütje, UrhR, 3. Aufl., 2009, § 97, Rdn. 135 ff., mwN.). Fachkreise unterliegen grundsätzlich erhöhten Anforderungen (Wild,in: Schricker/Loewenheim, Urheberrecht, 4. Aufl., 2010, U § 97, Rdn. 139; Dreier/Schulze, UrhG, 4. Aufl., 2013, § 97, Rdn. 57). Die Anforderungen an die Sorgfalt des Herstellers sind strenger als diejenigen des Einzelhändlers, der sich auf eine korrekte und rechtmäßige Herstellung seines Lieferanten grundsätzlich verlassen kann (BGH GRUR 1957, 342 – Underberg; GRUR 1977, 114 – VUS). Ein Tatsachen- oder ein Rechtsirrtum kann das Verschulden ausschließen. Ein Rechtsirrtum entschuldigt dann, wenn der Irrende bei der Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt mit einer anderen Beurteilung durch die Gerichte rechnen durfte, also z. B. auf Grund einer für ihn günstigen, höchst richterlichen Beurteilung (Dreier/Schulze, UrhG, 4. Aufl., 2013, § 97, Rdn. 57; Wandtke/Bullinger-v. Wolff, UrhR, 3. Aufl., 2009, § 97, Rdn. 52 ff.).
14. Handelt der Verletzer ausnahmsweise nicht schuldhaft, so stellt sich die objektive Rechtsverletzung als Eingriff in die ausschließliche Benutzungsbefugnis des Urheberberechtigten dar. Dieser grundlose Vermögenszuwachs des Verletzers ist nach den Regeln der ungerechtfertigten Bereicherung, § 812 Abs. 1 S. 1 2. Alt BGB – Eingriffskondiktion, auszugleichen und der objektive Verkehrswert des Erlangten (§ 818 Abs. 2 BGB), also regelmäßig die ersparten Lizenzgebühren, herauszugeben (BGHZ 82, 299, 308 – Kunststoffhohlprofil II; GRUR 1987, 524 – Chanel Nr. 5 II; Wild, in: Schricker/Loewenheim, Urheberrecht, 4. Aufl., 2010, § 97, Rdn. 194, § 102a, Rdn. 2 f.; Nordemann, in: Fromm/Nordemann, Urheberrecht, 10. Aufl. 2008, § 97, Rdn. 2, § 102a, Rdn. 4 ff.; Dreier/Schulze, UrhG, 4. Aufl., 2013, § 97, Rdn. 66 f., § 102a, Rdn. 3 f). Dem Verletzer steht regelmäßig nicht der Entreicherungseinwand (§ 818 Abs. 3 BGB) wegen der verschärften Haftung (§§ 818 Abs. 4, 819 Abs. 1 BGB) zu (BGH GRUR 1971, 522 – Gasparone; Dreier/Schulze, UrhG, 4. Aufl., 2013, § 97, Rdn. 66, § 102a, Rdn. 5; Möhring/ Nicolini-Lütje, UrhG, 2. Aufl., 2000, § 97, Rdn. 263 jeweils mwN.).
Zur Berechnung des Bereicherungsanspruchs hat der Verletzte ebenso Anspruch auf Auskunft und Rechnungslegung (BGH GRUR 1955, 492 – Grundig Reporte; Schack, Urheber- und Urhebervertragsrecht, 6. Aufl., 2013, Rdn. 808; Möhring/Nicolini-Lütje, UrhG, 3. Aufl., 2000, § 97, Rdn. 264).
15. Der Anspruch auf Ersatz der erforderlichen Aufwendungen für die Inanspruchnahme anwaltlicher Hilfe ergibt sich aus § 97 a UrhG. Bei einfach gelagerten Fällen mit nur unerheblicher Bedeutung ist er auf EUR 100,– beschränkt. Der Gesetzgeber hatte bei dieser Beschränkung die Fälle der massenhaften Abmahnungen der Stadtplanverlage und Musikproduzenten im Auge (Weidert, Anw.Bl. 2008, 529). Der Verletzer trägt die Beweislast dafür, dass die Voraussetzungen des § 97 a Abs. 2 UrhG vorliegen. Da der Kostenerstattungs- und der Honoraranspruch des Anwalts differieren können, empfiehlt es sich, den Mandanten darauf hinzuweisen und ggfls. eine gesonderte Vergütungsvereinbarung zu schließen.
16. Eine Fristsetzung für die Erfüllung der Ansprüche ist für den Fristbeginn bei der Berechnung des Verzugsschadens erforderlich (§§ 284, 288 BGB) sowie um deutlich zu machen, ab welchem Zeitpunkt der Verletzte Klage erheben wird. Reagiert der Verletzte innerhalb der genannten Frist nicht auf die geltend gemachten Ansprüche, so hat er auch insofern Veranlassung zur Klageerhebung gegeben (§ 93 ZPO).
Da die Vernichtung (§ 98 UrhG) regelmäßig längere Zeit in Anspruch nehmen wird als die übrigen Ansprüche, sollte hierfür gegebenenfalls ein etwas verlängerter Zeitraum von wenigstens 2–3 Wochen vorgesehen werden:
„Zur Vorlage einer Vernichtungsbescheinigung (§ 98 UrhG) durch eine anerkannte Firma haben wir Ihnen eine Frist bis zum . . . zu setzen“.
Soweit die Bekanntmachung (§ 103 UrhG) verlangt wird, sollte sich der Verletzer verpflichten, eine bindende Verpflichtung zur Publikation einer Anzeige in einer oder mehrerer Zeitungen oder Zeitschriften, die die angesprochenen Leser voraussichtlich lesen, abzugeben:
„Sie verpflichten sich innerhalb der zunächst genannten übrigen Frist, in der nächst erreichbaren Ausgabe der Zeitschrift „. . .“ folgende Anzeige zu veröffentlichen: ‚In der Publikation ‚Skitouren im bayerischen Alpenvorland‘ aus dem A. Verlag ist C. C. als Autor der Routenbeschreibung auf S. 138 und S. 140 sowie als Fotograf der Aufnahmen auf S. 137 und S. 139 anstelle des tatsächlichen Autors B. B. verzeichnet‘.“
17. Kosten und Gebühren Zur Ermittlung des Gegenstandswertes vgl. Form. G. 5 Anm. 13. Für die Berechnung der Anwaltsgebühren ist zu unterscheiden, ob ein Klageauftrag erteilt wurde oder nicht. Hat der die Abmahnung verfassende Anwalt Klageauftrag erhalten, so entsteht eine Verfahrensgebühr nach Nr. 3100 VV. Endet der Auftrag durch Abgabe der Unterlassungsverpflichtungserklärung ohne gerichtliches Verfahren, so ermäßigt sich der Gebührensatz nach Nr. 3101 VV auf 0,8. Erstreckt sich der Auftrag auf die außergerichtliche Beilegung der Streitigkeit, wovon im Zweifelsfalle auszugehen ist, weil diese schneller ist und weniger kostet als die gerichtliche Auseinandersetzung, entsteht eine Geschäftsgebühr nach Nr. 2400 VV, die regelmäßig mit der Mittelgebühr von 1,3-fachen Satz abzurechnen ist (vgl. zu § 118 Abs. 1 BRAGO; BGH GRUR 1973, 384 – Goldene Armbänder). Das Gleiche gilt, wenn der Anwalt zunächst noch keinen Klageauftrag hatte; davon geht das Textbeispiel aus. Schließt sich an die Abmahnung eine gerichtliche Auseinandersetzung an, ist die Geschäftsgebühr zur Hälfte, maximal jedoch zu 0,75 auf die dann entstehende Verfahrensgebühr (Nr. 3100 VV) anzurechnen (Vorbem. 3.1. (4) VV).
18. Fristen und Rechtsbehelfe Dem auf Unterlassung in Anspruch Genommenen stehen verschieden Reaktionsmöglichkeiten offen:
Erkennt der Verletzer die Rechtsverletzung an, wird er die Unterlassungsansprüche durch Abgabe einer vertragsstrafebewehrten Unterlassungserklärung erledigen, denn dann entfällt die Wiederholungsgefahr als Anspruchsvoraussetzung des Unterlassungsanspruchs. Ist der Verletzer sich darüber bewusst, dass er schuldhaft gehandelt hat, sollte er darüber hinaus die weitergehenden Auskunfts- und Rechnungslegungsansprüche erfüllen. Der Verletzte wird damit bezüglich dieser Ansprüche, ebenso klaglos gestellt. Die Erfüllung darüber hinausgehender Ansprüche, etwa durch Anerkenntnis der Schadensersatzverpflichtung, kann im Ausnahmefall sinnvoll sein, wenn man sich bewusst ist, dass dadurch der Verletzte auch eine vertragliche Grundlage für den Schadensersatzanspruch hat.
Erkennt der Verwarnte die Berechtigung nicht an, so braucht er überhaupt nicht zu reagieren, kann aber auch selbst gegen den Abmahnenden ohne weiteres eine negative Feststellungsklage erheben, da durch die Abmahnung zum einen das Feststellungsinteresse (§ 256 ZPO) und zum anderen die Klageveranlassung dokumentiert ist (OLG Frankfurt GRUR 1989, 705 – Verletzungsklage/Feststellungsklage; OLG Hamm GRUR 1985, 84 – Feststellungsklage des Abgemahnten; OLG Köln WRP 1986, 428 f.; Wandtke/Bullinger-Kefferpütz, UrhR, 3. Aufl., 2009 vor § 97, Rdn. 8).
Daneben könnte der Abgemahnte auch auf positive Feststellung klagen, zur vorgenommenen Nutzung berechtigt zu sein.
Hat der Verletzer weder vorsätzlich noch fahrlässig gehandelt (vgl. oben Form. G. 1 Anm. 13), so kann er den Verletzten durch Zahlung einer Geldentschädigung abfinden, wenn durch die Erfüllung der Unterlassungs- (§ 97 UrhG) bzw. Vernichtungsansprüche (§ 98, UrhG) ein unverhältnismäßig großer Schaden entstehen würde und dem Verletzten eine Entschädigung in Geld zuzumuten ist (§ 101 UrhG). In diesem Fall sollte sich der Verletzer auf das Ablösungsrecht berufen (Wild, in: Schricker/Loewenheim, Urheberrecht, 4. Aufl., 2010, § 100, Rdn. 3 ff; Dreier/Schulze, 4. Aufl., 2013,§ 100, Rdn. 5) und eine angemessene Lizenzgebühr bezahlen. Mit Zahlung gilt die Einwilligung als erteilt (Wandtke/Bullinger-Bohne, UrhR, 3. Aufl., 2009, § 101, Rdn. 9; Dreier/Schulze, UrhG, 4. Aufl., 2013,§ 100, Rdn. 9; Möhring/Nicolini-Lütje, UrhG, 2. Aufl., 2000, § 101, Rdn. 9). Der Verletzer trägt allerdings die Darlegungs- und Beweislast (Dreier/Schulze, 4. Aufl., 2013,, § 100, Rdn. 7) und das Risiko der zutreffenden Bewertung. Angesichts der geringen Anforderungen der Rechtsprechung an das Verschulden ist die praktische Bedeutung der Vorschrift gering (BGH GRUR 1976, 317 – Unsterbliche Stimmen).
2. Unterlassungserklärung
G. 2
der Firma 1
A. Verlag GmbH
. . . . . .
im Folgenden kurz „A-Verlag“ genannt
gegenüber
Herrn B. B.,
. . . . . .
im Folgenden kurz „Herr B.“ genannt
1. Die Firma A. Verlag verpflichtet2 sich gegenüber Herrn B., es bei Meidung einer Vertragsstrafe in Höhe von EUR . . . . . .3 für jeden Fall der Zuwiderhandlung unter Ausschluss der Einrede des Fortsetzungszusammenhangs4 zu unterlassen,
a) die als Anlage 1 zu dieser Unterlassungsverpflichtungserklärung beigefügten Fotografien und/oder
b) die Routenbeschreibung „vom Blomberg nach Wackersberg“, verfasst von Herrn B.,
zu vervielfältigen und/oder zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte vornehmen zu lassen5, wie dies insbesondere in dem von C. C. verfassten Verlagsobjekt „Skitouren im bayerischen Alpenvorland“, S. 137–140, (ISBN . . . . . .) durch den A-Verlag erfolgt ist6;
2. Die Firma A. Verlag verpflichtet sich gegenüber Herrn B. Auskunft bis zum . . . . . . zu erteilen über die Anzahl der jeweils hergestellten, verbreiteten und sich auf Lager befindenden Vervielfältigungsstücke der in Ziff. 1 genannten Fotografien und Routenbeschreibung, über deren Herstellungskosten sowie Abgabepreise und Rechnung zu legen über die durch die Handlung gem. Ziff. 1 erzielten Gewinne.7
3. Die Firma A. Verlag erkennt dem Grunde nach den Schadensersatzanspruch aus der Verletzung der Rechte gemäß Ziffer 1 an.8
4. Die Firma A. Verlag verpflichtet sich, aus den vorhandenen Vervielfältigungsstücken diejenigen Seiten, die die Fotografien und Routenbeschreibung gemäß Ziff. 1 des Herrn B. betreffen, zu entfernen und diese Seiten sowie die zur Herstellung dieser Seiten erforderlichen Vorlagen, insbesondere Filme und Lithos, zu vernichten und bis zum . . . . . . eine Bescheinigung hierüber vorzulegen.9
5. Die Firma A. Verlag verpflichtet sich, in der nächst erreichbaren Ausgabe der Zeitschrift „. . . . . .“ eine Anzeige im Format . . . . . . mit dem Rubrum und der Ziff. 1 dieser Erklärung auf eigene Kosten zu veröffentlichen.10
6. Die Firma A. Verlag verpflichtet sich, die Kosten der Inanspruchnahme des Rechtsanwaltes . . . . . . aus einem Gegenstandswert von EUR . . . . . . in Höhe des 1,3-fachen Satzes der Geschäftsgebühr zuzüglich Auslagen und Mehrwertsteuer zu erstatten.11
7. Für Streitigkeiten aus dieser Unterlassungsvereinbarung vereinbaren die Parteien ausschließliche Zuständigkeit des LG . . . . . .12
B-Stadt, den . . . . . .
Unterschrift A. Verlag
Anmerkungen
1. Nach überwiegender Meinung ist nicht die Abmahnung, sondern die Übermittlung des Entwurfs einer vertragsstrafebewehrten Unterlassungsverpflichtungserklärung das Angebot zum Abschluss eines Unterwerfungsvertrages (OLG Hamburg GRUR 1988, 240 (LS); Köhler/Bornkamm, UWG, 31. Aufl., 2013, § 12 Rdn. 1.115; Borck WRP 1974, 372). Die Formulierung ist gerade Sache des Unterlassungsschuldners (OLG München WRP 1994, 56 f.; Teplitzky, Wettbewerbsrechtliche Ansprüche, 10. Aufl., 2011, Kap. 41, Rdn. 15). Wenn dieser eine Unterlassungserklärung unwiderruflich und mit einem Bindungswillen über eine Annahmefrist des § 147 BGB abgibt, führt allein das einseitige Angebot zum Abschluss eines Unterwerfungsvertrages bereits zum Entfallen der Wiederholungsgefahr (Wandtke/Bullinger-v. Wolff, UrhR, 3. Aufl., 2009, § 97, Rdn. 36; Dreier/Schulze, UrhG, 4. Aufl., 2013,§ 97, Rdn. 42; BGH GRUR 2006, 878-Vertragsstrafevereinbarung). Die Unterwerfungserklärung ist grundsätzlich schriftlich abzugeben (§ 780 BGB; BGHZ 130, 288 – Kurze Verjährungsfrist GRUR 1998, 953 – Altunterwerfung III), ausgenommen diejenige eines Kaufmanns (§ 350 HGB). Der Gläubiger kann, wenn eine schriftliche Erklärung nicht erforderlich ist, eine solche gleichwohl aus Beweisgründen fordern (BGH GRUR 1999, 530 – Unterwerfung durch Formvorschriften). Will der Schuldner Zweifel an der Ernsthaftigkeit seiner Erklärung zerstreuen, so muss er die Erklärung schriftlich übermitteln (Teplitzky, Wettbewerbsrechtliche Ansprüche, 10. Aufl., 2011, Kap. 8, Rdn. 4 ff.). Wird die Erklärung mit den Bestandteilen gem. Ziff. 4 und 5 des vorgeschlagenen Formulars abgegeben, so ist diese wohl als Vergleich gem. § 782 BGB zu qualifizieren, der keiner Form bedarf.
Stets bedarf es aber des Zugangs der Unterlassungserklärung beim Verletzten. Der Schuldner ist hierfür beweispflichtig. Es gilt die gleiche Problematik, wie beim Zugang der Abmahnung vgl. Form.1 Anm.3.
Es bedarf der Annahme (§ 151 BGB) durch den Verletzen, damit der Unterwerfungsvertrag zustande kommt, um die Verpflichtung zur Unterlassung einerseits und zur Zahlung der versprochenen Vertragsstrafe im Falle der Zuwiderhandlung andererseits zu begründen (BGHZ 21, 370, 372; BGH GRUR 1993, 34 – Bedienungsanweisung; Dreier/ Schulze, UrhG, 4. Aufl., 2013,§ 97, Rdn. 42; Köhler/Bornkamm, UWG, 31. Aufl., 2013, § 12 Rdn. 1.116 ff.; Teplitzky, Wettbewerbsrechtliche Ansprüche, 10. Aufl., 2011, Kap. 20, Rdn. 7 f.; Köhler, in: Jacobs u. a., Großkommentar UWG, 1991, Vor § 13, B, Rdn. 93; Köhler WRP 1993, 676 ff.). Jedoch ist eine solche Annahmeerklärung nach der Verkehrssitte nicht zu erwarten bzw. hat der Schuldner auf eine solche Annahmeerklärung verzichtet, wenn der Verletzer die vom Gläubiger vorformulierte Unterlassungserklärung in dieser Form oder lediglich redaktionell, nicht aber in inhaltlich abgeänderter Form abgibt (OLG Hamburg, GRUR 1988, 240 (LS); KG WRP 1986, 680; OLG Frankfurt GRUR 1986, 626 – Unterlassungsvertrag; Köhler, in: Jacobs u. a. (Hrsg.), Großkommentar UWG, 1991, vor § 13, Abschnitt B, Rdn. 93). Auch dann ist aber eine nach außen hervortretende eindeutige Bestätigung des Annahmewillens durch ausdrückliche Erklärungen oder konkludente Handlungen notwendig; konkludente Handlungen können auch betriebsinterne Handlungen wie die entsprechende Anweisung an das Personal oder Aktenvermerke sein.
Eine ausdrückliche Annahmeerklärung der vertragsstrafebewehrten Unterlassungsverpflichtungserklärung ist dann erforderlich, wenn der Schuldner das Versprechen konkretisiert oder ändert, mit einer auflösenden Bedingung versieht oder sonstige wesentliche Änderungen vornimmt (OLG Frankfurt GRUR 1986, 626 – Unterlassungsvertrag). Bedarf die Unterlassungserklärung einer ausdrücklichen Annahme, so hat diese regelmäßig innerhalb einer Woche zu erfolgen (Speckmann, Die Wettbewerbssache, 2. Aufl., Rdn. 564).
In Zweifelsfällen ist es ratsam, die Annahme des Unterlassungsangebots ausdrücklich und in beweisbarer Form zu erklären.
2. Die Verpflichtung muss unbefristet, ohne Einschränkungen und ohne Bedingungen erfolgen (OLG Stuttgart WRP 1984, 49; OLG Hamm WRP 1988, 334).
Erklärungen, die bloße, unverbindliche Absichten wiedergeben, wie etwa „wir werden uns verpflichten . . .“ sind nicht ausreichend (BGH GRUR 1961, 138 – Familie Schölermann).
Zu beachten ist, dass der Verpflichtete gem. § 278 BGB nicht nur für eigenes Verschulden haftet, sondern auch für dasjenige seiner Erfüllungsgehilfen (BGH GRUR 1985, 1065 f. – Erfüllungsgehilfe). Will der Verpflichtete nur für eigenes Verschulden einstehen, also die Haftung für Erfüllungsgehilfen ausschließen, so kann er keine Unterlassungserklärung unterzeichnen. Der Verletzer wird in diesem Fall jedoch damit zu rechnen haben, dass der Verletzte einen gerichtlichen Unterlassungstitel erwirken wird. Eine Festsetzung eines Ordnungsgeldes gem. § 890 ZPO setzt eigenes Verschulden voraus (BVerfG NJW 1991, 3139). Zu berücksichtigen ist, dass bei einem gerichtlichen Titel der Verpflichtete auch für eigenes Organisationsverschulden und Verschulden bei der Auswahl und Überwachung Dritter einzustehen hat (Zöller/ Stöber, ZPO, 29. Aufl., 2012, § 890, Rdn. 5 mwN.).
3. Die Höhe der Vertragsstrafe muss so bemessen sein, dass sie geeignet ist, unter Berücksichtigung aller Umstände den zur Zahlung Verpflichteten von einer weiteren bzw. von einer ersten Verletzung der Urhebernutzungsrechte des Gläubigers abzuhalten (BGH GRUR 1994, 146 – Vertragsstrafebemessung).
Wird in der Abmahnung eine unangemessen hohe Vertragsstrafe gefordert, so kann sie auf eine angemessene, der Sicherungsfunktion entsprechende Höhe reduziert werden (BGH GRUR 1994, 146 f. – Vertragsstrafebemessung; OLG Hamburg GRUR 1988, 929 f. – Höhe der Vertragsstrafe).
Ist der aus dem Unterlassungsvertrag Verpflichtete kein Kaufmann, so kann die Vertragsstrafe gemäß § 343 BGB herabgesetzt werden, wenn sie unverhältnismäßig hoch ist. Auch hierbei wird die Funktion der Vertragsstrafe als Druck- und Sicherungsmittel zur Verhütung des Vertragsverstoßes (BGH WRP 1984, 14, 15 – Vertragsstrafe für versuchte Vertreterabwerbung) als pauschaliertes Mindestschadensersatzinteresses des Gläubigers (BGH WRP 1993, 762, 763 – Apothekenzeitschriften; 1993, 240, 242 – Fortsetzungszusammenhang; 1994, 37, 39 – Vertragsstrafebemessung) sowie die Art des Verstoßes, der Verschuldensgrad und die wirtschaftliche Lage des Schuldners zu berücksichtigen sein (Palandt/ Grüneberg 72. Aufl., 2013, § 343, Rdn. 6). Ist der Schuldner Kaufmann, so scheidet grundsätzlich die Herabsetzung der Vertragsstrafe gemäß § 343 BGB aus, wobei die allgemeinen gesetzlichen Schranken (§§ 138, 242 BGB) Anwendung finden (OLG Karlsruhe, Az.: 6 U 155/95). Der Schuldner kann aber die Anwendung des § 343 HGB ausschließen (Köhler/Bornkamm, UWG, 31. Aufl., 2013, § 12 Rdn. 1.145).
Haben mehrere die Verletzung begangen oder droht die Verletzung von mehreren, so haften diese grundsätzlich nicht als Gesamtschuldner (Teplitzky, Wettbewerbsrechtliche Ansprüche, 10. Aufl., 2011, Kap. 20, Rdn. 18).
Durch das Vertragsstrafeversprechen sind darüber hinausgehende Schadensersatzansprüche nicht ausgeschlossen (BGHZ 63, 256, 259; 105, 24, 27; BGH WRP 1993, 762, 767 – Apothekenzeitschriften).
Das Vertragsstrafeversprechen kann auch in der Form des „modifizierten Hamburger Brauchs“ erfolgen, nämlich dadurch, dass dem Gläubiger gestattet wird, für jeden einzelnen Fall der Zuwiderhandlung die Vertragsstrafe festzusetzen. Die Höhe ist im Zweifel von dem zuständigen Landgericht zu überprüfen ist (§§ 315 ff. BGB) (BGH GRUR 1985, 155 – Vertragsstrafe bis zu . . .).
4. Die aus dem Strafrecht stammende Lehre von dem Fortsetzungszusammenhang mehrerer Handlungen findet auch auf die Verwirkung der Vertragsstrafe Anwendung. Demnach wird bei einem einheitlichen Tatbestandsvorsatz und einer einheitlichen Ausführung eine natürliche Handlungseinheit angenommen mit der Folge, dass mehrere Verstöße zu einem Verstoß zusammengefasst werden. Der Fortsetzungszusammenhang kann ausdrücklich abbedungen werden (BGH WRP 1993, 240, 241 – Fortsetzungszusammenhang; 1993, 762, 763 – Apothekerzeitschriften; BGH GRUR 1982, 688, 691 – Seniorenpass; Köhler/Bornkamm, UWG, 31. Aufl., 2013, § 12 Rdn. 1.150; Köhler, WRP 1993, 666; Teplitzky, Wettbewerbsrechtliche Ansprüche, 10. Aufl., 2011, Kap. 20, Rdn. 12).
Dabei ist jedoch zu beachten, dass der uneingeschränkte Verzicht auf die Einrede des Fortsetzungszusammenhangs häufig eine unangemessene Benachteiligung des Schuldners im Sinne des § 307 BGB darstellt (BGH WRP 1993, 240, 243 – Fortsetzungszusammenhang), insbesondere dann, wenn dadurch „unerträglich hohe“ Vertragsstrafen entstehen (OLG Hamm NJW-RR 1990, 1197; Köhler, in: Jacobs u. a., Großkommentar UWG, 1991, vor § 13 Abschnitt B, Rdn. 116).
Gibt der Schuldner die Unterlassungserklärung ohne den Verzicht ab, so wird dadurch die Wiederholungsgefahr trotz einer entsprechenden Forderung des Gläubigers beseitigt (BGHZ 121, 13 – Fortsetzungszusammenhang).
5. Die zu unterlassenden Handlungen müssen inhaltlich so beschrieben sein, dass sie notfalls mittels Auslegung (§§ 133, 151 BGB) anhand der Abmahnung zu ermitteln sind. Zwar muss der Inhalt nicht demjenigen eines Unterlassungstitels entsprechen (Teplitzky WRP 1990, 26 ff.; KG GRUR 1990, 143 f. – Vertragsstrafeversprechen; BGH GRUR 1999, 509 – Vorratslücken; GRUR 1998, 1038 – Fotovergrößerung; a. A. Dreier/Schulze, UrhG, 4. Aufl., 2013,§ 97, Rdn. 42), aber die zu unterlassende Handlung muss eindeutig bestimmbar sein. Die Unterwerfungserklärung muss die konkrete Verletzungsform wiedergeben; sie kann drüber hinaus auf Handlungen erstreckt werden, die gleichfalls das Charakteristische der verletzenden Handlung aufweisen (Köhler/Bornkamm, UWG, 31. Aufl., 2013, § 12 Rdn. 1.123).
Bei Verstößen gegen Urhebernutzungsrechte empfiehlt es sich daher, das verletzende Werk entweder in die Unterlassungserklärung einzubeziehen oder als Anlage der Unterlassungserklärung beizufügen oder es auf sonstige Art und Weise genau zu beschreiben. Sprachwerke sollten mit dem Titel, dem publizierenden Verlag, der ISBN oder ISSN angegeben werden. Software sollte zumindest mit ihrem Titel und dem Softwarehersteller gekennzeichnet sein. Werke der bildenden Künste sowie Werke der angewandten Kunst und Bauwerke sollten regelmäßig durch den Titel sowie Fotografien der Werke beschrieben, Lichtbildwerke oder Lichtbilder durch Duplikate gekennzeichnet werden. Gleiches gilt auch für Darstellungen wissenschaftlicher und technischer Art, Pläne, Karten, Skizzen, Tabellen und plastischen Darstellungen sowie schließlich auch für Filmwerke.
[...]
- Quote paper
- Prof. Dr. Peter Lutz (Author), 2013, Kurze Einführung in das Urheber- und Verlagsrecht, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/229488